
Blick zurück
Ich blicke auf diese Anfänge nicht ohne Stolz zurück. Als ich zu schreiben begann, wusste ich wenig, aus der Rückschau betrachtet: erschreckend wenig. Ich ließ mich von diesem Wenigen führen, es war mein Licht in der Dunkelheit, mein Führer der Verwirrten, meine Wünschelrute, die immer gerade dann auszuschlagen begann, wenn ich das Spielzeug aus der Hand legen wollte. Das war, im Nachhinein sei es gestanden, oft genug der Fall. Das Spielzeug … nein, es ist, den nicht wenigen Unkenrufen zum Trotz, kein Roman geworden, nicht noch ein Roman, sondern eine offene Werkstatt, in der meine Wenigkeit bis heute zu Gange ist, nicht allein, nein, nicht mehr ganz allein wie in jenen Jahren, in denen mir nur das Schweigen, oft aus dem engsten Kreis, antwortete, sobald ich die Rede auf das Manuskript brachte, das mir solches Kopfzerbrechen bereitete, dass ich darüber, heute kann ich es gestehen, gelegentlich fast den Verstand verlor. Ich betrachte es als Zeichen innerer Stärke, in solchen Phasen der Versuchung, mich in ›Behandlung‹ zu begeben, widerstanden und stattdessen meine solitäre Recherche weitergetrieben zu haben. Geschehen konnte das nur, weil ich bald begriffen hatte, dass nicht die Hand eines einzelnen Menschen, auch nicht des auf rätselhafte Weise verschwundenen Freundes, an meinem aus Ahnungslosigkeit geborenen Dilemma schuld war – sofern hier von ›schuld sein‹ die Rede sein kann –, sondern, sozusagen, die Umgebung, die mich geboren und mit ihren Auffassungen durchtränkt hat: eine rapide sich wandelnde, aber in gewissen Grundverhältnissen sich auch wieder erstaunlich treu gebliebene Welt, an deren Schlaf jenes Typoskript rührte, um es mit einer aus schrecklicher Vergangenheit herüberragenden Phrase auszudrücken. Wie sich im Weiterlesen zeigen wird, ist es nicht bei Rennertz’ ursprünglichem Text geblieben. Man möge den Vorgang produktive Anverwandlung – oder wie meine geschiedene Frau, Diebstahl – nennen: Aus dem Jenseits wandelte sich, Brocken für Brocken, zu Kybrium. Doch der Weg dahin war – und ist – weit. Fast wäre er zu weit geworden, doch das beherzte Eingreifen zweier Frauen und der gekonnte Eingriff eines Chirurgen sollten das, wer weiß zu welchem Ende, fürs erste noch einmal verhindern.
Bringen wir Licht ins Dunkel.
Guido Auerwald




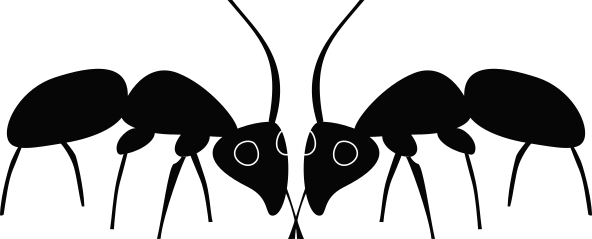
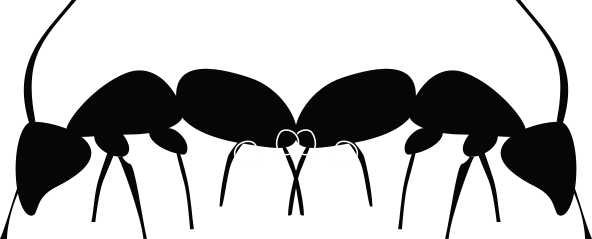





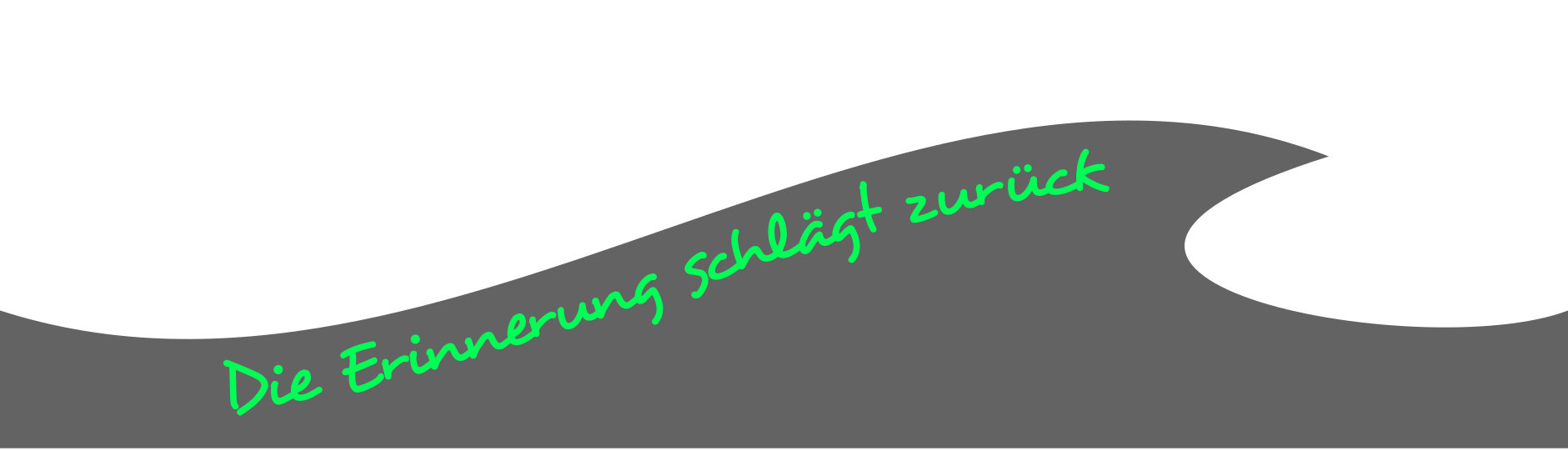







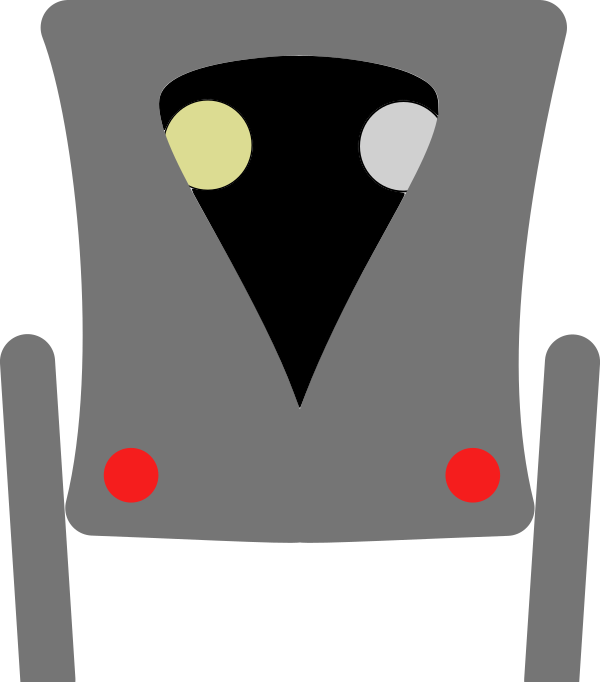





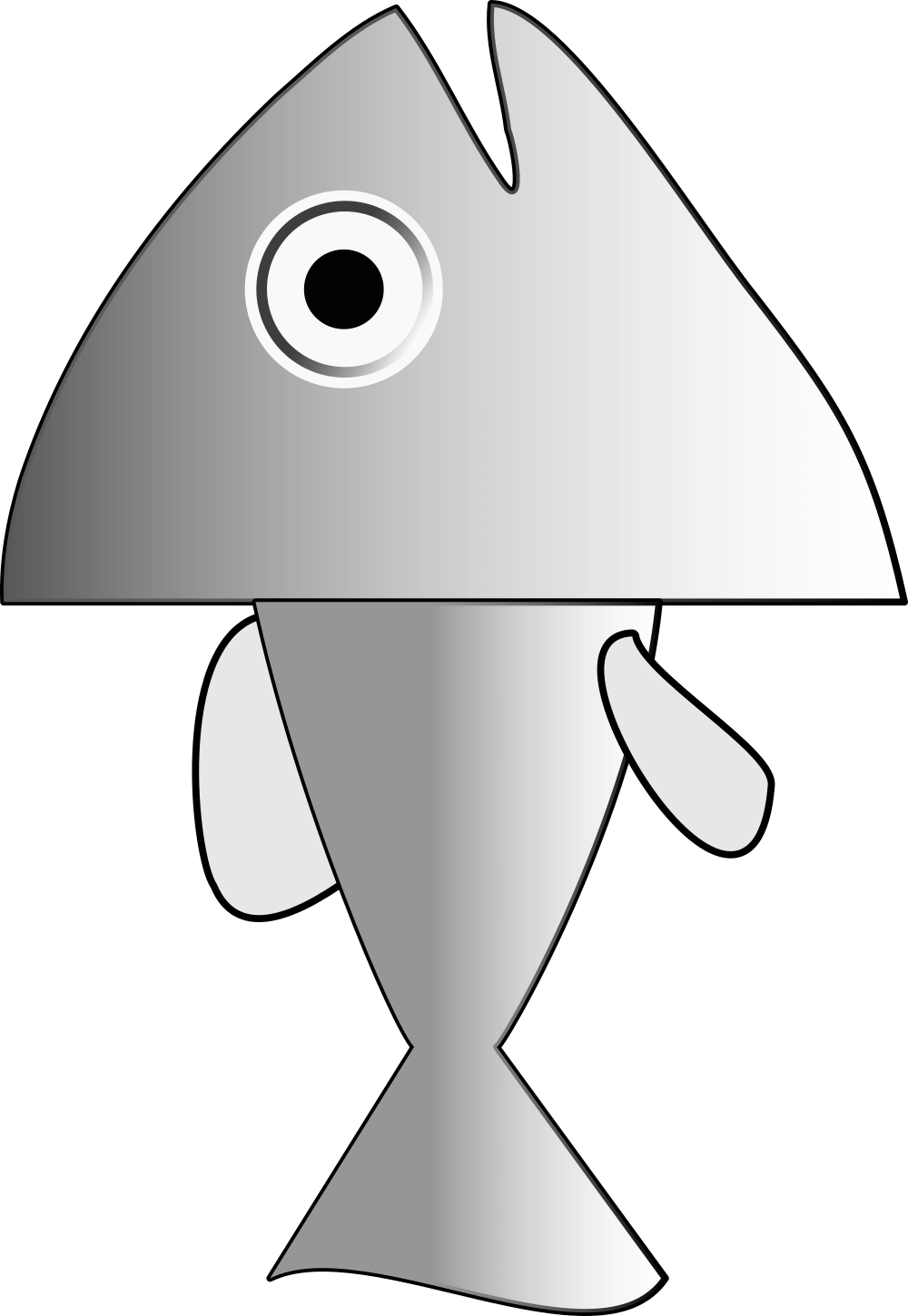
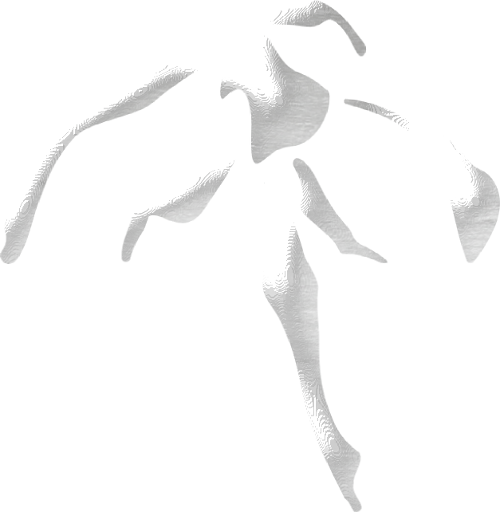
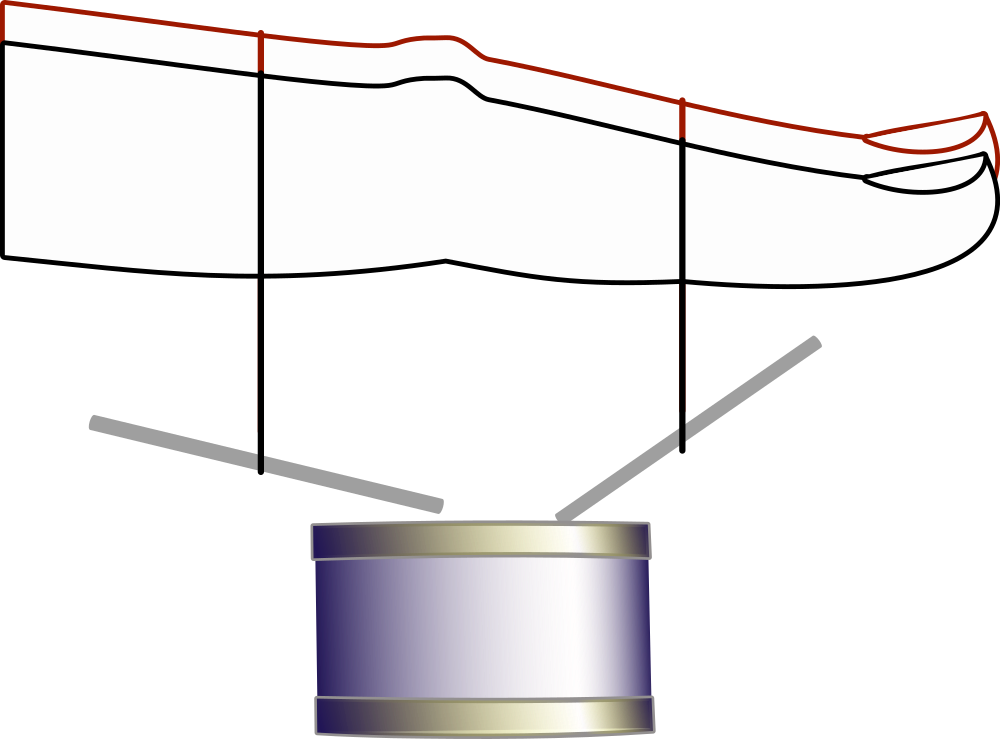


 Proust, nach dem Geschlecht der Kunst gefragt, soll geantwortet haben: unbedingt, absolu. Er hätte auch überhaupt sagen können, aber das hätte kein Leckebusch dieser Welt begriffen. Was ich Alex verschwieg: ein Gutteil der Bilder, die ich bei Mompti gesehen hatte, gingen auf das Konto des jungen Mannes, der auch er einmal gewesen war. Irgendwann hatte er sich des noch unausgereiften Talents bemächtigt und ihm seine Motive unter die Haut gespritzt, direkt ins Blut, so dass es heute noch weh tat, sie zu betrachten. Aber da ging es mir anders als seinen Fans, deren Augen zu glänzen begannen, sobald sie sich in ihre frühen Jahre zurückgesetzt fühlten. Er hätte auch die in einem Winkel seines Raritätenkabinetts vergrabene schwarze Fahne der Anarchie entrollen und an die Wand heften können, der Effekt hätte genauso und vermutlich stärker auf die Tränendrüsen gedrückt. Zwischen einer Handvoll Blätter, scheinbar achtlos mit Reißzwecken an einem Holzbrett befestigt, hing eines, auf dem stand in fetten Versalien: KUNST, durchgestrichen und überdruckt mit dem Wort POTENZ. Was soll der Käse, spuckte er, nach den Papstbildern des Malers Bacon gefragt, wir haben das gemacht. Er meinte damit: Was den Geist des Aufruhrs angeht, lassen wir uns kein X für ein U vormachen. ›Wir‹? Hätte man seine damaligen Mitstreiter kontaktiert, sie hätten sich an kein Wir erinnert, jedenfalls an keines, in dem er eine bedeutende Rolle spielte. Die übriggebliebenen Wirs, die ich kannte, wussten nur von sich selbst und denen, die in den zeitgeschichtlichen Darstellungen paradierten. Sie hatten sogar mehrfach versucht, ihn aus den einschlägigen Kunsthandbüchern zu entfernen, aber eine aufmerksame Clique von Verehrern verhinderte das.
Proust, nach dem Geschlecht der Kunst gefragt, soll geantwortet haben: unbedingt, absolu. Er hätte auch überhaupt sagen können, aber das hätte kein Leckebusch dieser Welt begriffen. Was ich Alex verschwieg: ein Gutteil der Bilder, die ich bei Mompti gesehen hatte, gingen auf das Konto des jungen Mannes, der auch er einmal gewesen war. Irgendwann hatte er sich des noch unausgereiften Talents bemächtigt und ihm seine Motive unter die Haut gespritzt, direkt ins Blut, so dass es heute noch weh tat, sie zu betrachten. Aber da ging es mir anders als seinen Fans, deren Augen zu glänzen begannen, sobald sie sich in ihre frühen Jahre zurückgesetzt fühlten. Er hätte auch die in einem Winkel seines Raritätenkabinetts vergrabene schwarze Fahne der Anarchie entrollen und an die Wand heften können, der Effekt hätte genauso und vermutlich stärker auf die Tränendrüsen gedrückt. Zwischen einer Handvoll Blätter, scheinbar achtlos mit Reißzwecken an einem Holzbrett befestigt, hing eines, auf dem stand in fetten Versalien: KUNST, durchgestrichen und überdruckt mit dem Wort POTENZ. Was soll der Käse, spuckte er, nach den Papstbildern des Malers Bacon gefragt, wir haben das gemacht. Er meinte damit: Was den Geist des Aufruhrs angeht, lassen wir uns kein X für ein U vormachen. ›Wir‹? Hätte man seine damaligen Mitstreiter kontaktiert, sie hätten sich an kein Wir erinnert, jedenfalls an keines, in dem er eine bedeutende Rolle spielte. Die übriggebliebenen Wirs, die ich kannte, wussten nur von sich selbst und denen, die in den zeitgeschichtlichen Darstellungen paradierten. Sie hatten sogar mehrfach versucht, ihn aus den einschlägigen Kunsthandbüchern zu entfernen, aber eine aufmerksame Clique von Verehrern verhinderte das. 



