
Präambel
Übergangslos: ein erstaunliches Wort, es schafft Übergänge, sofort. Sie erinnern sich? Nein, Sie erinnern sich nicht. Nun … wir wollen nicht behaupten, dass wir Abhilfe schaffen können. Abhilfe, was könnte das sein? Aber wir haben es jetzt, immerhin, bereits geschafft, dieses ›wir‹ zu etablieren, eine Schliere im Text, wenn Sie so wollen, etwas, das leicht in der Einbildung zur Schlinge wird, denn von einem wirklichen Wir ist weit und breit nichts zu sehen, jedenfalls vorerst... So oder ähnlich schrieb man zu der Zeit, über die zu berichten ich mich anschicke, obwohl es mir lieber wäre, ich schriebe mich aus ihr heraus, ganz und gar aus ihr heraus, aber wie soll das gehen? ›Ich werde es nicht schaffen, aber ich will es versuchen.‹ Das ist eine vielfach gebrauchte Formel, die aufgrund gewisser lebenstherapeutischer Erfahrungen, sowohl eigener wie fremder, mürbe geworden zu sein scheint. Geht man ihnen nach, dann entdeckt man, dass die fremden oft genaueren Aufschluss versprechen. Wer in den eigenen Erfahrungen wühlt, wird schnell aufgewühlt und ist bereits geblendet. Dieser Effekt entfällt, sobald man aus dem Inneren einer anderen Person heraus denkt, fühlt, redet, berichtet. Man weiß, was man nicht weiß, und diese parasokratische Volte schafft Raum in der Zeit, die ansonsten dicht wie ein Nessusgewand anliegt. Man hat etwas erlebt, etwas wurde einem zugetragen und alles bleibt Hypothese. Mehr ist nicht zu erwarten. Überhaupt sollte man mit dem Erwarten in beide Richtungen vorsichtig sein. Oft sind es Leute, die nichts erwarten, mit denen man Scherereien bekommt. Hört man ihnen zu, so hat man schnell heraus, dass der volle Wortlaut der Formel, mit der sie im Leben punkten, ›nichts als‹ lautet, und weiß Bescheid. ICH ERWARTE NICHTS ALS DIE VOLLE VERFÜGUNG ÜBER DEIN KONTO – was wäre von einem, der so denkt, schon zu erwarten? Nichts? O nein. Übergangslos befindet man sich in einer Welt anderen Zuschnitts. Und darin, wenngleich nicht allein, besteht das Geheimnis des Übergangs.

Sturz
Die Tür fiel ins Schloss.
Sie besaß den nicht besonders satten Klang eines in mäßiger Würde gealterten Melkeimers und schlug dem, der sich fassungslos umgewandt hatte, geradewegs ins Gesicht.
Das Haus, als Scheune gebaut, diente der, wenn man so wollte, goldenen Jugend des Umlands als Stall. Hier rieb sie sich aneinander und ließ Dampf ab. Die Nacht, sternklar, sprach von sozialer Kälte. Dem mochte sich niemand aussetzen und so blieb der Haufen Mensch, dem es soeben das Gesicht geraubt hatte, eine Weile liegen. Er hatte nichts davon. Dem Mangel an Ansprache entsprach nichts von dem, was einer wie er unter anderen Umständen das Innere genannt hätte.
Ein paar Betrunkene stürzten an ihm vorbei zu ihren bereit stehenden Golfs und Mazdas, hinter denen schwach elektrisierend die Gefahren schwer einsehbarer Streckenabschnitte und unbezahlbarer Rechnungen auftauchten, ehe das Aufkreischen der Motoren den Spuk vertrieb. Verschmierter Lippenstift gegen Kolbenbetrieb. Sein Bein schmerzte. Das mochte hingehen. Dass er keine Lust hatte, ein zweites Mal aufzustehen, war ein ernsteres Zeichen.
Hinfallen kann jeder, ich schaue mir an, wie sie wieder hochkommen.
Eine klare Maxime. Väterlich, ohne Zweifel. Nun, dann schau, hätte Hiero gern gerufen, doch der gesichtslose Sprecher war bereits anders beschäftigt, klapperte mit seinem Besteck zwischen den Sturmkiefern und verschwand in einem gewaltigen Hustenanfall.
Hiero war also allein. Er streckte die rechte Hand aus, tastete am Oberschenkel entlang, langsam, langsam, mochte die Nacht darüber vergehen, sie konnten ihn ohnehin nicht auf Dauer hier liegen lassen, dessen war er sich relativ sicher.
Absolut sicher, schoss es ihm durch den Kopf. Die Birne wippte, als schwanke eine Flüssigkeit in ihr hin und her. Auf das ›absolut‹ musste er noch zurückkommen. Über das Knie hinauszukommen gestaltete sich schwierig.
Hiero musste die Lage des Oberkörpers verändern, das bereitete ihm Sorgen. Eigentlich sollte der Krankenwagen bereits in der Anfahrt sein. All diese Leute, die gerade noch um ihn herumstanden, hatten es gesehen, man würde ihn doch hier nicht vergessen.
Er hätte auch rufen können, aber das sonderbare Gekrächz, das sich seiner Kehle entrang, schien nicht in ihre Körper einzudringen, denn plötzlich fiel eine Menge Licht auf den Platz, eine Menschenhorde strömte vorbei, einer berührte ihn sogar am Fuß und stolperte leicht, ohne den Kopf nach dem Hindernis zu drehen.
Dann wurde es dunkler als zuvor, er hätte schwören mögen, dass er die Hand nicht vor Augen sehen konnte. Was nicht weiter verwunderlich war, denn er mochte sie nicht mehr heben.
Was den Fuß anging, so befand dieser sich klar außerhalb seiner Zuständigkeit, dem beugte man sich besser, indem man nichts tat. Angenehm war das nicht, aber damit fiel er wenigstens nicht auf.
Er hasste die Vorstellung, wie ein gekrümmter Wurm dazuliegen, wenn sie ihn fanden und dorthin transportierten, wohin er in seinem Zustand gehörte.
In seinem Zustand? Das klang bös, aber Hiero machte sich nichts vor. Zwar hinderte ihn das Blackout beharrlich daran, sich zu erinnern – es konnte nur ein Blackout sein, fast wie in den alten Zeiten –, aber irgendein Schalter musste umgelegt worden sein, sonst hätte er sich nicht in diesem zunehmend feuchter werdenden Dreck gewälzt, der durch die an mehreren Stellen durchzuspürenden Schottersteine auch nicht anheimelnder wurde.
Langsam sollte der Spuk zu Ende gehen.
Wenn er es richtig besah, musste schon ein gutes Stück Zeit vergangen sein. Allerdings mochte er sich nicht präzise festlegen. Das Zeitbewusstsein reagiert unterschiedlich auf außergewöhnliche Situationen.
War das so?
An der Aussage schien etwas falsch, obwohl er sie im Ganzen unangreifbar fand. Er hatte keine Lust, sich auf eine bestimmte Zeitspanne festzulegen. Er hätte auch momentan nicht gewusst, wie er das anstellen sollte.
Natürlich war er imstande, eine beliebige Zahl zu greifen, aber das konnte es doch nicht sein. Das konnte es doch nicht sein. Eine Aussage, die kein Urteil darstellte, war schon ein Einbruch.
Wenn er hier weiter herumlag, ausgeschaltet von wem oder was auch immer, dann mochte es geschehen, dass er zwar wieder auf die Beine kam, aber…
Das wars dann. Kein Zurück. Damit meinte er jetzt nicht die von einem gewaltigen Rumor erfüllte Kneipe, die jeden Moment in die Luft fliegen konnte, sondern das flächig hingefächerte Davor, dessen er durch diesen verdammten Fuß mehr und mehr verlustig zu gehen drohte.
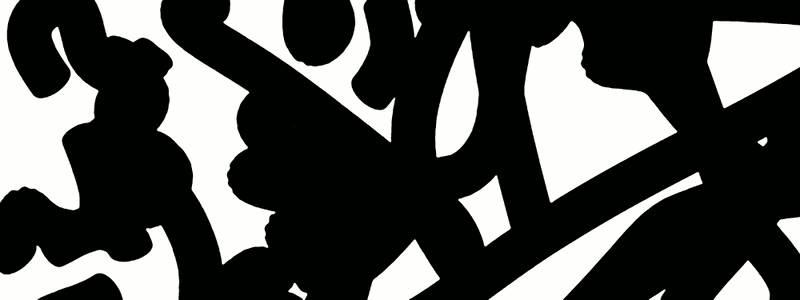
Im Goldenen Pfau
Kein Zurück? Kann nicht sein. Der Goldene Pfau, hereinspaziert. Grün-weiß, ein Name, hergeflogen, auf nachtschwarzer Tafel über geschlossenen Fensterläden, Studentengrüppchen ums doppelflügelige, zweifach offene Portal. Im engen Flur lehnen sie an der mannshohen Täfelung. Fahle Beleuchtung, der Blick des Wirts griefert im Hintergrund, abwesend, omnipresente.
Na hoppla. Weiter im Text. Was denn sonst. Wird schon.
Die Tür zum Schankraum: schwingt. Ruppig. Auf Messingleuchtern glimmen Papyrushütchen, Bernsteinlicht strömt auf Bänke und Tische. So sanft, so dicht. Ringe aus Zigaretten- und Pfeifenrauch, zu Flötenklängen eines so nicht vorgesehenen Schlangenbeschwörers, stromern den oberen Regionen entgegen. An der Wand, stark nachgedunkelt, ein Ararat.
- ―Ein Bier. Zwei Bier. Wer noch? Ich bring auch drei, ihr braucht euch nicht zu beeilen.
Einer der seltenen Momente, in denen der Chef selbst an den Tisch tritt. Ein Gemütshypochonder. Oder zwei.
In jener Zeit, die nun vergangen ist.
- ―Hab dich nicht so. Lass die doch auf ihren Fetischen herumreiten, bis ihnen der Schwanz abfällt.
- ―Ich wüsste nicht, wovor ich mich in acht nehmen sollte.
- ―Der Weber, das ist ein ganz kleines Licht.
- ―Kann man so nicht sagen.
- ―Idealtypus – was soll denn das sein? Kein Apriori, kein Aposteriori, ein Scheißdreck.
- ―Mach dir nicht in die Hosen.
- ―Denk dran, dass sie alles über dich weiß.
- ―Fuck up.
- ―Ich finde, du könntest häufiger einen Joint rauchen. Du siehst heute wieder so frisch aus.
- ―Den Dassler halte ich persönlich für einen Blender. Hast du mal gesehen, wie er auf dem Höhepunkt seiner Suada das Taschentuch rausholt?
- ―Hab ich gesehen. Gekonnt, musst du zugeben.
- ―Was sind das eigentlich für komische Bandwurmsätze? Warte, ich weiß. Dafür gibts einen Ausdruck. Hypo-, Hypo-
- ― -taxe heißt das Ding. Hat er drauf. Damit steckt er sie alle in den Sack.
- ―Neid. Einer wie der andere. Vergiss Charlie, den kannst du hier nicht brauchen.
- ―Hab ich längst. Warst du auch in der Vorlesung?
- ―Nur die erste Hälfte. Ich musste noch am Referat schreiben.
- ―Fräulein Portiönchen, sag mir doch, warum du Romanistik studierst. Wie heißt der Knabe? Wallerie? Was kann man denn über so einen schreiben? Valerie-Valera! Wann gehts nach Paris? Schon gebucht?
- ―Lass sie in Ruhe. Von Ästhetik versteht der nichts. Gib dir keine Mühe.
- ―Mir? Mühe? Mit dem? Müsste ich wissen.
- ―Na also, geht doch.
- ―Fragt sich, wohin. Die Herren Klugscheißer sind ja besoffen, ich merk’ schon. Dann will ich sie auch nicht weiter langweilen.
- ―Sag ich doch. Sie ist eine Zicke.
In jener Zeit, die nun vergangen ist.
In jener Zeit, die nun vergangen ist, schellt eines Morgens der Briefträger und bringt neben dem Päckchen Kondome, das Hiero preisgünstig bei einem Versand bestellt hat, einen Umschlag zum Vorschein, glattes, kühles Papier, reinweiß, garantiert holzfrei, darin liegt, garantiert holzfrei, ein väterliches Handschreiben.
Mein
lieber Sohn,
Du weißt –
Du weißt? Was einer wissen soll, ist keine ganz einfache Sache, ein väterliches ›Du weißt‹ die erste Übergriffigkeit, der man dadurch begegnet, dass man den Brief weglegt, sich eine Zigarette dreht und überlegt, woran es heute liegt, dass der Plan, der gut durchdachte Plan, der einen von einer Vorlesung zur nächsten, von Seminar zu Seminar durchreichen sollte, praktisch bereits wieder zu Makulatur geworden ist.
Du weißt – schrieb der Vater –, dass ich Dir gern die materiellen Risiken, die nun einmal mit dem Leben verbunden sind, abgenommen hätte, aber so, wie die Dinge stehen, liegt dies nicht ganz in meiner Reichweite. Das Haus, das Du erben wirst, ist schuldenfrei, das Geld, das investiert werden muss, um es auf absehbare Weise zu erhalten, liegt auf der Bank. Darum brauchst Du Dir keine Sorgen machen, das ist geregelt. Mit Bedenken erfüllt mich etwas anderes. Ich habe lange erwogen, ob ich Dich damit behelligen soll, aber ich denke, so ist es richtig. Was ich meine, ist folgendes. So gern ich es wollte, den Lebensstil, den Du für Dich anstrebst und den ich mir für Dich wünsche, kann ich Dir nicht ermöglichen. Wahrscheinlich hätte auch ich, wie jeder andere Vater, es lieber gesehen, wenn Du auf einen praktischen Beruf hin studiertest. Aber ich respektiere Deine Entscheidung und bin weit davon entfernt, sie Dir ausreden zu wollen. Erlaube mir daher die väterliche Sorge –
Erlaube mir daher... Kann man so etwas erlauben? Darf man es zulassen? Darf man es auch nur in Erwägung ziehen? Hiero schießt das Blut in den Kopf.
Er zerreißt den Brief in kleine Fetzen, schichtet sie im Aschenbecher auf und zündet sie an. Das ist möglicherweise nicht richtig, möglicherweise nicht loyal, aber Loyalität, das fühlt er heftig, ist keine Einbahnstraße.
Asche zu Asche.
Nebenbei: so erfährt er nicht, denn davon handelte der Brief, dass der Vater Krebs hat, Krebs im letzten Stadium, zu spät oder gerade zur rechten Zeit erkannt, um ihm die Scherereien vergeblicher Rettungsversuche zu ersparen. Der Rest geht schnell – so schnell, dass Hieros nächster Besuch bei den Eltern einer versteinerten Mutter gilt, mit der zusammen er gegenüber einer überdimensionierten, mit einer hellen, exotischen Holzart vertäfelten, sehr glatten, links und rechts von zwei Blumenvasen flankierten Holzwand Platz nimmt. Die Mitte hat man bedeutungsvoll frei gelassen. Dahinter, also direkt vor ihnen, züngeln? lodern? hüpfen? die Flammen des Krematoriums, verzehren den väterlichen Leib, verwandeln ihn in ein helles, leichtes Pulver, das den Angehörigen in einem späteren Abschnitt des Zeremoniells kurz gezeigt wird, bevor Fachkräfte die Urne versiegeln, etikettieren und in ein Regal schieben, denn die Einlassung ins Familiengrab, erfährt Hiero, erfolgt erst ein, zwei Wochen später – der Andrang ist groß. Manche der Hellen und Leichten warten, wie der Bestatter mit feinem Lächeln anmerkt, während sie den Vorratsraum verlassen, schon einmal ein, zwei, sogar drei Monate, sei es, dass die Hinterbliebenen sich nicht intensiv genug mit dem Fall befassen, sei es, dass die beauftragte Firma keinen guten Draht zur Friedhofsverwaltung besitzt.
In ihrem Fall besteht kein Anlass zur Sorge. Die Urne verschwindet so rasch unter der Granitplatte des Familiengrabs, dass Hiero, als er das nächste Mal an den Stätten seiner Kindheit eintrifft, bereits nicht mehr daran denkt. Erst auf der Rückfahrt fällt ihm auf, dass er den ersten Besuch am Grab nun wohl verpasst hat. In Gedanken mustert er, während er an einer langen Kolonne LKW vorbeifährt, die Reihe der mütterlichen Gesichter. Er findet keinen Vorwurf darin, nicht das leiseste Warten, den Vorboten weiblichen Unmuts. So sehr hat sie sich also unter Kontrolle.
In jener Zeit, die nun vergangen ist.
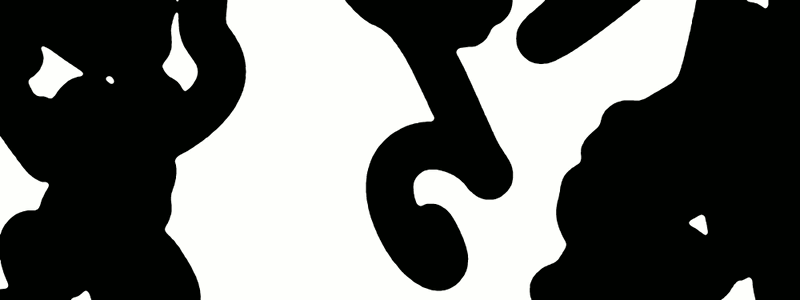
Zivilisationsbruch
Man bekommt dergleichen heute kaum mehr zu Gesicht. Was nicht bedeutet, dass es nicht weiter geschieht. Schließlich besteht die Verwandtschaft darauf und legt gutes Geld dafür hin. Die Diskretion hat, neben dem rituellen Gebot, eine Vorgeschichte. Dachte Hiero an Krematorien, so dachte er an Auschwitz, die erste Adresse unter den Todesfabriken, an Treblinka, Majdanek, Sobibór. Das war so. Es hätte auch anders sein können, wäre er ein anderer gewesen. Aber da es so stand, galt er, selbst bei den Freunden, als heikler Charakter. Respektieren bedeutet in einem solchen Fall: Abstand halten. Gelegentlich kam es vor, dass er in aufflammender Rage einen der gewöhnlichen, mit brauner Brühe gefüllten Plastikbecher vom Tisch fegte. In der halbkellerartigen Caféteria, in die man sich zwischen den Vorlesungen zurückzog, bereitete das keinen großen Umstand. Der linoleumgraue Fußboden war von Zeitungsblättern übersät, die man nur zweckmäßig mit dem Fuß verschieben musste, um dem Malheur zu begegnen. Aber neben dem allgemeinen Hallo rief der Zwischenfall auch Kräfte auf den Plan, die dem Phänomen unverzüglich mit frisch erblühter wissenschaftlicher Akribie auf den Leib rückten. Binnen Minutenfrist schwirrte der Raum von Sprüchen, die dem, der sie tat, unter nur leicht veränderten Bedingungen das Brandzeichen ›Faschist‹, ›Revisionist‹ oder, klassisch einfach, ›reaktionärer Wichser‹ eingebracht hätten, im gegebenen Fall aber ungerührt zum Besten gegeben wurden, weil man sich, insgeheim oder nicht, über den rabiaten Dünnhäuter mokierte, der den Stoff, an dem alle nagten, freihändig, als handle es sich um Leuchtspurmunition, in einen imaginären Himmel jagte.
Hieros legendäre Erregbarkeit lockte auch Neugierige an, die nicht zur Clique gehörten. Unvergessen der Fall des Studenten jugoslawischer Herkunft, dem sein Clan den Weg in den Westen erkauft hatte und mit klassenverräterischen Schecks in einer Höhe pflasterte, die anhand der teuren Klamotten nur vage geahnt werden konnte. Er war mit gewichstem Schuhwerk und einer Blume im Knopfloch aufgekreuzt, um aus einer Art Ur-Recht des Migranten heraus seine gepflegte Hand auf oder eher an allerlei Frauen zu legen, ohne lange zu fragen, was sie zum Erstaunen ihrer dressierten Kommilitonen nicht ungern über sich ergehen ließen. Bald hallte die Caféteria wider vom Geschrei der Kontrahenten.
Es kam der Tag, an dem sie auf riesige Bögen Papier ihre Herkunftsländer zu zeichnen oder krakeln begannen, dazu geheimnisvolle Punkte, Kreise und Schraffuren, im Ergebnis nicht unähnlich dem Anblick der Serviette, auf der Jahrzehnte später der demokratische Alleinherrscher Tudjman und sein autokratischer Gegenspieler das bereits den Landkarten entweichende Jugoslawien untereinander aufteilten. Flach fiel die Hand des einen auf die Orte seiner Kindheit und seiner regionalen Gefühle, mit geballter Faust replizierte der andere und zerquetschte dabei ein paar ungenannt bleibende Delinquenten, die sich ihm in seinem früheren Leben in den Weg gestellt haben mochten. Verständnislos starrten die anderen, längst still geworden, auf den Tanz der Wörter und Fäuste und genossen die Ablenkung durch den Anblick des horizontal aufliegenden Papiers, das an den Rändern rasch einzureißen begann, während es sich immer weiter mit Zeichen füllte. Der eine oder andere spürte vielleicht die Versuchung, mit einem Griff zum Feuerzeug dem Spuk ein Ende zu machen, doch ließ die Aussicht auf eine Schlägerei so kurz vor der Vorlesung die Eingebung wieder verblassen. Worüber die beiden sich stritten, ob sie überhaupt stritten oder ob sie rauschhaft das Gefühl genossen, im jeweils Anderen ihresgleichen gefunden zu haben, ließ sich weder ermitteln noch spontan bestimmen. So trollte man sich nach und nach und überließ die Debattanten sich selbst.
Es war der Auftakt zu einer kurzen wunderbaren Freundschaft. Sie endete exakt an einem Tag, an dem beide einträchtig nebeneinander im Kino saßen und der Mann aus dem Süden, vielleicht infolge einer vom Leinwandgeschehen ausgelösten Assoziationskette – Hiero ging nur in ethisch hochstehende Filme über die dreißiger und vierziger Jahre und kontrollierte akribisch die zu Grunde gelegten historischen Fakten –, vielleicht aus seiner unverblümt zur Schau getragenen virilen Verachtung für den hiesigen, väterlicher Autorität seit einigen Jahren reflexhaft abgeneigten Menschenschlag heraus, bedächtig und stimmlich verhalten, jedenfalls ohne Vorwarnung, die einigermaßen bizarren Worte sprach: Dein Vater ist doch eine Sau. Jedenfalls lauteten sie so in Hieros nur unwillig erteilter Auskunft über das Debakel.
Der Angegriffene, überrumpelt und kaum des Sprechens fähig, hatte gerade dazu angesetzt, seiner Empörung Ausdruck zu verschaffen, da fühlte er auch schon aus dem abgedunkelten Nichts heraus den Hals von zwei kräftigen Händen umfasst, die langsam, man konnte auch sagen gemächlich, zuzudrücken begannen. Hätten nicht, bemerkenswert genug, ein paar Umsitzende energisch eingegriffen, niemand weiß, in welchem Zustand er dem Ort des billigen Nachmittagsvergnügens und der einsetzenden Panik entkommen wäre. Ein seltsamer Vorgang. Woran dachte der Mann, der, merkwürdige Koinzidenz, nicht weit von einem Kaff namens Sarajewo auf die Welt gekommen war, wo das Unheil des Jahrhunderts seinen Lauf begonnen hatte, während er dem anderen gemütlich an die Kehle griff? Woran dachte er, wenn er die Straßen der Ruhrstadt durchstreifte und aus den Schaufenstern die Gesichter seiner Umgebung aufnahm? Was dachte er inmitten dieser Gesichter, die bleich und wesenlos zwischen den ausgestellten Pelzmänteln und Dessous dahinschwebten?
Gute Frage, nächste Frage. Hängen blieb sie schon.
Der Attacke hätte es nicht bedurft, aber sie war der Auslöser, um das allenthalben herumgeisternde Wort vom Zivilisationsbruch in Großbuchstaben an die Wände der Gefängniszelle zu projizieren, die Hiero irgendwann, dem kindlichen Indianerdasein entwachsend, Ich zu nennen begonnen hatte. Dieses Ich, von idealistischen Philosophen gern mit dem zusammengespannt, was sie als ›Selbstbewusstsein‹ bezeichnen, wäre als Vorstellung, die jede seiner Handlungen begleitete, ohne weiteres hingegangen, desgleichen als Figur der Grammatik. Doch an eine solche Beschränkung war nicht zu denken. Wie auch? Was da, anfangs- und endlos, jedenfalls randlos, in ein und demselben Moment aufschien, welkte und schwand, ohne zu weichen, zog einen Hass auf sich, der es nirgends erreichte. Tage gab es, da brachte er Stunden damit zu, mit Fäusten danach zu schlagen – vornehmlich unter Einsatz der Linken, die ihm in diesem Zusammenhang mächtiger vorkam. Was sie vielleicht auch war. Gleichwohl gelang ihm nicht, es zu treffen, da es sich vor jedem seiner Schläge elastisch zurückzog. So kam es, dass er nach manchem fast vollendet geführtem Hieb erst wieder nach ihm Ausschau halten musste. Wo, zum Teufel, war es hingekommen? Wo befand es sich in solchen Momenten? Schon glaubte er ein höhnisches Grinsen vor sich zu sehen und schmeckte Blut.
Wäre er literarisch versiert gewesen – in wie vielen Fällen könnte man so etwas hinschreiben, aber da es sich nahezu von selbst versteht, unterlässt man es –, wäre er literarisch versiert gewesen, so hätte ihm das allerlei Stoff zum Nachdenken geben müssen. Er war es nicht, und was das Nachdenken anging, so verstand es sich für ihn von selbst. Folglich kam ihm der Gedanke gar nicht in den Sinn, hier könnte sich ein unabsehbares Forschungsfeld eröffnen, ein Feld für Streifzüge des Geistes, wann immer ihn danach gelüstete. Im Gegenteil, der Umstand, dass die Philosophen, deren Schriften er verschlang wie andere Leute Groschenhefte oder den Spiegel vom letzten Montag, einen Großteil ihrer Kräfte in einem über Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte geführten Abwehrkampf gegen das Missverständnis verschlissen, ihr Fach könne auf psychologische Fakten aufbauen, hatte bereits das Wort ›Psychologie‹ zu einem roten Tuch werden lassen, das heftige Reaktionen bei ihm auslöste. Nicht dass er das Vorhandensein einer Psyche geleugnet hätte – er bewunderte zwar den Typus Männer, der so weit ging, lehnte ihn aber wegen Unzurechnungsfähigkeit ab –, doch wer sich dieses Gegenstands annahm, gehörte zur anderen Seite und damit basta. Der Streit der Disziplinen, diese hochweise akademische Einrichtung, die Jahr für Jahr eine neue Armee junger Menschen, vornehmlich Männer, rekrutierte, die sich keiner martialischen Neigungen bewusst sind, an imaginierten Orten gegen eine offene Sicht der Dinge in Stellung bringt, hatte in ihm einen überzeugten Streiter gefunden.

Im Fluss
Auch wenn er es nicht wissen konnte: das Menetekel betraf nicht ihn allein. Es stand groß über allen, die ihm, sei es in der Mensa oder in den Vorlesungen, als Altersgenossen unter die Augen traten. Gewaltsam und gewalttätig verschaffte sich die Vergangenheit zu ihren Leben Zutritt – nicht, weil sich – bewahre! – in ihnen die Untaten der Väter wiederholen, eher schon, weil die Zwangsvorstellung sie zu Ersatzhandlungen treiben sollte, die sich wie ein roter Faden durch ihre Biographien und die damit verbundenen öffentlichen Akte ziehen. Je länger sie lebten, desto weniger konnten sie sich verhehlen, dass sie, gerade sie, auf Grund von Dispositionen agierten, die seinerzeit vielleicht wirklich in einen ›Bruch‹ der zivilisatorischen Ordnung geführt hatten. Zivil sein – was ist das? Welche Maßstäbe sind da anzulegen? Bewegt man sich in den Formen, soweit sie existieren, dann macht man sich mitschuldig an der Vergangenheit, die durch sie nicht verhindert wurden, verachtet man sie, so zeigt sich darin der sattsam bekannte antizivilisatorische Reflex. Stellt man sich, überzeugt, die vorhandenen seien durch die Barbarei desavouiert, die Aufgabe, neue zu entwickeln, dann landet man peinlich rasch in einer der Sackgassen, in die die vergangenen Aufbrüche und Bewegungen geführt haben. Verdächtig war alles. War es ›Form‹, die sie leitete, zwischen der eigenen und der älteren Generation einen Strich zu ziehen, den großen Strich, der die Weltgeschichte und die des eigenen Landes – das nicht oder nur in einem verminderten Maße das eigene war – in zwei sehr ungleichgewichtige Hälften teilte? War es die Freiheit selbst? Welche Freiheit war das, die sich der Sprache der bei öffentlichen Anlässen etwas schamhaft ›ehemalig‹ genannten Sieger bedienen musste und damit den Älteren nach dem Munde redeten, die sich gefügt hatten – was bereits an sich, da es die Sprache der Befreiung und der Selbstbestimmung war, zu den Paradoxien zählte, von denen man sich unvermutet umzingelt fand? Lag die Freiheit im Verdacht gegen sich selbst oder im Verdacht gegen die, die inzwischen Geschichte schrieben? Dass man sie gegen die Vergangenheit behaupten konnte, war merkwürdig genug, aber das Merkwürdige wurde durch den Umstand vergrößert, dass man, in völliger Freiheit, sich gegen die Vergangenheit nicht behaupten konnte, dass sie einen, wie der christliche Moralismus sagte, an jeder Stelle wieder einholte, obwohl ein solches ›wieder‹ bereits grotesk klang, da man diese Vergangenheit nur vom Hörensagen kannte, soweit man sie nicht aus den Ruinen der Kindheit buchstabieren gelernt hatte. So geschah es, dass irgendwann im Lauf der Jahre wie von selbst die ›Zivilisation‹ aus der alles überschattenden Formel verschwand und die durch einen überholten, aber keinesfalls verjährten – weiterer Ausdruck aus dem Wörterbuch des Entsetzens! – Missbrauch kontaminierte ›Kultur‹ an seine Stelle trat. Seltsamerweise weniger auf dem Papier – oder, vorsichtiger ausgedrückt, in der Schriftform, in der man sich einer gewissen Korrektheit befleißigt – als in der frei fließenden, stärker durch subkutane Regungen heimgesuchten Ansprache. Hier ist von einem bestimmten Zeitpunkt an fast ausschließlich vom Kulturbruch die Rede, während das Wort ›Zivilisation‹ die unbehagliche Vorstellung ausgepeitschter Sklaven und in hoffnungslose Enklaven zurückgedrängter Aborigines aufruft. Man könnte also denken... man könnte also denken... Warum verwirrt sich die Rede? Warum an dieser Stelle? ... Man könnte also denken, die eine Zeitlang stellvertretend für die Schinder geprügelte Kultur sei im Lauf der Jahrzehnte wieder zu einer respektablen – und respektierten – Größe herangewachsen. Eigenartigerweise hat sich jedoch das, was die in allen einschlägigen Schwenks federführende Generation unter dieser Bezeichnung vorgefunden hatte, zur Zeit der ersten Lebensbilanzen in etwas vollständig anderes verwandelt. Zwar belegt man es noch mit demselben Wort, aber es ist doch nur ein Wort, während die vertraute Emphase, mit der man sich einst bei der Sache wusste, einer ironischen Distanz gewichen ist, die ebenso den rührigen Machern der diversen Szenen gilt wie dem, was da ›gemacht‹ wird. Der ›wieder positiv konnotierten‹ Kultur gilt die schärfste, wenngleich gedämpft artikulierte Verachtung. Doch auch das scheint, unter leicht verschobenem Blickwinkel, nur so zu sein, nimmt man die alles durchdringende Gleichgültigkeit hinzu, die ein Kennzeichen dessen ist, was die Menschen ›den Betrieb‹ nennen, um das Wort Kultur unauffällig zu vermeiden. Ihren Sinn verraten solche Bewegungen innerhalb eines Wort- und Vorstellungsfeldes wohl erst jenseits dessen, was sich einzelne Personen zur Rechtfertigung ihres eigenen Sprachgebrauchs einfallen lassen – in einem historischen, vielleicht geschichtsmacchiavellistisch zu nennenden Raum, den die Leute ungern in ihren Reden berühren.

Razzia im Pfau
- ―Jetzt ist aber Schluss. Das wäre ja gerade so, als hätte einer von uns eine Zeitreise unternehmen müssen, um die Sache persönlich zu verhindern.
- ―Ich sage nur: Was geschehen ist, ist geschehen. Das wirst du doch zugeben müssen, oder?
- ―Ja. Und?
- ―Kein und. Was soll denn da für ein und sein? Ich sage nur: Was geschehen ist, ist geschehen. Das wird man doch sagen dürfen. Was soll denn daran falsch sein?
- ―Also wenn wir nicht befreundet wären, dann würde ich jetzt sagen: Spiel deine Spielchen mit dir allein. Ich hab’ keine Lust, dabei den Trottel abzugeben.
- ―Dann sags doch.
- ―Bitte was?
- ―Den Sündenbock.
- ―Wieso das denn?
- ―Ganz einfach: Sobald das Opfer sich wehrt, ist eben – flutsch – der Täter der Sündenbock.
- ―Das finde ich jetzt aber... also ich weiß nicht, wie ich das finden soll... ich finde das eine Unterstellung.
- ―Ist es ja auch. Na und?
Das Gesicht des Polizisten wird von privaten Sorgen gefurcht. Er versucht einen Ausfallschritt auf sie zu, der Schäferhund zerrt ihn weiter, hin zu ferneren Tischen.
Gut gegangen? Nein, keineswegs. Das wäre ja auch zu leicht, das lehnen sie innerlich ab. Gleich hinter dem sorgenzerfurchten Polizisten kommt sie, die Lady in Schwarz, von Insidern längst erwartet, von Zaungästen frisch bestaunt, und herrscht sie an. Blafft sie an. Knackiger Lederarsch, ein Wunder, dass sie nicht gleich mit der Peitsche auf den Tisch schlägt. So, aus dem Gespräch aufblickend, fragt sich die Runde, ob sie die blutige Brygida vor sich hat oder doch eher eine Archivtante, die den Ausflug um der Klamotten willen genießt. Gehorsam kramen sie, jeder auf seine Weise, nach den Ausweisen. Männerhände in Männerhosen. Ein verächtlicher Schatten fliegt über Brygidas Softface. Wie oft es sich schon gehäutet hat, ist nicht erkennbar, es wäre auch nicht ratsam, danach zu forschen, denn die Inhaberin betrachtet jeden direkt auf sie gerichteten Blick als Unbotmäßigkeit und Aggression.
Sachte, sachte.
- ―Na dann iss ja gut. Ich dachte schon, du wolltest mir etwas unterjubeln.
- ―Dir unterjubeln? Ich kann dir gar nichts unterjubeln. Das bist du schon alles selbst.
- ―Wie meinst du das jetzt wieder?
- ―Ganz einfach. Ich sage doch nur: Was geschehen ist, ist geschehen.
- ―Schon gut. Wir können auch nach Hause gehen.
- ―Nichts ist gut. Wie kommst du darauf, dass daran etwas gut ist? Eins wird man doch wohl noch sagen dürfen –
- ―Du darfst gern alles sagen, was dir durchs Köpfchen huscht. Bedenke aber: Ich-du-er-sie-es-sind-sterblich. Jeder Mensch ist sterblich. Vielleicht wäre das der Leitfaden, anhand dessen du dich und uns schon einmal zu schonen anfangen könntest.
- ―Ich will mich aber nicht schonen. Wenn du dich schonen willst, kannst du ja nach Hause gehen. Man wird doch wohl noch sagen dürfen...
Nicht die Gedankenleere unterbricht ihn – es ist Brygida, die ihn mit kalten Blicken durchbohrt.
- ―Ihren Ausweis bitte!
- ―O doch, gern, wenn Sie meinen. Hiero kehrt das Unterste seiner Hose zuoberst, steht auf –
- ―Setzen Sie sich!
- ―Wenns der Wahrheitsfindung dient.
Teufel auch. Die flankierenden männlichen Kollegen schieben sich näher. Mit flammend gespreizten Händen hält Brygida sie zurück und Hiero bringt ein bröselndes Etwas zum Vorschein: den Lappen.
Hiero, Hiero, das hätte ins Auge gehen können.
Ein Aufatmen geht durch die eben noch so seltsam von Hiero bedrängte Stimme – die falsche Reaktion, wie der Augenpfeil aus Brygidas bisher sparsam frequentiertem Arsenal bekundet. Die übrigen Tische, von Schäferhunden umkreist und mit grünen Uniformen zugestellt, scheinen weit weg zu sein, doch das scheint nur so, denn aller Augen sind nun auf Strabo gerichtet, der seine Taschen zu leeren beginnt, schmutzige Tempo-Taschentücher auf den Tisch schiebt, ein Päckchen Marlboro danebenlegt, einen Backenzahn, den noch niemand hier gesehen hat, drei zerknitterte Kassenbons vom Supermarkt – ordentlich, ordentlich, entfährt es Hiero –, schließlich, mit final-resignativer Geste, eine Schachtel Präservative, Klasse ›natur-feucht‹ (kennst du eine Dissertation über die semantische Funktion des Bindestrichs in Werbetexten?) und einen mehrfach gefalteten Bücherzettel mit durchgestrichenen Titeln auf der hohlen Hand präsentiert, als müsse er sie gleich wieder verschwinden lassen.
- ―Das wars.
Strabos Stimme, die auch sonst keinen Anflug von Traurigkeit kennt, besitzt einen munteren, man könnte auch sagen: belustigten Klang.
- ―Dann kommen Sie bitte mit.
Zucker kann sie sein, die blutige Brygida. Gerades Haupt, runde Augen, Magnetblick. Manchem am Tisch trocknet augenblicklich der Gaumen aus.
Ein Fahndungserfolg.

Mein Land, fremdes Land
Die Lokalität des Bösen, eine ›alternative‹, von ehemaligen Pflegern der nahe gelegenen psychiatrischen Universitätsklinik ins Leben gerufene Einrichtung, lag ein paar Hausnummern weiter; sie galt als terroristischer Unterschlupf. Die Polizei war seit Jahren nervös, in den Zeitungen konnte man lesen, dass Verdächtige oder Unverdächtige angeschossen wurden, selbst durch Wohnungstüren hindurch, weil sie dem Einlassbegehren der Ordnungshüter nicht rasch genug stattgegeben oder sich aus unerfindlichen Gründen davor gefürchtet hatten, sie einzulassen. Man traf Streifenpolizisten im Krankenhaus oder auf dem Friedhof an, die den Fehler begangen hatten, in hoheitlicher Absicht ihr Gesicht einem harmlos aussehenden Fahrzeugfenster zu nähern. ›Lotta continua‹: die Parole der Roten Brigaden glomm in den Herzen einer unbestimmten Zahl von Personen südlich und nördlich der Alpen, die sich ihrer Umgebung nur unter Gegenwehr zu erkennen gaben. An einem dieser grau in grau gehaltenen Nachmittage mit einem Strich Aufklärung am Horizont, die zwischen den Fassaden praktisch nicht zur Wirkung gelangte, stieß Hiero vor dem Eckgebäude, in dem die Filiale seiner Bank ihre bescheidenen Pforten geöffnet hielt, auf eine größere Zusammenrottung von Bullen. Allem Anschein nach stand nicht die Bank, sondern der Wohnungseingang (und das, was sich dahinter verbergen mochte) im Mittelpunkt der Aktion. Hausbewohner, die, den gezückten Schlüssel in der Hand, hineingehen wollten, wurden angehalten und nach einem Schema, das Hiero rätselhaft fand, achtlos stehengelassen oder beiseite geführt und in lange Gespräche verwickelt, aus denen sie mit nachdenklichen Gesichtern zurückkehrten, als habe man ihnen von der desolaten finanziellen Lage, in der sie sich, ohne davon zu wissen, seit Wochen befanden, nunmehr ein ungeschminktes Bild gezeichnet, so dass sie sich überlegen konnten, ob sie lieber den neu angeschafften Wagen abstoßen oder auf die schon gebuchte Urlaubsreise verzichten wollten. Das war eine trostlose, in ihren Augen vermutlich kaum weniger fatale Alternative als die, mit denen sich allerorts die Einsatzleiter der Polizei, die Politiker und ein paar Handvoll Menschen herumschlugen, deren Mienenspiel den etwas rohen Ausdruck der Zugehörigkeit zu ›dieser unserer‹ Gesellschaft annahm, wenn sie in Magazinsendungen das Schicksal der Nation diskutierten. Die Gesichter der jungen, teilweise blutjungen Polizisten wirkten bleich und sehr ernst, als gehörten sie Leuten, die drauf und dran waren, ihre erste Tötung auszuführen oder zu erleiden. Für alles gibt es Knechte. Eine Art Befriedigung verspürte Hiero, als zwei der Bleichgesichtigen nach umständlichen, die Garderobe einschließenden Vorbereitungen die Haustür aufstießen und hineingingen. Die Zahl der Schaulustigen schwoll kontinuierlich an, mit ihr die Spannung, aber da in der Folge nichts weiter passierte, sank sie auch wieder und die ersten Passanten begannen weiterzugehen – gerade mal um die Ecke oder soweit die Füße trugen, nur fort von diesem Ort, an dem sich Macht und Gegenmacht ihr stummes Stellungsspiel lieferten.
Auch Hieros Aufmerksamkeit bröckelte. Schließlich hatte er die Szene aus den Augen verloren, ohne es recht zu bemerken. Alles, was öffentlich geschieht, was den Blick anlockt, ihn eine Weile beschäftigt, ihn brennend beschäftigt, es geht vorbei, es geht, unangenehm oder nicht, vorbei, das ist so eine Alltagserfahrung. Dagegen kommt das rabiate Gefühl, festgehalten zu werden, überraschend: unverhofft, wie die Leute sagen. Was denn verhofft wäre, sagen sie einem nicht. Hieros Gefühl war noch frisch, kaum älter als eine Woche. Das ist nicht die Zeit, in der man etwas vergisst. Gewiss, es gibt diese Fälle, in denen die Erinnerung nachgibt. Der Unaussprechliche von Sils Maria hat das ganz richtig gesehen. Doch dieser Fall lag anders. Recht besehen, handelte es sich um keinen Fall, höchstens um eine Falle, genau genommen um einen Denkzettel für die sträfliche Einfalt, mit der er und Eike in dessen klapprigem R 4, an dem immer irgendein Birnchen streikte, in eine nächtliche Straßenkontrolle getrudelt waren. Zu dieser Tageszeit mied, wer halbwegs bei Trost war, die Ausfallstraßen. Es war ihr Fehler, dies nicht bedacht zu haben – ihr erster. Der zweite lag darin, dem Polizisten nicht zu misstrauen, der nach den Fahrzeugpapieren griff, im Licht seiner Taschenfunzel zu lesen begann, zivil, wie es schien, so lange jedenfalls, bis ein Stoß gegen die Beifahrertür Hiero, der sich abwartend zurückgelehnt hatte, aufschreckte und ins Freie hinaustrieb.
- ―Schnellschnell, rausraus!
Das war nicht die Sprache, in der man sonst mit ihm redete. Gelegentlich verstärkte amerikanische Militärpolizei die Zivilstreifen, das war ihm bekannt, allerdings hatte er nicht gewusst, dass sie auch mürbe gewordene Studentenkisten inspizierte. Kalte Wut unter der gelassenen Oberfläche, stakste er ans hintere Wagenende, hinein ins Gebell. –
- ―Stehen bleiben!
Hatte er recht gehört? Vielleicht nicht doch ›Stehen machen‹? – Als Kinogänger hatte er die Szene plausibel gefunden, hier fehlte das Amüsement, er wusste nicht, wozu Billy Wilder, dieser einfühlsame Regieführer, ihn in seiner Situation angeleitet hätte, und fühlte Scham. Jedenfalls stand er still. Regen rieselte oder nieselte, der Soldat hielt die Maschinenpistole auf seinen Bauch gerichtet, eine lange, sehr lange Lichterkette rauschte vorbei, die Welt – seine Welt – stand in Aufruhr.
Hiero hatte nichts gegen Amerikaner. Eher war das durch die schändliche imperiale Schleppe, die ugly America durch die Welt zog, gepäppelte Ressentiment der Linken geeignet, ihn letzterer zu entfremden – nicht wirklich, das gaben seine Jahre nicht her, aber doch in dem einen oder anderen Punkt. Die ›Staaten‹ waren und blieben das Land der Befreier, die zivile Macht, die dem großen Morden in Europa ein Ende gesetzt hatte, und er empfand eine robuste Sympathie, die sich selbst auf den legendären Toaster erstreckte und nicht davor zurückschrak, die rabiate Medienarbeit sogenannter Falken mit Zähnen und Klauen gegen das Gelächter und die Anwürfe des eigenen Kreises zu verteidigen. Aber ... das hier ... das war etwas anderes. Auf alle Fälle war es heftig. Heftig genug. Überdeutlich empfand er die fesselnde Kraft seines Brustkorbs, in dem sich die Lunge wand und nach Luft gierte.
Es war unwürdig. Ihn überraschte der aufschießende und kaum mehr einzudämmende Gedanke, wie es sich anfühlen mochte, wenn jetzt seine Hand nach der Brusttasche zuckte. Das Mündungsfeuer, in dessen Anblick sein Bewusstsein explodierte und verging, es wäre das Letzte, zeitenthoben, stehende Gegenwart ohne Ausgang. Er registrierte die Versuchung, blieb aber standhaft. Schließlich hatte er nicht den Wehrdienst verweigert, um sich von einer belanglosen, aus Gleich- und Hochmut zusammengeschraubten Visage in die ewigen Jagdgründe versetzen zu lassen. Zweifellos war er ihr hier und jetzt ausgeliefert, darin lag Demütigung genug, er musste sie nicht noch vergrößern.
Mein Land, fremdes Land.
Für einen Mann, der die Mitte zwischen dem zwanzigsten und dem dreißigsten Lebensjahr ansteuert, ist das eine lebhafte Empfindung – kommentarlos hinzunehmen, mit einem Achselzucken. Die Älteren, die Land und Ruf ruiniert und wieder, zweifellos größer und schöner, aufgebaut hatten, waren tot oder fürs Altenheim vorgemerkt. Die Jüngeren, die den Wasserwerfern Paroli geboten hatten, benutzten ihr auf Demos und Sit-ins erworbenes halb- und pseudomarxistisches Kauderwelsch, um Karriere zu machen. Ein paar Aussteiger gaben die Narren der neuen alternativen Milieus. Lächerlich das eine wie das andere. Sah man davon ab, dass es auch Konservative gab, die keinen blassen Schimmer davon besaßen, was sie konservieren wollten, und auf keine ernsthafte Weise in Betracht kamen, aber oft genug von Leuten gewählt wurden, die wussten, was sie wollten, reichte der Mix aus, um den gesellschaftlichen Raum zu füllen – ihn bis zum Bersten zu füllen, so dass man dem Irrtum erliegen konnte, ein Nadelstich könne ihn jederzeit zum Platzen bringen.
Vielleicht erklärte das die vielen Sticheleien in ihren täglichen Diskussionen. Die Realität hielt aber stand, mühelos, so wie sie seit Jahr und Tag dem Revolutionsgerede, der Hatz und den öffentlichen Gehässigkeiten und selbstverständlich auch den Attentaten und Entführungen trotzte. Seltsamerweise stießen letztere am ehesten bei denen auf Gleichgültigkeit oder sogar Zuspruch, die wie er vom Vergangenheitsfieber erfasst waren. An manchen Tagen empfand er die Fememorde, die Totschlagsszenarien, das Hassgebrüll, den wachsenden Druck im Weimarer Kessel physisch. Was war das? Wo lebte er?
Dies da, zweifellos die Rondstetter Straße, soeben kam etwas Sprühregen auf, konnte überall hinführen, ins Leichenschauhaus oder ins Eigenheim, ins eine so leicht wie ins andere. Wie war das möglich? Der GI, ein Holzklotz, vermutlich mit schnellen Reflexen, stand zwischen ihm und Szenen, die sich schlaflos von einer Seite seines Inneren zur anderen wälzten. Der Mann war ein Freund, ein verlässlicher Wegweiser, Hiero hätte ihn in den Arm nehmen mögen, um ihm zu bedeuten, wie sehr er ihn brauchte, wie sehr er ihn schätzte, wie turmhoch er über einem Volk stand, das selbst seine Straßen nicht allein kontrollieren konnte. Daran war, so wie sich die Situation entwickelt hatte, nicht zu denken. Der andere würde, durch irgendwelche Vorschriften gedeckt, unverzüglich von der Schusswaffe Gebrauch machen. Durchsuchen ließ sich das Wild später, dafür hatten sie Spezialisten. Verrückter Hund, würde er mit rollendem ›R‹ zu seinem Halbkollegen hinüberrufen, zufrieden über das elaborierte Stück Landessprache, das ihm da zwischen den Zähnen erblühte.
Ein Missverständnis. Das, immerhin, musste verhindert werden.
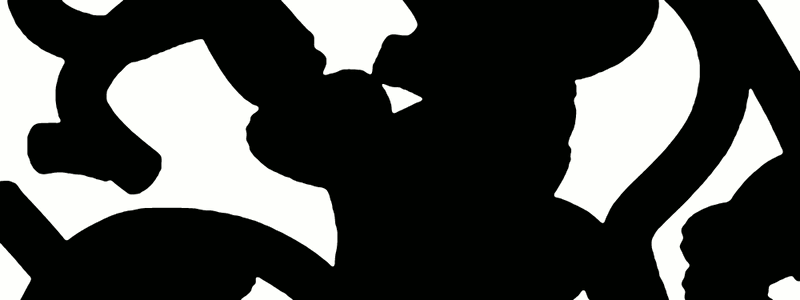
Kärich
Strabo war, was immer das bedeuten mochte, nicht wieder gekommen. Sie trafen ihn am folgenden Tag in der Mensa, still, geistesabwesend, irgendwie verwandelt.
- ―Was haben sie denn mit dir gemacht? Warum bist du gestern abend eigentlich nicht wieder aufgekreuzt? Wir waren noch bis eins da.
Hieros Gesprächspartner vom Vortag, nüchterner nun, aber nicht weniger eloquent, ruckte mit der Braue, zog die Schulter hoch und schaute prüfend.
Strabo fuhr fort, mit dem Essgeschirr zu hantieren.
- ―Ich hätte noch kommen können, stimmt... Scheiße, die haben mich nicht weggelassen.
- ―Was soll das heißen? Wie lang haben die dich denn festgehalten?
Strabo war geradewegs von der Polizeiwache zur Mensa gestiefelt. Das galt als sensationell und stimmte nachdenklich.
- ―Warum denn das?
- ―Weil ich mich nicht ausweisen konnte.
Sein Ausweis samt Führerschein steckte in der Handtasche seiner Freundin, die als pflichtbewusste Junglehrerin in der fünfzig Kilometer entfernten Provinz ihrem Dienst nachging.
- ―Die hätten sie doch anrufen können. Die können dich doch nicht einfach festhalten. Hast du ihnen nicht gesagt, dass sie anrufen sollen?
- ―Haben sie doch.
- ―Und? Sag bloß, sie hat dich verleugnet.
- ―Kann man so sagen.
- ―Die Irma...! Kluges Mädchen.
- ―Hör auf mit dem Scheiß. Sie kommt heut nachmittag.
- ―Heute nachmittag? Olala? Bist du etwa nur vorläufig auf freiem Fuß?
- ―Wenn du das meinst: ich muss mich in zwei Stunden wieder melden.
- ―Und Irma hält munter Unterricht?
- ―Was soll sie denn sonst tun. Hör doch endlich auf.
- ―Also ihr habt sie gestern nicht angerufen.
- ―Doch, natürlich.
- ―Ja und?
- ―Sie hat zu dem Polizisten gesagt, erzähl kein’ Scheiß, und hat wieder aufgelegt. Danach ist sie gar nicht mehr drangegangen.
Eine patente Frau, wie alle fanden, vielleicht ein bisschen resolut, aber man kann sich schließlich nicht alles gefallen lassen, schon gar nicht von den Bullen. Und Strabo brauchte eine feste Hand, darin war man sich ohnedies einig.
STRABO WOHNT JETZT HIER
Das hatte ein Witzbold im Pfau an die Klotür gekritzelt. Mancher rätselte insgeheim, ob der Satz die Aufforderung einschloss, den Ort jetzt reinlicher zu verlassen. Es sprach sich herum, dass der Wirt Strabo vor etlichen Wochen ein Zimmer im Haus angeboten hatte, offenbar aus der vernünftigen Überlegung heraus, dass es für den jungen Herrn eine unnütze Verausgabung darstellte, die wenigen Stunden, in denen die Schankstube geschlossen hatte, außerhalb des Hauses überbrücken zu müssen. Was in diesem Kreis nicht weiter verwunderlich wirkte: Strabo besaß Pläne. Er wollte ›eigentlich nicht promovieren‹ – eine offenbar zielführende Überlegung, von den anderen mit einer gewissen Gutmütigkeit akzeptiert, da es allgemein als unfein galt, irgendeine Art von Ehrgeiz zu erkennen zu geben.
Hieros eigener, ziemlich ungebremster, verbal halbwegs neutralisierter Ehrgeiz verriet sich in dem Gleichmut, mit dem er die Scharteken in sich hineinlöffelte, die der Seminarablauf von Woche zu Woche auf den Speiseplan setzte. Soviel Eifer wurde von den Seminarleitern, bedeutenden Persönlichkeiten des studentischen Universums, nicht wirklich honoriert – ›irgendwie‹ setzten sie ihn voraus und irgendwie belächelten sie ihn. Beiläufig fiel vielleicht in irgendeinem Gespräch bereits der Ausdruck ›guter Mann‹, eine Spezialität des hiesigen Instituts, die definitive Auszeichnung, die den Betreffenden zu einem ominösen Höheren qualifizierte. Es wurde auch langsam Zeit. Studientechnisch gesehen, bewegten sich Hiero und sein Kreis in der Förderschleife für Genies, einer Pufferzone zwischen Norm- und Langzeitstudium, in der allerlei Überzeugungen und Lebenspläne die notwendige Reife erhielten, ohne die sie bloß der wendigen Anpassung auf dem Arbeitsmarkt dienten. Es ließ sich nicht verheimlichen, dass diese Phase mit der gleichen Notwendigkeit auf das Ende zusteuerte wie das muntere Treiben der Rentner auf Ibiza – per Examen, wenn man es nüchtern aussprach. Hiero, kein Zweifel, verstand sich als ›guter Mann‹. Das warf die Frage auf, ob das Prädikat überhaupt gewollt oder gar durch Selbstauszeichnung verliehen werden konnte. Was ihn selbst anging, so hatte er sie beantwortet: Früher oder später würde auf einer der Seminartüren hier oder andernorts sein Namenszug auftauchen, angereichert durch Titel, die ihn, der Reihe nach erworben, als jemanden auswiesen, der lesend, exzerpierend und schreibend in eine nicht weiter bestimmte Zukunft hineinlebte.
Die Sekretärinnen taten, als wüssten sie nichts davon. Sie behandelten ihn wie einen normalen Studenten, genauso wie er, im Gegenzug, sie unter völligem Verzicht auf seine künftige Machtfülle ansprach – ein Spiel, das, augenzwinkernd betrieben, genug über die wahren Verhältnisse aussagte. Er und seinesgleichen waren die kommenden Herren des Instituts. Kein Wunder also, dass das Personal, mittels dessen die gegenwärtigen ihre Macht und, mehr noch, ihre Potenz auszudrücken beliebten, Ahnungslosigkeit vorschützte.
Verliehen wurde das Prädikat ›guter Mann‹ von einem Assistenten. Er hatte es zu einem so selbstverständlichen Bestandteil seiner Rede gemacht, dass es für alle, die nicht nur seine Veranstaltungen besuchten, sondern anschließend mit ihm saufen gingen, wie selbstverständlich die akademische Welt in einen Teil zerlegte, der in Betracht kam, und einen anderen, weit größeren, diffusen, in dem sich allerlei Gelichter tummelte, das zwar ›etwas werden‹ wollte, aber sich damit nur sein Schicksal verdeckte, früher oder später aus dem Tempel der Wissenschaft hinausgekehrt zu werden. Eine solche Sicht der Dinge war autoritär, zutiefst autoritär sogar, erträglich nur deshalb, weil der Assistent, ersichtlich selbst einst als guter Mann gehandelt, gleichzeitig als Kauz in einem gewissen Ansehen stand. Hiero war bereits in Tübingen von seiner Fama gestreift worden.
Wo immer der Name Kärich fiel, heiterten sich die Mienen der jüngeren Professoren auf. So wie er ging, stand, redete, gestikulierte, räsonierte und radomontierte, verkörperte er den Typus des ewigen Assistenten. Er war der Spross eines bekannten Physikers, wobei niemals klar wurde, ob sich diese Bekanntheit eigener Denktätigkeit oder den Zufällen des wissenschaftlichen Betriebs verdankte, der die Leute durcheinander würfelte und Gruppenbilder entwarf, die von künftigen Ruhmrednern angenommen oder verworfen werden mochten. Kärich verfügte also über einen Namen, ohne sich einen gemacht zu haben – ein Startvorteil, der sich rasch ins Gegenteil verkehrt hatte und ihn zur wenig beneidenswerten Figur stempelte, einem Gekreuzigten des Metiers, erbarmungslos ausgebeutet durch den Meister, in dessen Diensten er stand und der nicht im Traum daran dachte, ihm einen anderen Bonus zu gewähren als den... nun, in seinen Diensten zu stehen.
Da stand er zwischen den Tischen des Seminars, die gerötete Adlernase in die Schriftreihen des grünen Bändchens gesenkt, während die runden Äuglein hurtig die Reihen durchflogen. Kein wippendes Frauenbein, entblößt oder nicht, entging diesem Blick. Ebensowenig das leiseste Mienenspiel des gegenwärtigen Favoriten, der jederzeit damit rechnen musste, angesprochen zu werden, um bei der Lösung eines Problems behilflich zu sein, das heute vielleicht erst zehn, vielleicht fünfzehn Leute in Europa, soweit der Seminarleiter es überblickte, in Augenschein genommen hatten, während unsere amerikanischen Freunde, nichts für ungut, sich den Luxus leisteten, Fragen hinterherzuhecheln, die man in Marburg oder Wien schon vor der Jahrhundertwende bequem zwischen zwei Gläsern Tokaier abgehakt hatte – im Prinzip, wie denn sonst.
- ―Die Amerikaner…
Pause.
- ―Die Amerikaner haben eine großartige Literatur – Falkner, Hemingway –, so etwas kennen wir in Europa doch gar nicht. Vielleicht Dostojewski. Ist das Europa? Ich habe da große Zweifel. Philosophisch gesehen sind sie null, nicht existent, zero. Wenn ihre englischen Schwestern nicht aufpassen, mächtig aufpassen, wird ihnen bin-nen kur-zem dasselbe blühen...
Der ausgestreckte, ziemlich dünn und klein geratene Zeigefinger winkte, eine königliche Hoheit, bevor er wieder im Buch verschwand. Die Literatur, von der er sprach, mochte ein Geschenk der Besatzungsbehörde an den Nachkriegsjüngling gewesen sein, die Philosophie stammte aus dem väterlichen Regal.
Im Seminar kamen solche Ausritte eher selten vor, anders in der Kneipe, da beherrschten sie die Tagesordnung. Britanniens Niedergang wurde von ›Kehricht‹, wie eine in diesen Tagen erschienene, den üblichen Spott mundgerecht servierende Satire ihn nannte, obsessiv kommentiert – zum stillen Ärger Hieros, dessen halbe Familie auf der Insel residierte und den jedesmal recht lebhafte Empfindungen überfielen, sobald er daran dachte. Kärich sagte ›anglo-saxon‹ mit entblößtem Gebiss und einer Betonung, als sei das Zubeißen im Preis inbegriffen, der zu entrichten ist, wenn man als Brite auf die Welt kommt – umso verheerender das Los der Zahnlosigkeit, das ›sie‹ sich bereitet hatten, als sie der Schande den Untergang des Imperiums vorzogen.
- ―Übel, übel, murmelte Hiero, allerdings in so abgeschwächter Lautstärke, dass selbst den Nächstsitzenden davon nichts auffiel, denn das, nun ja, hätte die Beförderung zum ›guten Mann‹ gefährdet. Man munkelte so mancherlei, auch über antisemitische Ausfälle bei Steinschwafel, dem großen alten Mann der deutschen Philosophie, der im Nebenzimmer des Pfaus seine Sottisen zum Besten gab. Hiero hatte sich eine der Vorlesungen angehört, die dieser, obwohl längst emeritiert, noch immer vor großem Publikum hielt, und war vor dem homerischen Atem des Alten geflohen. Das war, wie er empfand, die Sprache einer versunkenen Epoche, es war ›Nachkrieg‹ oder Schlimmeres, ohne dass er genauer hätte beschreiben mögen, worin es bestand. Es hätte ihn nicht gewundert, ein paar Rentner mit Einkaufstüten auf den Bänken herumsitzen zu sehen. Was er suchte, war nüchterner, präziser, enger ans Heute angeschlossen als diese Reden aus einer anderen Welt, obwohl er zugeben musste, dass der Alte in den Medien überaus präsent war und sogar im Philosophenplausch vor laufender Kamera mit seinem ehemaligen Assistenten und heutigen Star des Instituts – ›Kehrichts‹ Vorgesetztem – die bessere, weltoffenere und philosophischere Figur machte. Was ihn vollends verblüffte, war der Ruhm, den der Alte in der angelsächsischen Welt genoss, in der man gerade den Kehraus der ›traditionellen‹ Philosophie veranstaltete und dabei auch den angeblich so unklaren Kant entsorgte, den wirklichen Star des Instituts, die graue Eminenz des kontinentalen Denkens.

Ping-pong
- ―Flach halten, flach halten... Junge, du wirst es nicht packen... Das ist doch... Vergiss es. Vergiss es einfach. Doch, das hast du gut gemacht. Nein, so nicht. Netz, Netz! Hat berührt. Hat berührt... Vergiss alles, was man dir gesagt hat... den wirst du nicht packen. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Spiel die langen Bälle, da hast du noch eine Chance.
Der Chor, viel-, hohlstimmig, hier stimmt er zusammen. Hieros Widersacher so vieler Nächte, Pw – ausgesprochen Peh-Weh, knapp, ohne Ausklang, nur Uneingeweihte verirrten sich in die englische Diktion –, und Eike, Schweiger in ebenso vielen Diskussionen, an diesem Ort eher beredt, lehnen an der tadellos geweißten Wand in Hieros Rücken; er behält sie trotzdem im Blick. Hiero und Kärich schuften an der Platte, ping-pong, der Ball fegt über das grasgrüne, von einer nicht sonderlich straff gespannten Schnur gehaltene Zäunchen hin und her, Kärich entblößt die Zähne, er besitzt ein Raubtiergebiss. Seine Sprints von einer Seite der Platte zur anderen sind legendär. Manchmal reißt er sie dabei fast um, seine Kräfte sind wenig gezügelt, ihm fehlt das Training. Kein guter Mann, jedenfalls hier, im Keller des Philosophischen Instituts, aber er schlägt sich. Von dieser Leidenschaft weiß Dassler nichts, dennoch überlegt Hiero manchmal, wie es wäre, wenn er plötzlich hereingeschneit käme, das Anachoretenlächeln im Gesicht, das ihn nie verlässt – früh erworbene Maske und Vorteil, wohin man sieht. Kann man das üben? Oder ist es Erwählung? Diese leise Empfindung des Unheimlichen, die seine Katzenschritte begleitet, die ihnen vorausläuft und bis hierher imaginäre Schatten wirft –
Das war’s. Der Ball, tückisch angeschnitten, springt an Hiero vorbei, gutmütig löst sich Eike von der Wand und geht ihm nach. Aufschlag. Kärich, krebsrot im Gesicht, hetzt nach dem Ball, hinter ihm steht ein Kasten Bier, aus dem er sich bei jeder Unterbrechung bedient. Auch Pw hat sich eine Flasche geangelt, respektvoll, mit seltsam belegter Fragestimme. Will er am Ende ... auch er ... ein guter Mann...? Die Konkurrenzsituation bestimmt sich jeden Tag neu, man muss das Feld im Auge behalten. Pw macht das Spiel über die soziale Kompetenz. Aber er ist kein Philosoph, das sieht doch jeder. Jeder? Kärich, krebsrot, nimmt ihn merkwürdig ernst, die sonore Stimme scheint ihn parieren zu lassen, der sonst so locker sitzende Spott bleibt aus, auf beiden Seiten, das fällt auf. Auch die Flasche in Pws Händen hält merkwürdig lange vor, er will siegen, soviel ist sicher, doch er will auch eine gute Figur machen, ein wenig gehemmt wirkt er schon.
Pw also. In Eikes Fall hingegen ist er sich sicher. Der hat die Divina Comedia mit der Muttermilch. Romanist hin, Germanist her, in dem Fall bleibt es sich gleich. So einer schafft den Sprung in die Philosophie nie. Aufschlag. Kärich süffelt, er saugt, er zieht an der Flasche, als sei sie ein Strohhalm. Nuckler. Der Schweiß hat sein Unterhemd mit Flecken verziert, jetzt reißt er es sich vom Leib, wirft es auf den Stuhl, ist schon wieder an der Platte, staksig und effizient. Hiero hat zurückhaltend gespielt, um den Vorteil nicht auszunützen, jetzt schmettert er, einmal, zweimal, beim dritten Mal treibt er die Kugel ins Netz. Kärich fährt zum Stuhl, reibt sich den Schweiß aus den Augen, ist zurück. Ein Roboter. Außer Rand und Band, aber: ein Roboter. In Tübingen erzählt man sich schmunzelnd, eines Nachts habe er, nachdem der Pfau ihn mitsamt seinen studentischen Saufkumpanen auf den Heimweg entlassen hatte, ein Bibliotheksexemplar der Hegelschen Logik mit der Bemerkung im dunkel und träge vorbeirauschenden Flüsschen versenkt: Dieses Buch hat mich zehn Jahre meines Lebens gekostet. Die besten vermutlich. Hiero, den der Ballwechsel einlullt, kommt es so vor, als habe er die Episode geträumt oder als sei er dabei gewesen. War er’s? Gut möglich, obwohl es vor seiner Zeit gewesen sein müsste. Er kann sich jedenfalls nicht erinnern, was an dem Abend geredet wurde. Auch bleiben die Gesichter der anderen merkwürdig stumpf, leer sozusagen, eine Art Pittura metafisica wie bei De Chirico. Was allerdings an diesen Bildern metaphysisch sein soll, weiß er nicht, die Kunsthistoriker spinnen. Er könnte Eike fragen, der sich öfter bei ihnen herumtreibt, aber wenn er ihn so anschaut, nein, das kann er auch lassen. Eike ist kein Gesprächspartner in solchen Dingen, sobald er ein Wort wie ›metaphysisch‹ hört, bekommt er schon gierige Augen. Katholische Versuchung, gepaart mit Fistelstimme.
Verdammt, nicht aufgepasst. Kärich ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Wenn er so weiter säuft, werde ich ihn packen. Früher oder später. Pw hat ihn klar von der Platte geputzt, nüchtern, konstatierend geradezu, mit diesem Verständnis heischenden Blick, mit dem er jeden existentiellen Konflikt angeht. Und Kärich hat ihn verstanden, am Kasten sind sie sich ebenbürtig. Eike, der einzige wirkliche Tischtennisspieler im Raum, ist gar nicht angetreten, er beschränkt sich auf Kommentare.
4:11, 6:11, 12:14 – als Tendenz kann sich das doch sehen lassen. Gleich geht wieder Pw an die Platte, mit einem schnoddrigen Ausdruck, wenn es das gibt, um Mund und Backen, der geblähte Hals und die Augen stehen dazu in Widerspruch. Vor dem Aufschlag sucht er den Blick des Gegenspielers. Hiero, noch mit dem Aufsammeln der Bälle beschäftigt und auf einen Schluck aus der Flasche erpicht – der vorletzten im Kasten, die letzte würde er um nichts in der Welt anrühren, das ist Kärichs Terrain –, fischt den stummen Vorgang aus allen heraus, die in dem niedrigen Raum koexistieren: Da steht Eike, in eine Lektüre vertieft, die gerade noch nicht existierte, aufgetaucht aus einem Abgrund, einem Loch in Raum und Zeit, neben ihm, ein Schatten, lümmelt dieser Kerl, den sie Luxor nennen und der sich bewegt, als habe er noch eine Rechnung mit dem Bademantelverkäufer offen, könne jedoch das gute Stück aus unaussprechlichen Gründen vorderhand nicht ablegen. Er wird gleich wieder verschwunden sein, es hält ihn nicht an solchen Orten, aber er hat einen Blick auf Pw geworfen und schleicht ihm nach. Auch Treue wahrt uns die Person. Merkwürdig schon, denn Pw, das wissen alle live, ist ausgesprochen hetero. Allerdings trägt er seine Maskulinität wie eine zweite Haut, wie Schmuckwerk, das wird es sein. Zuviel Mutter im Spiel, das wird es sein. Die Mutter-Pils-Maschine treibt ihn voran.
- ―Ein Pils! Das wievielte haben wir denn schon heute abend? N-ein, man darf den Überblick nicht verlieren. – Niemals. Sonor im Ton, jawohl, das ist Pw, die Mutter-Pils-Maschine mit klaren Maximen: erstens, auch in schwierigen Situationen den Kopf oben behalten, zweitens, nicht die Kontrolle verlieren, der Rest, drittens, ist Stammtisch. Sogar der Wirt bekommt dieses innere Leuchten, wenn er an ihren Tisch tritt, ein Pw pro Abend, das hebt den Umsatz. Auch Kärich ist ein tüchtiger Pichler, doch bei weitem nicht so ansteckend, bei ihm trinkt man mit, wie man im Seminar den Finger hebt. Reines Pflichtgefühl, dazu ein Quäntchen Besorgnis, er könne sich sonst einsam vorkommen und aggressiv werden, was gelegentlich eintritt. Dann schlägt der Alkohol aus ihm heraus, ein Dschin, Kärich quäkt, nicht zu laut, aber an den Nachbartischen dreht sich der eine oder andere nach ihm um. Er schreit kontrolliert, eine heisere Lautfolge strömt von seinen Lippen und vernichtet – unter Spinozisten: annihiliert – das Opfer, das sich gerade noch auf annähernd ›gleicher Augenhöhe‹ mit ihm sah und vielleicht in einem beiläufigen Urteil zu weit ging. Gewiss ist ›annihiliert‹ das richtige Wort, es handelt sich um eine rituelle Hinrichtung ohne Wenn und Aber, ohne vorangegangene Eskalation und anschließende Auslegung des Geschehenen. Blitzartig sieht sich der gute Mann unter das gemeine Volk zurückgestuft, ohne weitere Folgen übrigens, aber wirksam.
Ihm, Hiero, ist so etwas bisher erspart geblieben. Nicht auszudenken, was in so einem Fall geschähe. Kampflos würde er nicht weichen, soviel ist sicher. Einmal nur fühlte er sich verdammt nah dran, auch wenn er sich damals nicht äußerte. Das war, als er im abgeschotteten Zwiegespräch – sie rollten im Fond eines Wagens irgendeiner Feier entgegen – auf einen Freund aus Tübinger Tagen zu sprechen kam, den sie Ingo Ha nannten, was einerseits besser als H-Punkt klang, andererseits einen Überschuss darstellte und seine allgemeine Beliebtheit zum Ausdruck brachte. Ingo ist ein paar Jahre älter als er, entscheidende Jahre, es geht ihm nicht gut, er tingelt von Universität zu Universität, von einer Semesteranstellung zur nächsten, stopft mit der Hoffnung auf ein Forschungsstipendium oder – höchstes Glück! – eine Lehrstuhlvertretung die realen Löcher seines holprigen Lebenspfads, während Regine, die weniger ambitionierte, wohl auch weniger intellektuelle, aber offenbar gefragtere Freundin mit einer glanzlosen Anstellung an einer dieser schrecklichen Neugründungen auf eher unauffällige Weise für den Lebensunterhalt sorgt. Ihn also erwähnte er, nicht, weil er ihn damit ins Gespräch bringen wollte – ein gefährliches, geradezu halsbrecherisches Unterfangen! –, sondern weil ein simples Stück Erinnerung ihn in diesem Moment dazu bewogen hatte. Kärich stutzte, offensichtlich sorgte der Name für Nachhall, Nase und Fingerspitze wanderten synchron auf elliptischen Bahnen nach vorn, wider Erwarten blieb die Stimme ruhig:
- ―Guter Mann. Jedenfalls war er das mal. Schade drum. Seine Habil ist ja jetzt publiziert. Reine Doxographie. Reine Doxographie!
Die Habilitationsschrift, vulgo ›Habil‹, ist das Maß aller Dinge, zumindest in Kärichs gegenwärtigem Universum. Sie entscheidet darüber, wer einer ist, ob er überhaupt einer ist, ihr Erscheinen bedeutet Sieg und Eintritt in den härtesten Wettbewerb, die Jagd nach dem Ruf. Der mögliche oder unausweichliche Ruf ist im Kreis immer gegenwärtig, das Wort bezeichnet die Säulen des Herkules, hinter denen das Mare infinitum beginnt, die hohe See befremdlicher Genüsse und schaudernd erzählter Schiffbrüche. Eike, nach wie vor in seine Lektüre vertieft, ist der Spross eines ausgebliebenen Rufs, ein gebranntes Kind. Jedes Buch, das ihm zwischen die kurzen, derben Finger gerät, gewinnt unter der Hand Ähnlichkeit mit dem väterlichen Skalp und muss sich, statt durch die Kraft und Anmut seiner Gedanken zu wirken, einen Katalog von Fragen über die menschlichen Kosten gefallen lassen, die bei seiner Herstellung anfielen, das Leid der beteiligten Frauen und Kinder wächst mit jeder Lektüre, ein lustvoll bemalter Abgrund.
Hiero glaubt dem Freund kein Wort. Aber der Affekt ist schön, das muss man anerkennen, nicht ungefährlich, wie sich in den endlosen Gesprächen über Promotion und Karriere zeigt, wo Eike eine harte Linie fährt und die moralische Verderbnis der Intellektuellen geißelt, die ein eingebildetes Gemeinwohl über das Wohl der Familie und der persönlichen Umgebung stellen, weil sie auf diese Weise freie Hand bekommen, ihren egoistischen Motiven zu folgen und dem Lustprinzip zu frönen. Dieses Wort ›frönen‹ ist Hiero auffällig, er kennt sonst niemanden, der es benützt. Eikes Rede verleiht ihm etwas Scharfes, Höhnisches. In Hieros Einbildung verbindet es sich mit dem Bild eines älteren spitzbärtigen Menschen, der sein Leben hartnäckig der Lust verschrieben hat und, in irgendeiner komplizierten technischen Apparatur verankert, über einem anonymen Frauenkörper schwebt, der sich auf jede erdenkliche Weise darbietet und entzieht.
›Schule‹ hingegen, das Lehrerdasein, die große Alternative nach Abschluss des Studiums, bedeutet Nähe, Familie, Menschlichkeit, Arbeit an jungen Menschen, sinnhaftes Tun, vergleichbar dem eines Chirurgen oder Dermatologen. Warum? Ehrlich gesagt, Hiero weiß es nicht, will es vielleicht auch nicht wissen. Die Argumente der anderen leuchten ihm nicht ein, ihm will scheinen, die Tatsache, dass man sich nach Schule nicht strecken muss, dass man, jedenfalls zur Zeit noch, ein Anrecht darauf hat, als Referendar ›übernommen‹ (sic!) zu werden, wenn es soweit ist und die Leistungen stimmen, zeichnet diejenigen, die sich dem System überlassen, nicht weniger als Privilegierte aus als irgendeine Karriere. Kommt er auf diesen Punkt zu sprechen, dann wird Eike ganz ruhig und Pw schaltet sich ein: mit der Einstellung könne er natürlich in den Busch gehen, was immer eine Lösung darstelle – an dieser Stelle steckt er den Finger in die Bierflasche und zieht ihn mit einem Plopp wieder heraus –, schon sein Studium könne er ›mal ruhig‹ vergessen, das sei doch das reinste Privilegienwesen.
- ―Ich habe nichts gegen Privilegien, ruft Hiero leicht erregt. Es geht, wie so oft, gegen zwölf Uhr mittags, sie hängen in Antons zentral gelegener Bude herum, einer nach dem anderen sind sie hereingetröpfelt, um sich für den Mensagang zu sammeln. Anton sortiert in komischer Verzweiflung die Papers, deren Lektüre er sich für heute vormittag vorgenommen hat, gehorsam überlässt er sie Pws Händen, der sie rasch durchblättert und mit staatsmännischer Miene zurückerstattet:
- ―Gutes Material, was? Wir reden heut nachmittag drüber.
Anton seufzt, dann wird er munter:
- ―Privilegien, ja! Wer hat hier Privilegien? Kann mir einer was davon abgeben?
Alle lächeln, er ist der Privilegierteste von allen, sein Vater, praktizierender Landarzt, wirft keine Legitimationsprobleme auf, er selbst will nichts werden – betont: nichts! –, er studiert, um ›diese Sache mit Gott‹ für sich zu klären, er kommt aus einem religiösen Milieu.
- ―Wie wird man nichts, fragt ihn Hiero manchmal, er würde das gerne klären, aber die Frage verfängt nicht. Anton, ein kräftiger Mann, der sie alle – rein körperlich – an den Schauspieler John Wayne erinnert, bleibt aufgeräumt, das entspricht seinem Naturell. Gäbe es da nicht diese Sache mit Gott, man könnte ihn für einen harmlosen Ingenieurstudenten halten, so wie seine beiden Eifel-Cousins, die einmal pro Semester, eine Fuhre Bierkästen im Gepäck, für die Dauer eines Nachmittags und einer durchzechten Nacht bei ihm auftauchen. Hiero hat sie gesehen: zwei fröhliche Jungs auf dem Weg in die Freizeitgesellschaft, es hat ihn geschüttelt.
- ―Reine Doxographie!
Kärich kräht das Wort über die Platte hinweg, er hat das Unterhemd abgelegt, um den Schweißfluss zu kontrollieren, Pw führt und nützt die Gelegenheit, um anderweitig Punkte zu sammeln. In seiner Miene treiben studentische Bemühung und echte Besorgnis, die Welt könne einen falschen Gang gehen, weil Spinoza 2-43 noch immer nicht in seiner argumentativen Brisanz erkannt worden sei, miteinander Schabernack. Die doxographische Klippe ist nicht so leicht zu umschiffen, das wissen alle, die in Kärichs Bannkreis vorankommen wollen. Sie ist, um die Wahrheit zu sagen, im Dunst der Argumente kaum zu erkennen; wenn sogar eine in den einschlägigen Organen beifällig besprochene Spinoza-Interpretation in den Strudel gerät und Gefahr läuft, an der Platte zerschmettert zu werden, dann lässt sich mit Anstelligkeit kaum etwas bewirken, dann bedarf es schon eines philosophischen Basisblicks. Man hat ihn oder auch nicht. Pw, dessen ist sich Hiero sicher, besitzt davon nicht die Spur. Seltsamerweise verleiht ihm das diese erstaunliche Leichtigkeit, mit der er schon einmal selbst das Schwert führt oder sich als Schildknappe einführt wie jetzt, da er mit seiner sonorsten Stimme, in der leichte Einlagerungen von Nachdenklichkeit zu erkennen sind, zurückgibt:
- ―Das denke ich auch. Das Problem ist, dass es bei diesem Autor keinen Unterschied macht.
Das war kühn, sehr kühn sogar, doch Kärich hält mit:
- ―Neben Spinoza ist alles Doxa.
Hiero fühlt eine leise Lähmung in sich aufsteigen: Sollte das wahr sein (er kennt Kärichs Unerbittlichkeit in dieser Frage), dann wäre es wirklich absurd, das Fach weiter zu studieren. Er könnte sich genausogut bei den Historikern durchochsen. Am besten Mittelalter. Bei der gähnenden Leere in den dortigen Seminaren – von den Köpfen nicht zu reden – hätte er den Ruf praktisch schon in der Tasche.
Anton, der gerade hereinschlendert, hat es da leichter: einen Milieuschaden reparieren bedeutet eine therapeutische Anstrengung diesseits von doxa und epistēme, von ›bloß historisch‹ und ›systematisch‹, er ist der einzige in der Runde, der über Kärichs Sprüche lachen kann, den anderen bleibt das Lachen im Halse stecken. Lächelnd sucht er den Blickkontakt zu Hiero und stellt sich neben Eike, der sein Buch zuklappt. Die beiden reden leise miteinander, es sieht aus, als wollten sie verschwinden, doch dann hebt sich ihr Blick. Anton, das merkt Hiero, macht sich bereit. Sehr vorsichtig schaufelt Pw den Ball in die Richtung zurück, aus der er geflogen kommt, er will den soeben erworbenen Vorteil nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Seine gespannte Hand erinnert an eine Krake, die Vorstellung ist unfair, aber nicht zu entfernen. Kärich scheint das Interesse am Spiel verloren zu haben. Seine Sprints wirken mechanisch, der Blick ruht innen, er hat, ehrlich gesagt, keine Chance mehr und entwertet vorsichtig das, was noch kommt. So machen’s alle. Warum liegt dann alles, was er tut, wie unter einem Vergrößerungsglas? Hiero weiß es nicht, er will, dass er es nicht weiß, daran hält er sich. Es hat nichts zu bedeuten, wäre es anders, so wäre in der Tat ›alles Doxa‹, soviel ist ihm bewusst. Das andere... es liegt zutage, aber es fehlen die Wörter. Es ist auch nicht dunkel, sonst könnte es durch eine geeignete Gedankenoperation ans Licht gehoben werden. Es liegt aber schon obenauf, es ist hell, klar, fast durchsichtig, in Pws Ausgeschlafenheit liegt es stärker zutage als im dumpfen Unverstand irgendeines Durchschnittsstudenten, und wenn Eike sich abseits hält, dann liegt darin vielleicht der stärkste Tribut... Ist das wahr? Sollte das wahr sein?
Nun, was ihn selbst angeht, er ist wach, hellwach, insofern allem gewachsen, was da im Raum stehen mag. Vielleicht ist diese Wachheit selbst das Vergrößerungsglas, eine Anomalie im Auge des Betrachters, das mag schon sein. Dass Kärich ein zutiefst unbedeutender Mensch ist, davon hat er sich nicht erst überzeugen müssen, das sprang ihn an, als er ihn zum ersten Mal nach Dasslers Vorlesung sah. Seltsam schon, irgendwie eigenartig, diese Pinocchio-Figur neben der smarten Kühle des Champions, eine kühne Variante von Raffaels Schule von Athen, in der die beherrschte Figur des Schülers sich in den Lehrer aller Klassen verwandelt hatte, während der völlig unmajestätische Finger eines derangierten und schwadronierenden Platon – Kärich redete unentwegt auf Dassler ein, und es war, kein Zweifel, Philosophie, was aus seinem Munde strömte – vergebens in alle Himmelsrichtungen zeigte, außer nach oben, wie es sich doch gehört hätte.
Kärichs Fuchteln ist notorisch, es bricht aus ihm heraus, wo er geht und steht, sobald er nur zu anderen Wesen in Kontakt tritt. Manchmal muss sich Hiero ein Lachen verbeißen, spätestens wenn er ihn unter dem spärlich interessierten Blick einer als Studentin verkleideten Bettmieze zur Höchstform auflaufen sieht. Unempfindlich den Mitmenschen gegenüber ist Kärich nicht, im Gegenteil, alles steigert seine Frequenz, bis der andere aussteigt, bis er aussteigen muss, weil ihm vom bloßen Hinsehen schwindlig wird.
Kärichs Habichtsauge hat die Bewegung am Rande erfasst, er streckt den Finger, bestimmt Anton zum nächsten Gegner. Hiero kennt die Bewegung. Mit ihr wird im Seminar die Reihenfolge der Protokollanten verfügt. Kärich hat das Ritual von Dassler übernommen, er genießt es wie einen sexuellen Exzess. Antons Theologenlachen flammt auf und verglimmt, einer brennenden Zigarette gleich tritt er es aus. Und er tritt an. Mit schlurfendem Gang nähert er sich der Platte, wirft einen Spähblick hinüber, wo Kärich in gespannter Aufmerksamkeit wartet, wiegt den Ball, dieses Federgewicht, in der Hand, lässt ihn auf dem Handteller rollen, hin und her, rundherum, rascher, ein irrer Kreisel, die schaukelnde, kreisende Bewegung der Hand spricht von magischen Kräften, die, einmal aufgerufen, nicht mehr so leicht zu bannen sind. Der Ball saust über die Fingerkuppe, hüpft auf der Platte, einmal, zweimal, springt auf den Boden, nackter Beton, die Hand greift nach unten, schaufelt ihn wieder herauf, lässt ihn weiter kreisen. Anton legt Ball und Schläger (wo kommt der plötzlich her?) nebeneinander auf die Platte und entledigt sich des Pullovers – das alles unter dem Habichtsblick Kärichs, der mit dem rechten Handrücken über den Mund fährt und an der Lippe zu nagen beginnt. Anton knöpft das Hemd auf, zur Hälfte etwa, dann besinnt er sich und schließt einen Knopf. Dafür krempelt er, langsam, beharrlich, die Ärmel hoch. Die Oberarme sind, wie die Brust, dicht behaart, schwarz ringelt es sich unter dem Hemdweiß hervor. Hiero betrachtet es mit gemischten Gefühlen.
Wenn Anton lacht, wird es ernst. Das mag an der wohltrainierten Muskulatur liegen, die bis in die Festigkeit des Blicks reicht, aber es ist mehr. Er meint es ernst. Doxa pur sozusagen. Im Augenblick beschränkt er sich auf ein mechanisches Lächeln. Kärich pendelt, der Aufschlag trifft ihn völlig unvorbereitet. Verdutzt starrt er auf seinen Schläger, als habe der ihm gleich beim ersten Rendezvous einen Korb gegeben. Zu Unrecht: es war nicht der Schläger, es war die Hand. Was Anton hier abzieht, liegt klar unterhalb von Kärichs Reaktionszeit. Er reagiert darauf wie die meisten Männer dieser Welt – mit Wut. Anton, der fröhlich entspannte, hütet sich zu lachen. Der dort, das weiß er, will ihn ›packen‹. Das wird schwierig werden, aber zu Kärichs Spezialitäten zählt auch, blitzschnell die Ebene der Auseinandersetzung zu wechseln, sobald es brenzlig wird. Andere mögen das unfair nennen, umsonst, es ist die Realität des menschlichen Dschungels, an der schon so manche Großkatze verblutete, man muss sich ihr stellen. Hiero sieht und hört, er weiß aus eigener Erfahrung, was Antons Spielweise anrichtet. Dass er sich auf Kärichs Finten überhaupt einlässt, wundert ihn und lässt ihn ein bisschen ratlos blicken.
- ―Sie lesen Kierkegaard?
Das kommt prompt, anstelle des Balls, Anton lächelt geschmeidig, ein wenig fusselig, als wolle er sagen: Können wir das nicht auf nachher verschieben, aber dieser Eindruck ist weggeblasen, als er den Mund auftut.
- ―Ja, das kann man so sagen. Schon, ja, ich glaube schon.
Hier stehe ich, ich kann nicht anders.
- ―Reine Zeitverschwendung, quäkt die krebsrote Kampfmaschine. Warum machen Sie das?
Antons Lächeln ist wie weggeblasen.
- ―Wenn ich das wüsste! Das ist es ja. Ich kann nicht aufhören, solange ich es nicht weiß.
Guter Konter, leider nicht gut genug.
- ―Sie werden nichts finden. Wenn ich Ihnen das sagen darf: Sie werden Ihre Zeit vergeudet haben und Ihr Brot mit Tränen am Fuß der Klassiker essen.
- ―Sie meinen Hegel?
- ―Hegel, zum Beispiel. Hegel auch, ja. Kierkegaard ist eine Fußnote, nicht einmal das, ein Halbsatz. Kommen Sie in mein Seminar, dort lernen Sie den Urtext kennen.
Das war wirklich schwach. Anton blickt erstaunt hoch, seine Stimme fusselt:
- ―Den Urtext? Was ist denn das?
- ―Das wissen Sie nicht?
Kärich jagt den Ball ins unerreichbare Eck.
- ―›Nur drunter / wechseln die Münder.‹ Kennen Sie das? Nein? Später Rilke. Liest keiner. Das mit der Stimme ist Quatsch, Philosophie hat es nicht mit der Stimme zu tun, sondern mit dem Text. Spinoza: Ethik. Hegel: Logik. Merleau-Ponty: ganz nett. Gehören Sie auch zu denen, die Wittgenstein für Philosophie halten?
Der Angriff rollt, Kärich ist nicht zu stoppen, Anton verschlägt Ball um Ball. Er knetet den Schläger, betrachtet ihn eingehend, wirbelt ihn durch die Luft, kontrolliert den Griff, sein Aufschlag hat Kraft wie selten, aber – er kommt nicht.
- ―Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht mit Sein und Zeit anfangen soll. Tut mir leid, aber in dem Semester wird nichts dazu angeboten.
- ―Sein und Zeit?
Kärich richtet sich auf.
- ―Sagten Sie Sein und Zeit? Meinten Sie Sein und Zeit? – Mein Herr, ich glaube, unser Spiel ist soeben zu Ende gegangen. Abbruch, Kabine, wer reicht mir ein Handtuch?
Pw ist zur Stelle, weiß der Himmel, aus welchem Winkel seiner Seminartasche er das Ding hervorgezogen hat.
Es beginnt bei den Namen. ›Name dropping‹ heißt das Spiel und sie lachen darüber, das beherrscht auch Hiero, er brachte es schon aus Tübingen mit. Selbstverständlich stehen die Namen für etwas. Aber für was? Das ist ein Geheimnis, in das einen keiner einführt, obwohl es doch auf der Hand liegt. Sie stehen für den Autor – kein Wesen aus Fleisch und Blut, sondern eines, der sich entweder bereits restlos in all die Bücher verwandelt hat, auf denen sein Name prangt, oder, falls es noch lebt, die Aussicht auf neue, unerwartete Titel schürt. Manchmal steht ein Name auch für einen einzigen Titel und man selbst steht ganz schön im Regen, wenn man das nicht weiß und die für teures Geld angeschafften, aber leider falschen Schriften mit wachsendem Enthusiasmus studiert, um am Ende mit einem Satz oder einem Stirnrunzeln im Kreise der anderen entzaubert zu werden. Lesen auf eigene Faust, das weiß Hiero, wird von einem Studenten nicht erwartet. Er soll Kenntnis zeigen, nicht Kenntnisse – Kenntnis der Texte, die als Seminartexte im Umlauf sind oder – so etwas zeichnet den guten Mann aus – für eines der kommenden Semester erwogen werden. Im Grunde also eine öde Paukerei, bei der die richtige Adressierung rasch zur Hauptsache wird. Beispiel Wittgenstein: ein abseitiger Denker und Homo melancholicus, dessen immer wieder die Grenze zum Skurrilen überschreitende Hinterlassenschaft von mächtigen Cliquen ins Zentrum der akademischen Aufmerksamkeit geschoben wurde. Im Seminarbetrieb zirkulieren zwei Wittgenstein – wehe dem schwachköpfigen Studenten, der bei Kärich, der sich in versöhnlicheren Momenten durchaus mit dem Tractatus abfinden kann, eine intimere Kenntnis der Philosophischen Untersuchungen verrät –
Da stehen sie nebeneinander, Kärich und Anton, jeder ein Flasche Bier in der Hand, und prosten sich zu. Kärich stellt seine Flasche ab, beginnt sich zu kratzen, hier, da, dort, das kann dauern, Anton redet, Hiero versteht kein Wort, aber Kärich scheint zuzuhören, hin und wieder wirft er einen Brocken ein. Pw und Eike traktieren die Platte, immer schön um die abgestellte Flasche herum. Sie üben Schnibbeln, manchmal knallt ein Ball unvermittelt ins Netz, man fragt sich, welche Kraft hinter den Plänkeleien steckt und warum. Kärich, abwesenden Blicks, langt nach der Flasche, zieht sich mit Anton ins entfernte Ecke zurück, halb unter das Kellerfenster, hinter dem man hin und wieder ein paar Hosenbeine vorbeiwandern sieht. Gern würde Hiero jetzt wissen, worüber die beiden sprechen, vielleicht erfährt er’s ja später. Gespräche mit Dozenten werden im Kreis haarklein, Wort für Wort, weiter erzählt.
Und sie kehren zurück. Jeder in seine Gedanken verloren, wie Facharbeiter, die nach einer betrieblichen Störung wieder ihre Plätze einnehmen. Pw und Eike, eben noch im Besitz des Balls, sehen sich rüde verdrängt, verdrücken sich, Eike lässt seinen Schläger auf der Platte zurück.
Aufschlag, Aus.
- ―Bremer, Sie sind ein Schwachkopf, tönt es aus Kärichs Ecke.
- ―Fragt sich, woher einer das weiß, kontert Anton gelassen. Sie spielen, so scheint es, um Buchstaben. B or K, that is the question. Ein schönes Spiel, kurz und hastig vom einen, mit wuchtigen Schmetterbällen vom anderen geführt, keiner reizt die Lage aus, stattdessen parlieren sie, wie es die Situation zulässt.
- ―Ich hab mit Adorno so meine Schwierigkeiten. Wenn er zum Beispiel behauptet, Kierkegaard...
- ―Mit Teddy haben alle Schwierigkeiten. Wundert Sie das? Verzeihung, dann sind Sie naiv. Die Frage ist doch, ob der überhaupt eine Zeile Kierkegaard gelesen hat. Unbeantwortbar, un-be-antwortbar. Leider, wenn Sie mich fragen, denn ich sage: nein. Vielleicht das Tagebuch. Adorno ist ein Versucher, die Affinitäten wird er gesehen haben. Aber das wars dann...
- ―Also - Antons Stimme flattert, er hat das Ohr des Schließers gefunden (er also auch!) – schräg fand ich ja zum Beispiel den Satz im Kierkegaard-Buch, die Wahrheit nehme die steigenden Säfte der Dialektik nicht auf, sondern werde ›endlich‹ – der Finger geht hoch, um das nun wirklich etwas merkwürdige, um nicht zu sagen komische Zitat anzuzeigen, was Kärich hastig zu einem Schlag ins rechte Eck ausnützt – dem ziellosen Wachsen des Baumes ›zugebilligt‹. Das habe ich auch, ehrlich gesagt, nicht ganz verstanden.
- ―Das versteht man auch nicht, das weiß man. Genesis drei-sieben. Da haben Sie Ihren Versucher. Mehr? ›Zugebilligt‹, enormes Wortspiel! Jetzt Teddy. Gehen Sie zum – plopp – Discounter, sehen Sie sich an, wie die Hausfrauen unter dem Gedudel dieser unsäglichen Popscheiße an den vollgestopften Regalen vorbeidefilieren und – plopp – ihre Einkaufswagen mit konzentriertem Müll füllen. Die wissen, was sie wollen. Bescheidwissen, das-ist-Bescheidwissen. Da haben Sie den-Geschmack-der-Wahrheit. Aber – Kärich hechtet – diese Wahrheit schmeckt-nach-nichts. Jedenfalls meint das Kierkegaard. – Plopp.
- ―Meint Adorno. – Plopp.
- ―Wer das wüsste. Geschmacklos, mein Herr – Aufschlag, geschickt serviert –, geschmacklos, da ist was dran. Teddy ist ein Stümper. ›Zielloses Wachsen‹, absurd. Der Mann hatte keine Ahnung. Keine Ahnung.
Er tänzelt.
- ―Naja, lassen wir dem Teddy seine Eier.
Der Konter rollt.
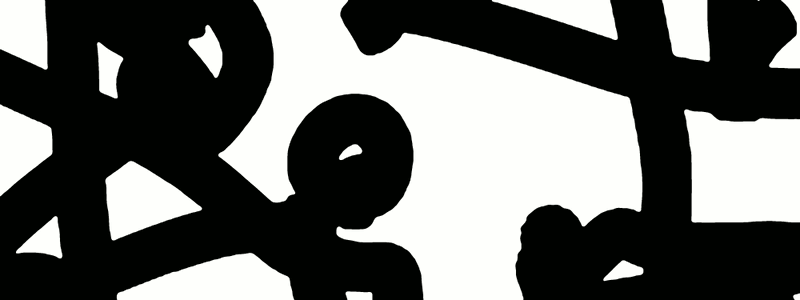
Systemfragen
Was Kärich sagt, ist nicht leicht zu ergründen. Er redet den ganzen Tag, er redet in seinen Seminaren, er redet in Dasslers Seminaren, die er als Assistent pflichtschuldigst betreut, er redet vor ihnen, er redet nach ihnen, manchmal sieht man ihn noch eine Stunde später neben dem Tisch in der ersten Reihe gestikulieren, wenn man sich im Raum geirrt hat, und abends, im Goldenen Pfau, redet er sowieso. Er ist ein guter Lehrer, er kann die schwierigsten Texte erklären, seine Rede lässt keinen Proseminaristen verhungern, die Einführung in philosophische Problemlagen ist seine Stärke. Das unterscheidet ihn vom restlichen Mittelbau, der teils in öder Das-lassen-wir-jetzt-dahingestellt-sein-Manier oder aus der rhetorischen Übertrumpfung der Originale seine Festigkeit gewinnt. Die wenigen Studentinnen, die sich ins Fach verirren, haben auffallend viele Probleme, deren verbale Lösung sie ihm überlassen, er macht das gut. Er redet, doch was er sagt, bleibt umwölkt, es lispelt kaum hörbar zwischen den markigen Urteilen, mit denen er seine Herkunft aus wissenschaftlich begütertem Haus in Szene setzt, sein philosophisches ›In-Sein‹. Er ist der Torwächter zwischen Drinnen und Draußen. Als solchen benützt ihn Dassler – gemacht hat ihn dazu ein anderer. Denen, die das Tor passieren dürfen, schreibt er sich durch Gesten ins Gedächtnis, die, wie die zeremonielle Versenkung des Seminarexemplars der Hegelschen Logik, ein wenig gaga sind, aber eben nur ein wenig. Sie wirken durch die kleine Überschreitung der seminariellen Bräuche, der aber keine große folgt, sondern, im Gegenteil, die große Bravheit, also durch Leiden. Dieses Leiden hat ihm peu à peu die gerötete Nase zugeschanzt, die wie ein Scherzartikel die Mitte seines Gesichts bedeckt. Inwieweit die Hampelei zu den Wirkungen oder Ursachen des gut behüteten Desasters zählt, ist nicht zu ergründen. Vielleicht doch, denn wenn Pinocchio durch Pfützen rennt und ihm ein Bein entzweibricht, dann zeigt sich zwar, aus welchem Holz er geschnitzt ist, aber das Hölzerne seiner Wesensart liegt dem, was sich da zeigt, bereits voraus: Birne oder Apfel, das bleibt sich gleich, es ist, wie Kärich es ausdrücken würde, vollkommen irrelevant, Betonung auf ›irre‹, nicht zu knapp. Im übrigen gehört er zum Apfel-Typus, er ist einer von der Sorte, die nicht weit vom Stamm fällt, dort aber nicht liegen bleibt, sondern eingesteckt und unterwegs von einem größeren Appetit einverleibt wird. Was zurückbleibt, ist der Grips – so nennt man das wohl, denkt Hiero, hihi –, der nicht genossen, sondern entsorgt werden will – ent- oder versorgt, das kommt in akademischen Breiten fast auf dasselbe hinaus, fast, denn ein kleiner mörderischer Unterschied bleibt.
Und so ist das Problem, das Kärich, ein Grips in einer Holzfigur, aufwirft, das Versorgungsproblem. Das Problem ist älter als er, er hat es nicht erfunden, er stellt es nur dar, er ist eine Repräsentation. Nicht für das Gros der Studenten, das ahnungslos Seminare besucht, in denen Spinoza und Jerry Lewis es miteinander treiben, anal, wie es sich gehört, recte und verso, ein kostbarer Palimpsest, darüber lässt sich gut schäkern. Wenn sie seinen Bewegungen folgen und den putzigen Wortsalat frisch, wie er den Lippen entfällt, zur häuslichen Weiterverarbeitung in die eilfertig aufgeschlagenen Papierbehältnisse sammeln, dann spiegelt sich in ihren Augen eine andere Stellvertretung. Hiero kennt sie gut, er fühlt Neid aufsteigen, er liest die Bereitschaft in den Blicken der jungen Frauen, die Dinge aufzunehmen, wie sie von dort kommen, so wie er die nämliche Bereitschaft in den Blicken der männlichen Kommilitonen liest. In solchen Momenten verdunkelt sich das dort vorn für ihn fast bis zur Schwärze. Er weiß, der Glanz ist verliehen, der Verleiher hält sich im Hintergrund, bleibt non-figural, aber er hält sich. Wenn dieser, wenn ihr Kärlich geht, wird... der nächste seine Stelle einnehmen, das ist doch klar. Der Verleiher bleibt, was sonst. Nichts weiter, könnte man sagen, dennoch, da ist eine Unklarheit, eine winzige Un-... das Wort kommt nicht, es will nicht kommen, sooft die Zunge es auch herbeischmeckt. Der dort wird es gewesen sein, er wird es bleiben. Er wird gewesen sein. Schwer vorstellbar, dieses zukünftige Gewesensein. Er repräsentiert das System, das ist wahr. Philosophie ist kein Massenfach, die Wandzeitungen dringen selten bis zu ihren Themen vor, aber es wird wohl wahr sein. Er repräsentiert das System. Anton wird nicht müde, darauf hinzuweisen, er bekommt dabei einen bitteren Ausdruck um die Mundwinkel. Hiero registriert es belustigt.
- ―Alle repräsentieren das System, sagt er dann, er sagt es ›philosophisch‹, also im Tonfall der Überlegenheit, so dass der andere, der noch übt, die eigene Rede rasch überschlägt, um zu kontrollieren, ob er sich einen terminologischen Schnitzer erlaubt hat.
Aber Anton lässt nicht locker.
- ―Klar, sagt er, die Ausgebeuteten sind Teil des Systems, sonst könnte es sich nicht reproduzieren. Das weiß doch jeder. Ich habe etwas anderes gemeint. Es gibt die privilegierte und es gibt die unterprivilegierte Seite des Systems. Zum Beispiele finde ich, dass die RAF-Leute zu den Privilegierten gehören –
- ―... und du meinst, die RAF repräsentiert das System? Das ist doch absurd.
- ―Nicht ganz. Außerdem ist das kein Einwand, wenn das System absurd ist.
- ―Ich finde dieses ganze Privilegierten-Gerede problematisch. Wenn ich zum Beispiel mich nehme: klar, ich bin privilegiert, ich bin hoch privilegiert, das ist doch klar, das steht außer Frage. Warum? Weil ich der Sohn meines Vaters bin. Meine Verwandten hat man umgebracht, aber ich habe diesen Vater, dafür kann ich nichts, warum sollte ich. Er hat dafür gesorgt, dass ich diese Ausbildung machen kann, ohne zu arbeiten. Soll ich mir deswegen einen Kopf machen? Entschuldige, Eike…
Zwei Privilegierte, Kopf über Hals, lächeln sich an -:
- ―Klar bin ich privilegiert. Die Ungeborenen, also die... – er sucht ein wenig – die gar nicht die Chance hatten, privilegiert oder unterprivilegiert zu sein, weil man sie vor ihrer Geburt, nein, vor ihrer ... Konzeption...
- ―Zeugung?
- ―... Zeugung umgebracht hat, sind die auch ein Teil des Systems? Irgendwie schon...
- ―Das wollte ich gerade sagen, irgendwie schon, jedenfalls, soweit das System sie umgebracht hat –
- ―Das System hat sie aber nicht umgebracht, das waren Menschen. Menschen wie du und ich, nein, nicht wie du und ich, das lassen wir mal außen vor. Es spielt auch keine Rolle. Worauf es ankommt: Sind sie nun Teil des Systems oder nicht? Aber es gibt sie doch gar nicht. Kann jemand, den es nicht gibt, Teil eines Systems sein?
- ―Hm, vielleicht sollten wir das mal Kärich fragen.
- ―Ich kann dir sagen, was der darauf antworten wird.
- ―Das wäre?
- ―Das, was er immer sagt.
- ―Da muss ich wohl gerade gepennt haben. Was sagt er denn immer?
- ―Das weiß ich auch nicht so genau, aber es läuft darauf hinaus, dass die RAF-Typen das System gar nicht bekämpfen. Sie bekämpfen sich selbst.
- ―Das verstehe ich nicht. Was haben denn die RAF-Typen mit den Ungeborenen zu tun?
- ―Eben. Eben. Nichts, gar nichts. Sie existieren! Sie sind da, verstehst du, und die anderen sind nicht da. Wer nicht da ist, kann auch nichts in Frage stellen. Man kann das System in Frage stellen, aber man kann es nicht bekämpfen. Es sei denn, man hat ein anderes, das ist eine andere Sache. Aber wenn du nicht da bist, gibt es kein System. Du bist einfach nicht da.
Anton ratlos.
- ―Das verstehe ich. Ja und?
- ―Kein Und. Wer nicht da ist, kann das System nicht bekämpfen. Er ist Teil des Systems.
- ―Aber das ist doch beliebig.
- ―Klar ist das beliebig. Das gilt für jedes System.
- ―Also gehören die RAF-Typen jetzt zum System oder nicht?
- ―Klar gehören sie dazu. Natürlich gehören sie zum System. Außerdem sind es Mörderschweine. Schon deshalb repräsentieren sie auch das System.
Kärich, das weiß Hiero, hätte diesen Dialog anders konzipiert. Er hätte auf die Wurzeln des modernen Terrorismus im neunzehnten Jahrhundert hingewiesen, auf Turgenjew, Dostojewski sowieso, und dann wäre er zur Sache gekommen. Die Dialektik der Aufklärung beruhe auf einer grotesken Verwechslung von Denken und Sein – ›die übrigens schon bei Herder zu beobachten ist, ausgiebig von Kant kritisiert, aber daran denkt natürlich keiner‹ –, nur zu verstehen, wenn man die ›völlige Ahnungslosigkeit‹ der beiden Herren – Horkheimer und Adorno – im Hinblick auf die Anfangsgründe der Dialektik in Rechnung stellt:
- ―Ich sage völlige Ahnungslosigkeit, durch nichts zu rechtfertigen, hätten die beiden lesen können, dann hätte der Anfang der Hegelschen Logik ihnen ein Licht aufstecken müssen.
Dieser berühmte Anfang bildet die geheimnisvolle Schwelle, über die hinweg man ins Allerheiligste gelangt. Dassler bestreitet seine halbe Vorlesung mit einer ausgiebigen Analyse der Einleitung. Auch kursiert ein viel bewunderter Aufsatz von ihm über diesen heiklen Gegenstand. Zu seinem unausgesprochen bleibenden Leidwesen findet Hiero ihn noch dunkler als die zu interpretierenden Sätze. Es fällt unter Kärichs Haupt- und Staats-Obliegenheiten, die Sätze des Meisters nachzuarbeiten, ihnen eine Form und einen Schliff zu geben, die geeignet sind, sie in Kopf und Gemüt der Studenten einzusenken, während sie das Hauptseminar absolvieren. Zugegeben, keiner kann das so schön wie er. Aber verstanden, verstanden hat das alles noch keiner, auch wenn die Nachrichten seitens derer, die mit dem Thema ins Examen gingen, eher beruhigend sind. Die Schwelle ist immer da, sie ist im Bewusstsein, sie ist es, die dieses Seminar auszeichnet, es zu einem der, laut Kärich, drei, fünf Orte auf diesem Globus macht, an denen überhaupt ein Bewusstsein der Probleme existiert, um die es in der Philosophie wirklich geht. Irgendwann, davon ist Hiero fest überzeugt, hat man sie passiert und befindet sich auf der anderen Seite. Wann das sein wird? Das Studium treibt seinem Ende zu, das Rauschen der großen Fälle verstärkt sich, dort, im – fast – freien Fall, im Paradies der Gehörlosen, wird es sich vollziehen. Besser wäre allerdings, man wüsste bereits Bescheid und steuerte im festen Bewusstsein, die Sache ein für alle Mal begriffen zu haben, auf diese entscheidende Lebensetappe zu. Aber hat nicht Dassler selbst den Ausweg verbaut mit dem Satz, den sich der für die anderen praktisch unsichtbare Club der ›guten Männer‹ mit spöttisch verzogenen Mundwinkeln gegenseitig zuraunt, sooft sich eine Gelegenheit ergibt: dass die Philosophen noch gar nicht begriffen haben, wie ihre klassischen Texte zu lesen wären? Das ist schon starker Tobak, der Satz tut seine Wirkung. Er brennt in ihnen allen, das muss man Dassler lassen.
Kärich schweigt zu diesem Satz. Nicht dass er keine Meinung hätte, aber er schweigt. Sein Schweigen macht ihn zum Sachwalter all dessen, was der Satz in den Köpfen der jungen Menschen anrichtet. Dabei ist es ein Un-Satz, ein Stück aus dem Tollhaus, der reine Blödsinn.
- ―Wie will er das denn entscheiden? hatte Anton, aufgebracht wie selten, in die Runde gehaspelt, als zum ersten Mal davon die Rede war. Er kam aus einer Vorlesung, in der die philosophischen Welten Dasslers reihenweise versanken wie einst, jedenfalls nach herkömmlicher Auffassung, die Truppen des Varus in Teutoburgs Sümpfen, er hatte sich sogar in die Schlange gestellt, die den etwas erschöpften, aber unendlich freundlichen und geduldigen Dozenten am Ende seiner Vorstellung erfolgreich davon abhielt, schnell in die gastronomischen Weiten zu enteilen. Der neue Professor trug ein hellgraues Rollkragenhemd zum crémefarbenen Sakko, er trug auch einen Namen, der aber in der Folgezeit nicht recht in Gebrauch kommen sollte. Während sein Ruhm dank gewisser bunt eingeschlagener Bändchen in der Welt der Denker und Gelehrten unaufhaltsam wuchs, weigerten sich die Studenten vor Ort beharrlich, ihn anders zu nennen als Tilo den Gerechten – ein schlagendes Beispiel jugendlicher Blindheit und Anfälligkeit für Infektionen aller Art, aber auch heiter erteilter Anerkennung dafür, dass er ihnen eine Möglichkeit bot, sich vorsichtig vom Theater der Hochstufigkeiten zurückzuziehen, dem Dassler und sein Kollege Leckebusch vorstanden, ohne das Studium abzubrechen oder an einem anderen Ort fortzusetzen.
Auch dazu schweigt Kärich. Doch dieses Schweigen macht ihn angreifbar, es offenbart seine Schwäche. Er kann das Wort nicht aussprechen, das seit Tilos Ankunft in den Debattierzirkeln die Runde macht: ›Sprachanalyse‹. Allenfalls lässt er sich einmal zu einem geknurrten ›Philosophie ist Sprachanalyse‹ hinreißen, vermutlich reut es ihn dann zu Hause vor dem Spiegel, wenn er sich sorgsam die Krawatte des Tages umlegt, schmal, rostrot, gestreift oder gepunktet, und dabei die Reihe der abzusondernden Sätze mit sich durchgeht, die Sache ist zu sehr anglo-saxon, als dass er ihr Vorschub leisten darf. Sein Wächter-Amt lässt das nicht zu.
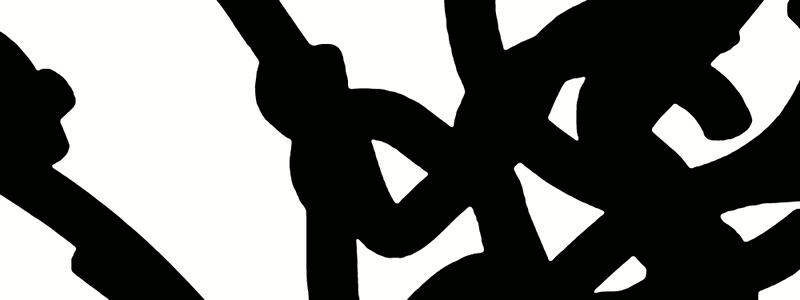
Freiwillig nie
Wie jedes System besaß auch dieses hier seinen Feind. Er wälzte sich nicht in Gestalt erregter Massen über Boulevards, er schrie nicht in Megaphone, er skandierte kein ›Ho-ho-ho-Tschi-Minh‹, er kam nicht von links, er kam nicht einmal auf leisen Sohlen, er kam überhaupt nicht, man hätte annehmen können, es gebe ihn nicht. Bei Kattusch stand er gleich neben dem Eingang links in dem Regal, aus dem man sich mit beweglichem Zeigefinger vorab über die philosophischen Neuerscheinungen informierte, die gerade irgendwo Seminarstoff wurden.
- ―Ich geh noch mal bei Kattusch vorbei, kommst du mit?
So lautete eine der Parolen, die, meist von Pw, gegen Ende der Zigarettenpausen, mit denen sich das Mensa-Essen in wohlverdiente Vergessenheit brachte, in die Runde getragen wurden. Dann zerstreute sich das Grüppchen und einer ging mit, einer ging immer mit. Heute ist es Anton, Hiero sieht ihnen zerstreut nach. Eigentlich schmökert er ganz gern nach dem Essen, aber er hat Besseres vor. Auch lässt ihn ein ziehendes Gefühl Abstand nehmen. Es sind nur wenige Bücher, die ihm einen Besuch in der Buchhandlung lohnend erscheinen lassen, das unterscheidet ihn von Anton oder Pw, die mit leisen, knappen Worten den letzten Tratsch über die gerade aktuellen Autoren austauschen – eine Bemerkung aus einer Rezension, ein Fernsehauftritt, den er verpasst hat, eine professorale Geste –, während sie ein Buch nach dem anderen aus dem Regal holen, mit dieser quasi liebevollen Geste, die erst nur die Oberkante des Rückens berührt, es dann wie eine flügellahme Taube streichelt und schließlich öffnet, um nachzusehen, welche Verletzung sie unter dem Gefieder birgt. Hiero hingegen zögert lange, bevor er einen Titel aus der Reihe hervorzieht – er muss wirklich ziehen, die Erfahrung hat ihn gelehrt, dass es besser ist, die nächststehenden Bände mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand festzuhalten, damit sie bei dieser Operation nicht zu Boden fallen –, sobald er ihn aufgeschlagen hat, ist er bei der Sache, er kann es nicht anders ausdrücken, er wird wohl ein intensiver Leser sein. Pw weiß das, vielleicht spielt ein wenig Neid mit, er nützt die Situation vorsichtig aus, raunt ihm hier und da einen Kommentar zu, der seine Lektüre unterbricht und verwirrt. Ehe er nachfragen kann, zeigt sich Pw bereits in das nächste Buch vertieft und wehrt, kaum dass Hiero sich räuspert, mit leichter Handbewegung ab – das geht so, bis Hiero, zwischen dem Buch in der Hand und Pws erwartetem Kommentar hin- und hergerissen, den Augenblick herbeiwünscht, in dem sie den Ort so verwirrender Genüsse endlich verlassen. Er könnte auch allein von dannen ziehen, aber das enthielte das Eingeständnis einer Niederlage und Pw würde nicht anstehen, bei der ersten Gelegenheit subtile Schadenfreude zu üben, etwa durch eine ausgiebige Befragung mit dem Ziel, den durch seinen Abgang entstandenen Leerlauf beziehungsweise die entgangenen Freuden eines gemeinsam verbrachten Nachmittags aufzudecken, an die er, Hiero, einfach nicht gedacht hat. Pw, darin besteht die Botschaft solcher kleinen Exzesse, ist ihm beträchtlich überlegen, wenn es darum geht, zwischenmenschlich zu kommunizieren, übrigens nicht nur ihm, den anderen genauso, er zieht sie alle wie der Rattenfänger hinter sich her.
Der Feind, auch dieser, besitzt ein Doppelgesicht. Die bunten Schutzumschläge bei Kattusch, in die er sich hüllt, als gehöre er einfach dazu, tragen Titel wie Der Begriff des Geistes, nichts besonders Aufregendes also, schon gar nichts, was einen gegen ihren Inhalt misstrauisch machen könnte, eher fallen sie durch eine lehrhafte Biederkeit auf, die bereits wieder stutzig macht. Am Schwarzen Brett des Instituts, dort, wo die frischgebackenen Privatdozenten und allerlei Lehrpersonen unklaren Status ihre Veranstaltungen ankündigen, steht, gleich neben dem noch elementareren Language, Truth and Logic und als beinhalte es einen Fortschritt, The Concept of Mind. Auch Theorien besitzen, wie das Denken allgemein, einen Körper, einen Sprachleib, sie führen, meist in Klammern, manchmal nur durch ein Komma abgesetzt, Jahreszahlen mit sich, Erscheinungsdaten, die den Eindruck erwecken könnten – und vermutlich auch sollen –, diese vom Seminarschweiß der Jahrtausende rund geschmirgelten Dinge seien endlich – endlich! – entdeckt oder erfunden worden: das schmeckt ein wenig nach Aggression oder zumindest Unbotmäßigkeit, ein guter Mann sollte es sich zweimal überlegen, ob und wie weit er sich darauf einlässt. Reine Doxographie! Unbegreifliche Rückfälle in die ältesten Irrtümer und Entgleisungen des Denkens! Daneben, ungreifbar, regt sich in und hinter den mit Fleiß und Ausdauer betriebenen Zahlen-, respektive Namenspielen die Botschaft, ›draußen‹, in den zivilisierten Ländern, sei der orbis philosophicus, der philosophische Weltkreis, just in jenen finsteren Zeiten neu entworfen und kartographiert worden, in denen die verschwiegenen und offenen Väter des Instituts in unbegreiflichem – oder leider nur zu begreiflichem – Hochmut das eigene, an allen möglichen Ecken nach Gesichtspunkten politischer Opportunität begradigte kulturelle Erbe für die Sache selbst hielten. Die Sache selbst: zum Teufel damit. Wessen Sache? Die Sache der Nazis? Die Sache der Philosophie? Die Sache des Denkens, was immer das sei? Eine üble Sache, Hiero weiß sich in keine andere Formel zu retten. Aber auch er weiß, dass die Tage der allmächtigen Hermeneutik, der geschmeidigen Wiedergewinnung der Texte nach dem politisch-moralischen Fiasko gezählt sind und rechnet sich unter ihre erbitterten Feinde. Die Sache des Denkens ist auch die seine, die Philosophie ist sein Spiel, er weiß es, seit er die Schwelle dieses Instituts überschritten hat, aus ihr will er mit den Füßen voran hinausgetragen werden, freiwillig nie.
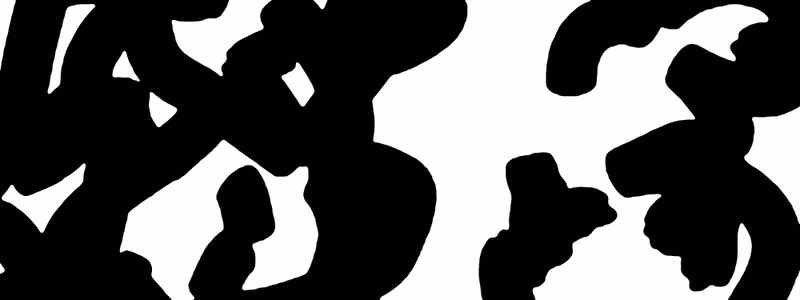
Hiero staunt
Hiero geht. Geht langsam, langsam die Krämergasse hinauf, überquert die Hauptstraße, trottet versunken die Mandelgasse entlang, lässt die Universitätsbibliothek links liegen, nimmt ein paar Stufen, wartet einen Moment, bis sich eine Lücke zwischen den Autos zeigt, geht weiter. Das Steigen liegt ihm nicht, zu Hause bleibt das Gelände flach, egal, was man vorhat. Nur ein paar Meter und er hat, was er braucht. Abwärts fällt der Weg leichter. Der Gefängnisbau, eine Festung, könnte als Touristenattraktion durchgehen. Abschreckend wirkt der Stacheldraht. Zwei junge Frauen rufen zu einem vergitterten Fenster hinauf, er versteht kein Wort, was nicht wichtig ist, da ihn die Sache nichts angeht, nicht existentiell. Lass dich nicht aufhalten. Er schwenkt in die Gontscharowgasse ein – Iwan *, 1812-91, russ. Schriftsteller, so etwas weiß man doch –, wirft, ohne den Schritt zu verlangsamen, einen Blick auf das Kinoprogramm: läppisch. Vor der Jesuitenkirche macht er kurz halt und lockert den Kragen. Die Finger zittern, er kann das nicht unterdrücken. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Feuchtschwanger. Da schmiert einem schnell der Kreislauf ab. Anton treibt Sport. Abschreckend auch das.
So sieht es aus.
Warum bist du aus Tübingen weggegangen, Hiero? Keine Ahnung? War nicht dein Ding, was? Unklares Denken, so nennt man das wohl. Du bist weggegangen, weil du deine Rolle nicht gefunden hast. Gern würdest du ausspucken, wenn du an diese Zeit denkst, allein schon, um den Geschmack loszuwerden. Unbegreiflicherweise bleibt die Mundhöhle trocken. Die Faust im Sack erspart die Revolte. Warst immerhin nahe dran, solange du auf die Penne gingst. Als du einsteigen wolltest, war schon alles vorbei. Ein Jahr früher oder später, so etwas kann über ein Leben entscheiden. Keine Sit-ins mehr auf den Stufen der Stiftskirche, keine Manöverkritik beim alten Bartosz, dem Utopie-Bartosz, dem Pfahl im Fleisch des kapitalistischen Jetzt, keine Soli-dari-tät, auch kein Spießergepöbel (fast!), Pisswetter stattdessen, das Pisswetter des Südens, ohne Abzug. Zum Teufel mit dem Geschmack.
So sieht es aus.
Da, die Hauptstraße: ist real. Da, die Straßenbahn: ist real. Soll zwar abgeschafft werden, aber: ist real. Bartosz hingegen, hübsch untergefasst, von zwei engelgleichen Assistentinnen fast hereingetragen, Blondinen natürlich, den Riesenschädel flach auf die kläglichen Schultern gelegt, als sei er das, möglicherweise verkehrt herum, wieder aufgesetzte Haupt des Johannes: ist irreal. Der Anblick ließe einen minderen Geist irre werden, doch in der Sache ist Zweifel nicht möglich. Und der Beifall rauscht. Rauscht auf, was sonst. Man möchte ihn, leicht übertrieben, ›tosend‹ nennen, immerhin setzt er sich gleichgültig über die Usancen hinweg. Herrgott, das sind doch alles keine Studenten. Ja wo sind wir denn? Audienz bei Bartosz. Audienz, Gaudienz. Homo gaudiens lupus. Der alte, sorgsam enthörnte Bartosz hat keine Hörer, sein von überallher zusammengeströmtes Publikum besitzt Kamera-Augen, er hat – das muss einmal gesagt werden: heraus! – Zuschauer. Manche sind darunter, die kommen, wie die Wörter, die sie sich zuflüstern, aus der Ferne, man kann sie an ihren Nummernschildern erkennen, nicht hier natürlich, sondern draußen vor der Tür, denn das bessere Selbst, verpackt in hochglänzendes Blech, sie lassen es draußen. Vorsichtshalber. Hier, im trübe erleuchteten Seminarraum, sind sie unverkennbar: Voyeure. Nobodies. Lammrücken, fein filetiert, einer hinter dem andern. Das ist kein Seminar. Das ist Klamauk.
So sieht es aus.
Nimm dich in acht, Hiero, keiner kann dir das abnehmen. Sei gewitzt. Eigentlich müsstest du jetzt abbiegen, wolltest du, wie versprochen, noch kurz bei Anton vorbeisehen. Zum Teufel mit den Versprechungen. Diese Fährte ist heiß, nicht für ein Linsengericht. Hiero, Hiero, vergiss dich nicht. Eine kleine Normenkontrolle und du fliegst raus. Halt dich fest, es geht in die Kurve. Tut uns leid, Freunde, heute nicht. Es passt nicht. Schauen Sie doch ein andermal. In die Augen, du Penner. In die Augen. Penner. Haben wieder ganze Arbeit geleistet, die Straße stinkt, jeden Morgen kommen sie aus der Mercatorstraße herauf, um im Durchgang zwischen den engen Hauswänden ihr Wasser abzuschlagen. Übel, übel. Der Gedanke treibt weiter, da züngelt auch schon der Brechreiz. Du willst dich doch nicht übergeben, Hiero, auf offener Straße? Das darf nicht dein Ernst sein. Einen anderen hast du nicht, also lass es. Kümmer dich nicht um diese Dinge, dafür sind andere zuständig. Oder auch nicht. Oder auch nicht! Klickts? Diese Ausdrücke, wie einem das zufließt. Oder ab, je nach Einstellung. Also: du konzentrierst dich auf das Nächstliegende, ohne Scherz, du kannst das. Ein Halteseil, primitiv, aber funktioniert. Der Schlachter hier links, gut, leider zu teuer. Ein paar Scheiben Aufschnitt wären nicht schlecht, im Kühlschrank gähnt die Leere. Zum Teufel mit dem Schlachter. Das geht jetzt nicht.
So sieht es aus.
Lotrecht sitzt Bartosz der Tote auf seinem Pult, jemand hat die Gebrechlichkeit weggepustet, stramm wirkt er, besser: kon-zen-triert. Greis, -tschuldigung, Kreis inmitten von Kreisen. Er hebt das Haupt, schwenkt es, zieht an der Pfeife, murmelt, ein paar Wörter links, ein paar Wörter rechts, in bereitwillig hingehaltene Ohren, daran kleben, sonderbar, Köpfe, echt aussehende Köpfe auf Hälsen und Rümpfen, Köpfe mit Armen und Fingernägeln, darunter einige abgenagte. Dem Betrachtenden wird alles merkwürdig. Der Betrachter ist tot, es lebe die Betrachtung. Die Revolution, ei Schreck, die Gute ist wieder vertagt. Die Tage sind einfach zu kurz für sie. Meine Tage sind nicht deine Tage, aber sie ähneln ihnen wie ein Ei dem anderen. Eine Parade von Weicheiern. Woher nehmen, wenn nicht stehlen. Sag mir, wo die Fliegen sind. Der längste Tag ist bekanntlich der kürzeste. Das, lieber Ba, weiß man längst, nur Ihro Trostlosigkeit... Babatosch, feins Männlein, fein heraus, wie immer baba, klappert im Fut... Dies irae, dies irre. Ach.
Du hast jetzt andere Sorgen. Der Vermieter muss einen Schlüssel nachfertigen lassen, der hier hakt im Schloss. Das Gespräch ist überfällig, aber nicht jetzt. Um Gottes willen nicht jetzt. Mit einer seiner jovialen Anwandlungen hast du ihn die nächsten zwei Stunden am Hals. Hat er schlechte Laune, kannst du dir morgen ’ne neue Bude besorgen. Lästig wäre das, sehr lästig. Besser, man geht ihm aus dem Weg. Harald, so hört man, hat einen Roman über seinen Vermieter geschrieben, kein Verlag will ihn drucken. Das hätten wir ihm gleich sagen können. Wer druckt denn sowas, das ist doch lächerlich. Und wenn schon. An der Kritik kommt keiner vorbei. Fallbeil, ab ins Körbchen. Überhaupt diese Romanschreiberei. Eike redet auch daher, als habe er ein halbfertiges Manuskript in der Schublade, sicher nicht über seinen Vermieter, trotzdem glaubst du kein Wort.
So sieht es aus.
Bartosz ist weg, wie weggepustet, auch der Seminarraum ist weggepustet, stattdessen, Hiero, reiß dich zusammen, dieses enorme Sit-in, Titten links, Titten rechts, ein Strudel! Die Stimmung ist gut, wüsstest du, worums geht, du fühltest dich prächtig unterhalten. Nun, das lässt sich leicht eruieren, du fragst einfach die Blonde hier links, die so freudig kichert, perverse Zicke, ihr Blick geht über dich weg, als wärst du der Nix. Dein Informationswunsch, er flutscht ins Leere. Verdammt. Stört dich was, Hiero? Dann geh doch... zum Klassenfeind. He. Quält dich was, Hiero? Aber nicht doch. Das Manneken-Pis da im Kopf, das kennen wir alle. Was denn sonst. Alle Erziehung ist Scheiße. Du machst dich jetzt leicht, schön schön, du bist dran, du schaffst es, aber sicher, naja, nicht ganz, nur... im Ansatz. Da ist doch was. Daran kann man arbeiten. Viva. Maria. Nur in der Ausführung sind dir die anderen über. Erinnere dich an den Kerl, den sie an der Hauswand umlegen. Die Parole an der Wand: er nimmt sie mit. Einfach mit. Ins Grab. In die Ewigkeit, was? Könnte denen so passen. Auf dem Kopfsteinpflaster scheppern die Flaschen. An die hast du also gedacht, sieh an, sieh einer an. Weiter, weiter. Was gibts denn da zu glotzen, gehen Sie weiter. Weiter da. Mein Gott, gehen Sie! Rührt euch... doch!
Wie gerührt muss einer sein, dem die einfachsten Dinge auffällig werden? Der Schlüssel, das enorme Ding, beult dir die Tasche, hast du nie drauf geachtet? Warum? Warum achtet man nicht auf solche Dinge? Unter uns: warum achten? Was hat die Acht damit zu tun? Alle neune: ginge doch auch. Sei nicht albern, Hiero, sei nicht albern. Das fehlte noch. Sei ein guter Junge, reiß dich zusammen. Schau schau: die Schrift an der Wand. In einem Zug hingesaut, sauber, sauber. Gerade hier? Da wird sich der Spießer wohl einen ablutschen. Scheißparole. Egal. Und der Schlüssel klemmt. Es kemmt aber drauf an, ihn hineinzuzwingen. Das ist leichter gesagt als. Glotz nicht, du Affe. Die Tür steht offen, man muss nur hineingehen. Man muss nur hineingehen. Ein prächtiges Verlies, das du dir da ausgesucht hast, Ausguck zur Laube, sonntags mit Familienprogramm. Wenn das mal gut geht. Auf der Kochplatte steht der Erbseneintopf von gestern, am besten, du öffnest das Fenster gleich. Du darfst nur nicht vergessen, es wieder zu schließen. The Doors, kalt wie Erbsen, runter vom Teller. John McLaughlin, aahhh. Inner Mounting Flame. Das wird es bringen. Legs auf.
Die Seele ist ein Stück Scheiße, merde, das kann man so sagen oder auch nicht, wie praktisch alles, was man so sagt. Der Druck hinterm Sagen ist ungeheuer. Bartosz hat recht, Schwachsinn, die Materie lebt, aber muss man sie deshalb gleich einen Feuertopf nennen? Das ist Spökes. Du kannst, was denkt, nicht reduzieren. Nicht auf das, was nicht denkt. Simpel. Auf was denn? Die Synapsen denken, soso, das könnte ihnen so passen. Wenn man jetzt ein bisschen Stoff zuführt, THC zum Beispiel, dann denken sie mehr, eindeutig mehr, falls man das als Denken bezeichnen kann. Sagen wir, es passiert was: etwas passiert, kein Zweifel, und es passiert im Bewusstsein. Das ist verrückt, Hiero, es passiert im Bewusstsein. Das muss einer erstmal denken können. Systematisch denken, keine dahergerotzten Erklärungen. Keine Erklärungen! Wer erklärt, der lügt. Erklär mir Liebe. Auch das noch. Dafür gibts LSD, besser nicht, die Frauen bringen den Stoff gleich mit, das ist wenigstens praktisch. Aber soll man das Denken nennen? Irgendwie schon, sonst wäre das Heidegger. Übel, übel. Ja was denn? Ein Veitstanz wie der, den die Plattennadel über den Rillen aufführt – keiner sieht hin und er ist doch real.
So sieht es aus.
Ja wie denn sonst? Verbeugung vor dem Idealismus? Grotesk. John die Gitarre. When feel the fever, why not believe? Seltsames Schmuddel-Englisch, doch die Botschaft kommt rüber, ein Heuler, haut rein wie bei irgendeiner hirnrissigen Margarine-Werbung. Dick auftragen, auch eine Botschaft, ja doch. Der ganze Schubidu, oh yeah, ist schließlich nichts als... sagen wir: eine milde Form von LSD-Rausch. Sonst nichts. Eine sehr milde, andere scheinen das intensiver zu empfinden, durch eine kleine Zugabe lässt es sich steigern. Das hält die Kacke am Dampfen.
Dieser elende Harndrang. Schade.
- ―Wo, bitte, gehts hier zum Sozialismus?
- ―Übernächste Kreuzung links, Abbiegen nicht vergessen.
- ―Dämlicher Witz.
- ―Fick dich.
- ―Rechtzeitig abbiegen, habe ich gesagt, recht-zeitig, du Trottel. Pass doch auf.
- ―Mach dir nicht in die Hose, die lassen dich sowieso nicht durch, so wie du aussiehst. Penner, das mögen die nicht.
- ―Warst du schon drüben?
- ―In Gedanken, nur in Gedanken. He, war schon mal einer drüben?
- ―Schrei nicht so rum, wir sind gleich da. Du machst ja die Vopos scheu.
- ―Das geht nicht. Die bewachen schließlich das Allerheiligste.
- ―Was soll das? Bist du jetzt katholisch geworden oder was?
- ―Schaukel nicht so. Und nimm den Finger aus der Gangschaltung. Du klemmst ihn dir ab.
- ―Was, wenn sie uns nicht reinlassen?
- ―Du bist so dämlich. Wir sind das Volk.
Kalt und herzlos erscheint: die Materie. Unerbittlich. Trägt seltsame steife Uniformen und duldet keine Joints. Niemals. Du brauchst ihr gar nicht damit zu kommen. Kommt auch keiner. Das versteht sich von selbst. Was die Materie dringend braucht, sind Joint ventures. Wissen gegen Ware. Der Wissensdurst der Materie ist sagenhaft, saugt aus jeder Mücke einen Elephanten heraus. Den großen Grauen. Bläst ihn auf, traktiert ihn. Bis er platzt. Ohrenbläser, Tütenbläser, Stromabläser. Windmacher, selber unbeweglich. Wenn sie bekommt, was sie will, taut sie auf, an der Oberfläche, ein bisschen. Die Materie ist kein Feuertopf, hier irrt Bartosz, sie ist ein Eisklotz. Kein Klotz, ein Gebirge unter der Oberfläche, nach unten. Beliefert den Klassenfeind mit billiger Massenware, damit schlägt sie ihn. Nieder. Irgendwann, so gegen Ende, wird abgerechnet. Dann sieht man, was in der Kasse fehlt und wer sich die Taschen vollgestopft hat. Dann gehen allen die Augen auf, verdrehen sich und schließen sich kurz. Augeninfarkt, nichts zu machen. Lass dich nicht anpinkeln, die Stunde der Wahrheit geht vorbei wie jede andere. Das Raum-Zeit-Kontinuum lässt keine Ausbuchtungen zu. Es ist straff. Das verwirrt den Klassenfeind, aber nicht nur ihn. Das Raum-Zeit-Kontinuum ist kein roter Teppich, lässt sich nicht ausrollen nach Belieben, weil Genosse X einfliegt, um Männerbärte zu küssen und Händchen zu schütteln. Das Raum-Zeit-Kontinuum ist keine Auslegware. Was ist es dann? Was dann? Gute Frage, nach dem ›Was tun?‹ Ungelöst bis ins dritte Glied. Oder ins vierte? Wie berechnet man Glieder? Jung sein. Einfach jung sein. Der Rest ergibt sich.
Jugend, ein Lagerfeuerwort. Strammgezogene Hosen. Unsere Jugend, unsere Zukunft. Das könnte euch so passen. Youth: das klingt gleich anders, kompakter, druckvoller, als könne man was davon erwarten, etwas, das dieses Scheiß-Land nicht hergibt, egal, wie lang man es presst. Das war so zu Hippie-Zeiten, kein Jota hat sich geändert. Wenn sie stolz sind, dann aufs korrekte Ti-Äitsch. Als ich ein Knäblein war, ein winzig Knäbelein, au Backe.
Dass gepfleget werde
Der fette Buchstab.
Schmallippiger Kommentar zur Weltlage. So weit, so eins. Könnte glatt als FAZ-Motto durchgehen, Anfragen kostet nichts. Das haben schon andere gemacht. Was werden: womit? Staben kosten nichts. Buchstäblich, unstäblich, wo ist da der Unterschied? Janein?... O Scheiß. Alles kostet, das weiß doch jeder. Kopf und Kragen zum Beispiel. Ein schönes Beispiel geben wir da. Aber das wäre ja nichts Neues. Das wäre ja... normal. Die Normalität. Ein Volk von Verlierern. Schlechte Verlierer, mit Löchern zwischen den Wörtern, nachdem die Löcher im Schuhwerk schon lange verschwunden sind. Reiben sich die Hände: wohnen wieder in Häusern und beliefern den Weltmarkt. Auch die RAF-Leute sind schlechte Verlierer, Schlageter-Typen, können nicht aufhören, lächerlich bis in die Namen hinein, Werwolf-Phantasien, zeitversetzt. Übel, übel. Rüde die Sprache, primitiv die Methoden. Wollen töten – und: dass alle zusehen. Sie wollen die Mitschuld. Nie wieder heimlich! Professionell.
So sieht es aus.
Alle haben sie dich hier nach Bartosz gefragt, einzeln und im Rudel, damals, bevor den Alten der Schlag hinwegraffte. Was du geantwortet hast, es ist dir entglitten, es will einfach nicht mehr parat sein, nichts weißt du mehr, aber das stimmt nicht, so nicht, nicht wirklich, du weiß schon noch, es fehlt nur etwas... Es fehlen die Wörter. Eigentlich fehlen die Wörter. Wer hätte das gedacht? Wer? Seltsame Frage, sehr seltsame Fra-Fla-... Fliege, sehr sehr seltsam. Schon wahr. ›Wahrlich‹, auch so eine Schmeißfliege, ein Brummer, schwer zu vertreiben, beharrlich, man muss ihn totschlagen, aber das nützt nichts, dahinter kommt gleich der zweite. Im Landeanflug, landet aber nicht, kreist auch nicht, er steht in der Luft, nicht wirklich, nicht wirklich, bist du dir sicher? Auch hier sind Räume, großartig, rein klangmäßig, die Synapsen kommen kaum nach, dieses ewige Umstöpseln, unfassbar im Grunde, aber... einfach. Unendlich einfach. Zucken, einfach zucken. Das wirst du doch können. Einfach zucken. Händchen halten, das wäre schon schwieriger, ist aber nicht verlangt. Einfach zucken. Und Schluss.
Die Nummer hatten wir schon. Ein wenig langweilig, das Gitarrensolo... virtuos, würdest du sagen, John die Gitarre, hm, große Klasse, aber schnulzig, die Revolution findet auf anderen Feldern statt, ganz anderen, in der Raumfahrt zum Beispiel, das interessiert zwar keinen, aber es ist die Zukunft. Die Zukunft liegt im Raum. Liegt im Raum. Liegt im Raum. Und keiner geht hin. Wir sind der Kosmos. Das muss sich einer mal klarmachen. In uns: Kosmos. Außer uns: Kosmos. Da wird diese Haut, diese... dies... Jungfernhäutchen namens Ich keine Schwierigkeiten machen, das wäre ja Blödsinn. In the year twenty-five twenty-five, if man is still alive, if woman can survive. Erstes Semester, das war schon aufregend irgendwie, aber: geschenkt. Jeder stirbt anders, blöder Spruch. Jeder Athener ist sterblich, muss einer dazu Athener sein? Das stellt ja das Argument auf den Kopf. Da steht es und hampelt schon mit den Beinen, das kann nicht gut gehen, Absturz, Schlagzeug, finis. Die Jungs können Schluss machen, das muss man ihnen lassen.
Die Revolution findet in der Wirklichkeit statt. Sie hat die gewollte, ersehnte, herbeigeredete, zerquatschte, verblödete Revolution überholt und zerrt sie, ein schlaffes Reptil mit übergestülptem Riesenschädel, dem Magrittes Pfeife zwischen den Kiefern hängt, untergehakt mit sich in die Zukunft – diese immer gleich unberührte, riesige blaue Wand, an der die von irgendeinem im Hinterland gelegenen, gegen die Blicke des Feindes, so gut es geht, abgeschotteten Fliegerhorst aufsteigenden menschlichen Jagdmaschinen jedes Mal aufs Neue zerschellen. Sie platzen, kleine Luftpunkte, aus der Ferne possierlich anzuschauen, man ahnt die zerstreuten Splitter, manchmal findet sie einer auf der grünen Wiese und spielt Seminar. Dann klettert die Stimme des Dozenten ein wenig höher, du merkst, es ist ihm ernst, es berührt seinen Glauben, es ist ein Artikel aus einer Konfession, die er nie zusammenhängend zeigt, da könnte einer ja kommen und auf die Ränder zeigen und fragen, wie es da weiter geht und ob jemand dahinter steht. Das muss verhindert werden, deshalb klettert die Stimme noch ein bisschen, falls jemand aus Versehen und aus purer Unkenntnis dem Rand zu nahe kommt, man hat auch schon wahre Ausraster erlebt, so dass man sich wundert, es hat Unterhaltungswert, ganz sicher, den hat es. Dem hageren Eber verschlägt es vor Aufregung die Sprache, er blubbert nur, wenn die Rede auf Teddys letzte Auftritte kommt, man sieht, was er sagen will, aber er darf es nicht, der innere Zensor stellt sich ihm in den Weg und würgt ihn so lange, bis er blaue Flecken bekommt. Schon klar, was er sagen will: Sie haben ihn gemordet. Sie: die Brut der Mörder. Gemordet mit Megaphonen, die einen Hörsaal in eine brüllende Wüste verwandeln, gemordet mit dem grausamen Spiel der entblößten Brüste, auf das die Journaille fliegt, gemordet in ihrem unwissenden Hochmut, ihrer feixenden, sich als Mut vor Tyrannen maskierenden Feigheit. Sie sind überall. Ist das wahr? Ist das gestört? Schwer zu entscheiden, vielleicht beides, das kann schon sein. Kann schon sein. Bei Teddy hättest du auch gern studiert. Zu spät aufgestanden, sowas rächt sich beizeiten. Im Geburtskanal abgehängt. Bei Toten studiert man nicht, man liest ihre Bücher, Pech, irgendwann kennt man sie in- und auswendig. Man kann einen Kult um sie treiben, aber: bei Toten, sorry, studiert man nicht. Sie sind tot.
Staunen ergreift dich, o ja. Du braucht das Wort nicht, es ist die Sache. Eine Sache des Staunens, die durchbricht, zwischen Leber und Milz, gerade da wirds licht, liegt am Sound. Zweifel? Hier nicht. Flasche Descartes, gieß nach. Rock me baby, rock me baby, nein, John the guitar ist das nicht, oder doch, oder nicht, das kommt härter, o ja, es kommt ausgesprochen... härter, wer weiß, was noch alles kommt. Wäre da einer, ders wüsste, das hätte sich doch herumgesprochen, das hättest du längst mitgekriegt, also gut, gut liegst du, gut im Rennen, die drums, okay, das hält auf der Strecke. Keiner geht hier verloren, hier nicht. Hier doch nicht. Oder?
Die wir nicht zu sehen bekommen, gibt es die überhaupt?
Tempo halten, Kurve kriegen, das füllt doch ... aus zweifellos, es füllt aus. Strömt ein, strömt zu, strömt. Zum Teufel mit den Synapsen. Gestöpselt wird immer. Irgendwo da draußen im Land steht ein Kraftwerk und du... du stehst unter Strom, der Körper dehnt sich, er könnte ja platzen, aber er schwebt, zieht Schweben vor. Kluges Kerlchen. Von wem er das hat? Du könntest jetzt die Stuhlkante zerhämmern, das wäre ganz normal, denn... hoppla, du schwebst. John hat dich sicher im Griff, großartig macht er das, schickt dich erst dahin, dann dorthin, lass es geschehen. Lass es einfach geschehen. Ja, es gibt das Einfache. Ja, es ist zu haben. Ja. John der Geschickte. Fingerfertig der Junge. Du könntest jetzt rosa Bonbons werfen. Das Bad in der Menge richtet dich auf, was fällt, ist dein Schatten. Dein oder Bartoszs Schatten, wer entscheidet das, letztlich? Eine Handvoll. Stimmen. Hinter dem Vorhang. Blödsinn. Wenn doch der Vorhang fällt? Lass es geschehen. Lass es. Lass es einfach. Es geht doch, geht doch schon... with a whimper. Was für eine Sprache.
Das All in der Nadelspitze. Man muss gute Boxen haben, um es hörbar zu machen, richtig gute Boxen, umsonst gibt’s keinen Sound, aber dann... Klappt doch. Unvorstellbar im Grunde, aber: es ist die Nadel. So ein Winzling stellt die Verbindung her. Kaum zu glauben. Und alle nehmen es hin. Noch nie hast du gesehen, dass einer die Lupe zückt. Alle nehmen es hin. Die Revolution in einer Nadelspitze. Was ist ein Pfund Margarine dagegen? Ein Stück Scheiße. Merde. Pustekuchen. Denk nach, Hiero, denk doch nach. Genauso hingen die Mütter damals am Volksempfänger, jahraus, jahrein, bis Margarine dann doch wichtiger wurde. Ein glitschiges Etwas. Niemals in der Geschichte war Margarine wichtiger als zu unserer Geburt. Oder kurz davor. Lässt sich das vergleichen? Eher nicht. Der Vergleich hinkt, Hiero, er ist nicht erlaubt. Er ist durchgestrichen. Wenn Eber blubbert, dann weiß er: diese Rede ist nicht erlaubt. Und das ist gut so. Against fascism. Forever. Wir lassen uns nichts anhängen. Eber bleibt gestrichen. Stell dir vor, irgendwo steht die Wahrheit und keiner geht hin. Ist sie dann immer noch wahr? Das sind so Ambivalenzen, Hiero. Als angehender Philosoph solltest du diese Frage nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auf welche dann? Auf die schwere? Wo sollte die sein? Woher nehmen, sprach der Rabe.
Ja doch, Johnny, das war deine Nummer, vorbei, meine steht bevor, so ist das Leben. Noch zuckt dein Finger an der Gitarre, aber: so ist das Leben. Ich werde es bringen, soviel ist klar, er wird mich nicht davon abhalten, wie sollte er? Warum sollte er? Das wäre ja absurd. Und absurd, nicht wahr, Hiero, wollen wir nicht sein. Das überlassen wir gerne den Dichtern. Diese ewige Beckett-Scheiße, das hält doch einer im Kopf nicht aus. Und du hast nur einen Kopf, merk dir das, du hast keinen Kopf zu verschenken. In den anderen mag brodeln, was will, du hast nichts zu verschenken. Die meisten sind doch Verlierer, ohnehin, untenhin, landen über kurz oder lang an der Schule, Pauker-Typen, was sonst. Sieht man genauer hin, merkt man es ihnen schon jetzt an. Woran man es merkt? Gar nicht so einfach. Gute Frage. Einfach hinsehen. Weitergehen, Leute.
Ja die gute Aura, es gibt sie. Was denn sonst? Sowas geht doch nicht einfach weg wie Akne, Menschheit will erwachsen werden, fangen wir an. So ein Blödsinn. Bartosz, der Penner, hat geglaubt, im Sozialismus verschwindet selbst der Tod von allein, geht als ein Stück Privatverhältnis zum Weltall perdü. Das waren Recken. Aufgeben? Nie.
Es ist die Aura, wer sonst, die dich zwingt, sowas wahrzunehmen, bevor es auf den Schirmen des Wissens erscheint. Spät gewusst, früh bewusst. Das alles spielt im Bewusstsein, dahinter kommen wir nicht. Sind sensibilisiert dafür, keine Frage. Es geht auch anders, aber dann merkt man nichts und ist der Gelackmeierte. Komischer Ausdruck, woher der stammt? Egal.
Als du ein Knabe warst, ein Knäblein ach, ranntest du bei jeder Gelegenheit zum Hafen hinaus und schautest, ob einer von den Skippern dich an Bord nahm, ob für fünf Minuten oder zwei Stunden. Und wenn du morgen einen Doktortitel vor deinen Namen schreibst, kaufst du dir ein Boot und segelst los. Atlantiktörn, Weltumseglung, das wird sich zeigen. Kommt drauf an, wer mitkommt. Carsten Schipfang zum Beispiel, ein ganz erfahrener Mann, gewinnst du den, ist alles machbar. Komischer Name, aber der Mann ist gut. Das heißt, wenn er kann. So einer ist erst einmal auf Jahre hinaus ausgebucht. Du ja auch. Einer wird sich finden. Irgendwann fährst du allein, in einer Hand die Strömung, in der andern den Wind, sonst nichts, Meer und Wind, das ist das Ziel. Eike versteht davon nichts und Pw, der kann doch nur frotzeln, dem geht das gegen die Natur. Man muss die Strömung kennen, die einen versetzt, unter der Oberfläche, wo denn sonst. Du siehst nur Oberfläche, hast du zu Pw gesagt, es war wie ein stiller Triumph, doch der Satz ist analytisch. Du siehst die Wellen, manchmal sind ganz schöne Brecher dabei, oberflächlich das alles, Windgekräusel, du musst aber wissen, was drunter vorgeht, sonst kommst du nicht weit. Es ist auch gefährlich, du kommst nicht nur nicht weit, du kommst auch nicht mehr zurück. Und dann...
S-O-S, unkt Pw mit diesem überheblichen Grinsen im Gesicht, manchmal möchtest du ihm in die Fresse schlagen, nun, souverän wäre das nicht, nicht wirklich. Ja, Kerze in der Kombüse anzünden und beten, hast du gesagt, und Pw ist wieder interessiert: Was soll das? Ist das ein Küstenschnack? Wieso? hast du gefragt, ebenfalls grinsend: Das tut man doch so. Und Pw: Wenns hilft. Er setzt immer noch einen drauf. Du auch: Natürlich hilft es nicht, aber es beruhigt die Nerven. Und er: Das bezweifle ich stark. – Dann darfst du nicht aufs Meer. – Das werde ich auch schön bleiben lassen.
Natürlich wird er es bleiben lassen.

Höhenflüge
Hiero, einzigartig, befindet sich in einer Lage, die dem nicht nachsteht. Er goutiert die Vorstellung vom Kulturbruch, sie geht ihm nach, der Kultur dagegen kann er nichts abgewinnen. Den Gang ins Theater lehnt er ab. Er liest viel, eigentlich ununterbrochen, mitunter auch einen Roman. Bei Romanen beweist er einen untrüglich schlechten Geschmack: Horribilia vom Feinsten, aus der Delikatessenabteilung fürs Wochenendloch. Der Blitz trifft ihn, als er bei Kattusch eine dickleibige, in mattem Rot leuchtende Scharteke mit dem eher seltsam wirkenden Titel Gähnende Höhen aufblättert, das Opus eines sowjetischen Dissidenten, dessen Name ein paar Wochen lang durch das europäische Feuilleton geistert, um jäh wieder daraus zu entweichen. Dieses Zusammentreffen liegt derzeit noch in der Zukunft, seltsam auch das, denn das fette Opus war schon geschrieben, als Hiero noch die Schulbank drückte. Bereitet sich der junge Mann derzeit aufs Examen vor, so das Opus, in die Auslagen der ›französisch sprechenden Welt‹ einzurücken, wie man das hierzulande schmallippig ausdrückt. Hiero und das Opus wissen noch nichts voneinander, kein Wunder, die Kulturen, denen sie angehören, haben einander nichts zu sagen. Um das zu ändern, muss schon ein Parteisekretär kommen und eine neue Ära eröffnen, wie man unter notdürftig zivilisierten Säufern von Zeit zu Zeit ein Glas Champagner entkorkt, um kurzfristig einen Stoff zirkulieren zu lassen, den in diesen Kreisen das Epitheton ›trocken‹ ins Regal für besondere Gelegenheiten verbannt. Hiero ist Realist genug, um die Ausgaben für dergleichen Genüsse stante pede in philosophische Währung umzurechnen: sie wird, wie treffend, von einem Hamburger Verlag ausgegeben, dessen Hausfarbe, ein seltsam altväterliches Grün, in überzeugender Monotonie Hieros zweiflügeligem Bücherregal die ersehnte Professionalität verleiht. Der Ehrenplatz, den Spinoza darin einnimmt, ist Kärichs Obsession geschuldet. Descartes’ Meditationen erinnern Hiero eher unangenehm an die Zeit der Einführungsveranstaltungen, in denen er dem Juxbedürfnis einer Kohorte ausgeliefert war, die sich inzwischen in alle Winde zerstreut hat. Gleich daneben beginnt die Reihe der Kant, Fichte, Schelling, Hegel und ihrer diversen Ausleger: eine Huldigung an den Geist des Instituts, die, getreu der von Dassler ausgegebenen Parole, man wisse noch gar nicht, wie die Klassiker zu lesen seien, auch weniger bekannte, darunter bis vor kurzem verschollene Nebenlinien einschließt, nicht zu vergessen die minder gewichtigen Zeitgenossen, die ein aufs Gespräch der Riesen konzentrierter Blick stets übersieht, darunter ein Semester Johann Heinrich Lambert inklusive Referat mit anschließender häuslicher Ausarbeitung.
Lambert hat nicht viel gebracht. Zweifellos ein heller Kopf. Sein Organon, darin geübt, die Zeiten zu überdauern, ohne durch allzu viel Lektüre Schaden zu nehmen, konnte sich einen griffgünstigen Platz im Regal ergattern, auf dem es nach jedem Umzug unweigerlich wieder auftaucht. Ein Wunder, denn wahrlich, Hiero wüsste nicht zu erklären, dass und warum er das Büchlein immer aufs Neue just an dieser Stelle deponiert. Eines Tages, ›one day‹, wie Kärichs imaginärer Brite das auszudrücken beliebt (auch der Parteisekretär ist inzwischen Geschichte, sein Name, auf Wodka-Etiketten gedruckt, füllt andere Regale als das hier in Rede stehende), öffnen sich unter dem sanften Druck von Hieros Daumen die Seiten. Heraus fällt, von einem Polizeiautomaten aufgenommen, ein Foto. Es zeigt ihn am Steuer eines flotten Wagens, an das er sich kaum mehr erinnert: blass, übermüdet, die Finger der linken Hand an den Lippen spielend, ein Gesicht, das hart und kurz aus vergangenen Spiegeln auftaucht und im Nichts irgendeiner Erwartung verschwindet. Die Zukunft, die diese auf dem Foto nicht übermäßig herausgearbeiteten Augen zu durchdringen versuchen, das... das ist doch er selbst, ersichtlich er selbst, oder? Wäre er jetzt Philosoph – er ist es, aber angenommen, er wäre es nur –, er würde nicht zögern, das Spiel auf der Stelle hervorzukramen und versuchsweise die Figuren aufzubauen, die alten Züge nachzustellen, die gepflegten Enttäuschungen ein weiteres Mal durchleben, die überraschenden Sackgassen, in die das Denken gerät, mit Aufmerksamkeit und Wehmut untersuchen – alles eine Frage der Phantasie? Ergibt sich nicht doch einmal überraschend ein neuer Zug, mit dem man sich in die Liste derer einträgt, die Gültiges hinterlassen? Vergebliche Mühe! Gerade hier, just an dieser Stelle, ist kein Durchkommen, heute wie damals, die Athener haben ihre Wachen gut postiert und Sokrates’, ihres Sokrates, den sie lange ertrugen, eifrige Erben branden vergeblich gegen die Thermopylen, hinter denen sich die Zukunft verschanzt hat.
Wenn ich in die Zukunft blicke, was sehe ich da? Nichts sehe ich. Aber in diesem Nichts steht, unausschneidbar, das Ich, nicht wegzubekommen, eine Projektion, wie die Psychologen sagen, ein Wunschbild also, schon darin täuschen sie sich, aber das nur am Rande. Sei nicht naiv, Hiero, ein Zufall, ein Sprachzufall hat es so gefügt, wechsle die Sprache und das Vexierbild hat sich verflüchtigt. Aber warum soll ich die Sprache wechseln, wenn diese hier mich etwas lehrt? Etwas, das auch ohne diese Sprache Bestand hat? Es ist doch wahr, dass ohne mich keine Zukunft stattfindet, dass sie zusammenklappt wie ein Regenschirm, sobald man auf diesen Knopf drückt. Genauso wahr ist, dass ich mir von allem ein Bild machen kann, nur nicht von dem, der ich sein werde. Dies beides ist zweifellos wahr, es ist die persönliche Grundlage allen Zweifelns.
Ich werde sein und alles wird anders.
Zwei Sätze, ein Gedanke. Natürlich kann ich den, der ich werden möchte, nach Belieben herausstaffieren, ich kann ihm, unter Saunagängern, die durch die Poren leben, ein tolles Leben andichten, ich kann ihn mit den Trophäen künftiger Großtaten behängen, bis er in die Knie geht, aber – das Gesicht, mein Gesicht, bleibt leer. Nur die Polizei weiß Bescheid, deshalb gibt sie Bescheid, sie hat die Aufgabe, zu regulieren, was kommt, dieses Gesicht ist ihr untergekommen, ihre Kamera hält es fest, es ist noch fast leer, aber doch bereits ein beschriebenes Blatt, für weitere Einträge offen. Ich aber, der dieses Bild betrachtet, ich, der aus einer Zukunft, die keine mehr ist, darauf zurückkommt, sehe nichts, das auf mich deutet, außer dem Blick dessen, der ich einmal war, diesem ins Leere gerichteten Blick, an dem die Leitplanken einer nicht ins Bild aufgenommenen Autobahn vorbeirasen und der den Horizont nach Gefahren abtastet, die er noch nicht kennt. Es gibt einen Test, der die Lage klärt. Sooft ich versuche, mich – dieses künftige Selbst, das ich sein werde und also irgendwie bereits bin – abstoßend zu konstruieren, zerreißt das Band zwischen mir und mir und der dort, mein zukünftiges Ich, wird ein Anderer. Kein zukünftiges Ich ist imstande, Scham zu erzeugen. Darin liegt der Unterschied zur Vergangenheit, in der so etwas gang und gäbe ist. In Bezug auf sie ist es die Scham, die für Überblendungen sorgt und den, der ich war, verschwimmen und verschwinden lässt. Scham verbindet – den, der einer ist, mit dem, der er war, so wie sie das Kollektiv der wirklichen und der eingebildeten Täter zusammenschweißt.
So oder ähnlich denkt Hiero an diesem Tag, der im Jetzt des Kandidaten noch schlechterdings unauffindbar ist, aber ebenso unbezweifelbar heute bereits wieder vergangen. Näherhin schlurft er, zwischen den Fingern das Buch, hinüber ins Badezimmer, eine Orgie aus gekacheltem Weiß, in dem sich die gekachelte Psyche der Frau spiegelt, mit der er gegenwärtig zusammenlebt –, wenn sie, wie jetzt, nicht da ist, dann spiegelt sich ihre Abwesenheit darin, das läuft, nicht ganz, aber der Tendenz nach, auf dasselbe hinaus. Die einzige unbesetzte Fläche im Raum bietet der Spiegel, den er, Hiero, nach dem Einzug eigenhändig dort angebracht hat – eine der wenigen handwerklichen Gesten, die es von ihm gibt, kaum geeignet, ihn zu überdauern, nun ja. Kein Kommentar. Heide gegenüber, die gedrängt hat, jedenfalls nicht ohne Witz. Er betrachtet nicht das Gesicht, das, faltig und beziehungslos umhergeistert, in diesem Raum, der keiner ist, auf einer Fläche, die keine sein will, sondern die rechte Hand. Er hebt und senkt sie, beäugt sie in der Verdopplung, die der Spiegel auf seine sachliche Art ohne weiteres vornimmt, dreht sie und hält sie an, pardon, versucht sie anzuhalten. Schiebt sie in die Tasche, zieht sie wieder heraus, legt sie auf den Rand des Waschbeckens, umklammert sie mit der Linken – und lässt los. Lässt los. Stößt sie fort, lässt sie fallen, auspendeln, holt sie, kontrolliert bis in die Gewebespitzen, wieder heran. Es nützt nichts.
Die Hand zittert.

1 + 1 = 3
Das ist keine neue Erkenntnis, das Zittern hat bereits das Studium begleitet, es ist sein stummer Kamerad, aber ein unheimlicher, jedenfalls seit Hiero zum ersten Mal der Verdacht überkam, dass es sich heimlich verstärkt. Das wäre nicht verwunderlich, schließlich muss es irgendwann begonnen haben, er erinnert sich an eine Zeit in der Kindheit, in der er mit ruhiger Hand seine Schiefertafel gewischt und in krakeliger, aber fester Schrift 1 + 1 = 3 darauf geschrieben hatte, bloß um den Lehrer zu reizen, der besorgt den Vater anrief, nachdem er Hiero vor der Klasse verhöhnt und, wie allgemein üblich, an den Haaren gezogen hatte. Der Vater hatte ihn fest angesehen und etwas resigniert bemerkt:
- ―Das mag in der Philosophie stimmen, aber im Leben und vor allem in der Schule wirst du damit Schwierigkeiten bekommen.
Dieser Satz hat sein Leben verändert.
Zu der Aussage steht er, auch wenn ihr ersichtlich ein wenig Unsinn anhaftet, da Sätze dieser und anderer Art unvermeidbar sind und immerfort das Leben verändern. Wie sähe es denn sonst aus? Was sich im Leben behaupten will, lebt von Behauptungen. Sie sind zahlreich wie der Sand am Meer und ebenso flügge. Man trifft sie heute hier und morgen dort und wundert sich gelegentlich, in welcher Gesellschaft sie ihr Auskommen finden, aber das kann schneller vorbei sein als man denkt. Im Studium dämmerte es Hiero, dass die vom Vater sicher nicht so gemeinte Bemerkung ein Kapital darstellt: sein Erweckungserlebnis, vergleichbar Casanovas tollkühner, wenngleich welthistorisch verspäteter Entdeckung, dass die Erde sich um die Sonne dreht – im zarten Alter von acht Jahren, hört, hört! –, oder Rousseaus ähnlich abenteuerlicher, in eines edlen Schatten blasser Kühle realisierter Einfall, dass die Zivilisation nicht zu retten sei und in dieser Erkenntnis ihre einzige Rettung liege. Seine kindliche Formel mag etwas unfertig wirken, ein gewisser Trotz ist scheint’s nicht aus ihr zu entfernen. Aber das lässt sich für die beiden anderen auch konstatieren. Und wenn schon: Was liegt eigentlich der Relativitätstheorie anderes zugrunde als eine wunderbar trotzige Formel, die eines Morgens, von unbekannter Schülerhand gekritzelt, an der Schultafel prangt und dem Lehrer unzweifelhaft kundtut, dass seine geliebte Klasse ihn für ein borniertes Subjekt hält?
Dagegen ließe sich einwenden, dass Hiero seine Formel nicht erfunden, geschweige denn erdacht hat. Ersonnen schon, aber das ist eine unklare Tätigkeit, deren Sozialprestige schwankenden Konjunkturen unterliegt. Aus diesem Grund, zu dem sich andere, übergeordnete Überlegungen gesellen, legt er keinen gesteigerten Wert auf sie. Sie bleibt ein kleines Geheimnis, das er mit dem teilt, der ihn morgens bei der Rasur aus dem Spiegel anblickt. So kommt es, dass sie auch den Kommilitonen unbekannt bleibt und im Examen keine besondere Rolle spielt. Nur als Dassler ihn beiläufig fragt, ob man Fichtes berühmtes Ich=Ich noch in einem anderen als dem soeben referierten Sinn verstehen könne, da blitzt es in ihm auf, und er antwortet so unbedacht, dass es ihn fast die Note kostet:
- ―Das wahre Ich ist das dritte.
- ―Ja? repliziert Dassler mit hochgezogener Braue. Und das wäre?
Mehr als ein verschmitztes Lächeln lässt sich der Kandidat jedoch nicht entlocken und Dassler, den die Unbotmäßigkeit amüsiert, belässt es bei dem Vorstoß. Ein Fehler vielleicht, wer mag das wissen.
Wer mag das wissen. Hieros Naturell entspräche es, ›Hier!‹ zu rufen, mit klarer, unverstellter und auf gar keinen Fall gedämpfter Stimme. Raum ist in der kleinsten Hütte, warum nicht hier, selbst unter Kacheln fällt es ihn an, aber er hat gelernt, auf der Hut zu sein, ein bitteres Lernen war das. Er kann sich jetzt zügeln. Damals, soviel weiß er noch, zitterte die Hand so sehr, dass er sie kräftig drückte, was nicht unbemerkt blieb. Kärich, der ewige Beisitzer, bot sogar an, die Sitzung kurzzeitig zu unterbrechen. Ein durchsichtiges Manöver, auch fiel das Wort ›Zigarettenpause‹. Weder Dassler noch der Kandidat gingen darauf ein. Ziemlich übel, schon perfide zu nennen, wenn man bedenkt, dass er Kärich am Vorabend an der Platte klar geschlagen hatte. So konterte er durch betonte Sachlichkeit.
Die Prüfung, so hatte es auf der persönlichen, mit einer knappen, sozusagen trockenen Unterschrift versehenen Einladung gestanden, fand in Dasslers Dienstzimmer statt. Wer weiß, wer inzwischen dort residiert. Im Treppenhaus begegnete er Tronka, das Zusammentreffen festigte ihn innerlich und fächelte ihm Mut zu. Es war klar, Dassler würde die Gretchenfrage stellen, falls Hiero sich nicht vollständig über seinen Status als guter Mann getäuscht hatte. Und wirklich, nach allerlei Fragen über allerlei Differenzen bei Kant und ihre diversen Aufgaben, über das Kategorienproblem als solches und den Hegelschen Subjektbegriff in Abgrenzung zu Fichte und Lambert, die Hiero mit Leichtigkeit beantwortete, während er darauf wartete, dass die wirkliche Prüfung ihren Anfang nahm, nach alledem faltete Dassler auf eine merkwürdige Weise seine Hände, er legte sie zusammen und blickte über sie hinweg ins Weite oder jedenfalls Unbestimmte, denn die weiß gestrichene Wand, zwei Meter von ihnen entfernt, ließ keine großen Distanzen zu.
Unterdessen redete Kärich weiter, scheinbar unaufgefordert, aber einem feststehenden Ritual gemäß, er redete mit leiser Stimme, man konnte meinen, er rede mit sich selbst, und Hiero, begierig auf das entscheidende Wort aus Dasslers Mund, war erst geneigt, seine Worte zu überhören, während er sie bereits einschlürfte wie... wie frische Austern, da schlägt die Leidenschaft für das Meer doch wieder zu.
Was Kärich hier, irgendwie dann ja doch brillant, von sich gab, das musste man dann wohl eine Würdigung nennen. Sie ging aus von dem, was Hiero in der vergangenen halben Stunde geleistet hatte, schwenkte auf sein Studium und seine Person zurück und zum ersten Mal, soweit sich Hiero erinnert, faltete sie aus, was der Ausdruck ›guter Mann‹ in concreto umschloss. Demnach war er nicht nur ein guter Mann, wie es ja auch seiner Selbsteinschätzung entsprach, er war der gute Mann, eine Art Verkörperung dieses Typus’, so wie für Cicero Sokrates und natürlich er selbst den Vir bonus verkörpert hatten. Die Kriterien, die Kärich in Anschlag brachte, waren erstaunlich banal; eigentlich hätte Hiero sich das alles bequem selbst denken können (was natürlich nutzlos gewesen wäre): eine auffällige Erscheinung war er gewesen, und zwar vom ersten Seminar an, das er besucht hatte und an das sich Kärich noch ausgezeichnet erinnern konnte, jedenfalls sagte er ›ausgezeichnet‹ und Hiero fühlte sich dadurch ausgezeichnet, dass er es sagte. Kärich erwähnte auch seine Arbeit über Lambert, die ›druckreif‹ gewesen sei – hier räusperte sich Dassler und nickte, es war ein leichtes Wiegen, das vor- und zurückschwang, Hiero, der an das Referat, vermutlich wegen der massiven Unlustgefühle, die seine Entstehung begleitet hatten, nur ungern zurückdachte, sah plötzlich alles plastisch vor sich: während Kärich ihm eine klare und entschiedene Auffassung des philosophischen Hauptgedankens attestierte, fühlte er klar und entschieden die schmerzhafte Lücke im Übergang vom dritten zum vierten Abschnitt, wo es ihm nicht gelungen war, Lamberts Systembegriff in eine vernünftige Korrelation zu demjenigen Kants zu stellen, der schon für sich allein genommen mehr Fragen aufwarf, als er, Hiero, zu beantworten gelernt hatte. Die Arbeit war ein Flop, und Kärich wusste es. Arschloch. Wie er, von ihr ausgehend, nun nachdrücklich seine Fähigkeit – ›und mehr als die Fähigkeit: den Willen‹ – zum systematischen Denken in den Raum stellte, das empfand Hiero damals wie heute als selbstverständlich – das heiß ersehnte Geschenk, das wirklich auf dem Gabentisch liegt – und als einen zynischen Affront. Die kalte Dusche kam prompt.
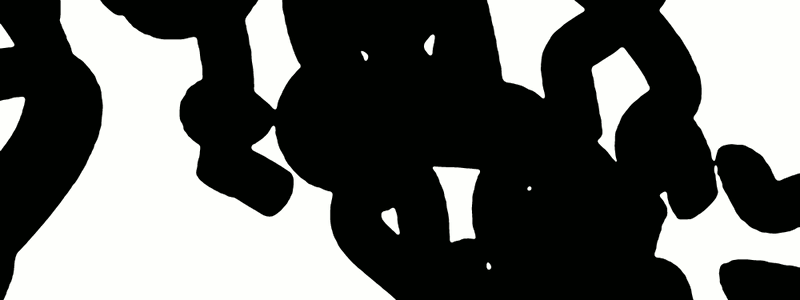
Der Fehler
Nein, nicht damals hat sich Dasslers Formel, man wisse noch gar nicht, wie man die Klassiker zu lesen habe, bei Hiero gegen den Seminarbetrieb und das Gespann gewendet, das Dassler und Kärich miteinander bildeten. Er kann sich überhaupt nicht erinnern, wann genau das geschah. Nur dass es geschah, steht außer Zweifel, ebenso, dass es geschehen musste, sollte er, Hiero, zu den unverrückbaren Überzeugungen kommen, die ihn zu der Person werden ließen, die er heute ist. Das Badewasser rauscht und schwillt, die Zahnpastatube übt sich in der ihr eigenen verqueren Nachgiebigkeit, vertraute Frischegerüche durchwallen den Raum – ein guter, solider background für das kleine Palaver, das da, als fahre er Geisterbahn, aus der Spiegelregion auf ihn einströmt. Das Rauschen geht über in einen Vorhang, geformt aus Widerwillen, einen stetig strömenden Wasserfall, der den Eingang zur Höhle verbirgt, in der, wahrscheinlich bewacht von einem ansonsten arbeitslosen Fafner, das Gold der Erinnerung an die Zeit vor dem Unglück liegt. Ein Unglück, ganz recht. Besser gesagt, ein Malheur, das er damals nicht so empfand und bis heute nicht gelten lassen kann. Was immer der Geizkragen Fafner da hütet, das ist doch nicht er, Hiero, der weiß, wofür er steht, das, das wäre ja... eine krause Konstruktion. Nein, dieses Unglück war kein richtiges Unglück, sonst wäre es letztendlich auch reparabel gewesen. Es war eine Art Glück, denn auf diese irreparable Weise hat er seinen Weg gefunden. Ein Malheur allerdings kann man es bei nüchterner Betrachtung angesichts all der Chancen, die er damit ausgeschlagen hat, wohl nennen.
Dasslers weiche, mit starkem Timbre ausgestattete Stimme hat Kärichs zunehmend lästiger werdende Eloge aus dem Raum entfernt, etwa wie man einen Staubfaden vom Revers entfernt, ohne weiter auf ihn zu achten oder die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners auf den Vorgang lenken zu wollen, die selbstredend durch das sich darin zeigende Geschick mächtig entfacht wird.
- ―Wir kennen Sie jetzt seit Jahren, Herr Gundling, so spricht diese Stimme, Sie haben uns soeben eine Probe davon gegeben, dass Sie an diesem Institut viel gelernt haben. Sie haben einen spannenden Lebensweg vor sich. Was werden Sie machen?
- ―Darüber muss ich nachdenken. Ich meine, ich nehme mir ein paar Monate Zeit und entscheide dann, was ich mache, hört Hiero sich – sagen, reden, flunkern, herunterleiern, wie immer man das Kind nennen möchte, denn dass es sich um einen Geburtsvorgang handelt, daran besteht kein Zweifel. Noch liegt das Kindchen nicht in der Wiege. Wie um den Sachverhalt zu unterstreichen, mischt sich die weiche und dabei sonore Stimme wieder in seinen fliegenden Gedankengang ein.
- ―Zu lang sollten Sie nicht warten, bemerkt die weiche, ein wenig pastose Stimme, väterlich besorgt, in einem schleppenden Tonfall, der unendliche Distanz signalisiert. Sie können das dann mit Herrn Kärich besprechen, der auf jeden Fall für Sie da sein wird. Falls Sie mir etwas zu sagen haben, sollten Sie es vielleicht jetzt tun.
- ―Sie sind doch ein guter Mann, quäkt Kärich aus dem Hintergrund, Sie sollen, Sie müssen promovieren, was gibt es denn da zu überlegen?
- ―Ich habe doch noch gar kein Thema.
- ―Das sollten Sie sich allerdings gut überlegen.
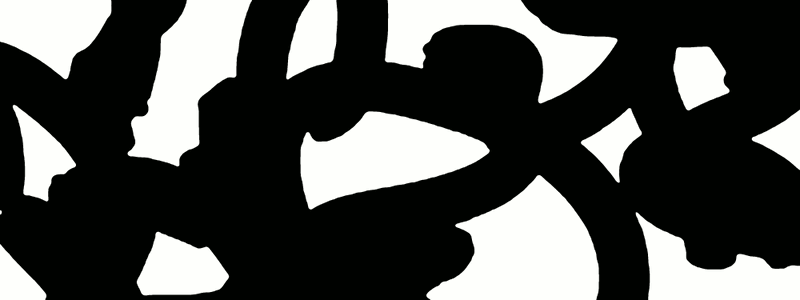
Dead dog walking
Er hat es nicht gewusst. Nicht gewusst, was alle bereits wissen, als er nachdenklich die wenigen Stufen ins Freie hinabsteigt, auf die verlotterte Piazza, wo die geparkten Autos kreuz und quer stehen und gurrende Tauben Jagd auf reichlich verstreute Brosamen machen. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: es ist Dasslers vorerst letztes Semester vor Ort, er wird auf unbestimmte Zeit nach Amerika gehen, nach Princeton, genau genommen, das Ziel aller professoralen Schnäppchenjäger, jedenfalls auf dem geisteswissenschaftlichen Sektor. Ein paar in Princeton zugebrachte Semester machen den Forscher rund, sie verleihen seiner Karriere den schönen Bogen, den es braucht, damit einer sagen kann: Seht her, ein Mensch. Selbstverständlich hat auch Hiero, der seine Karriere minutiös vorausbedenkt, diese Ehre fest gebucht, auch wenn sie noch in weiter Ferne schlummert. Im Augenblick beschäftigen ihn andere Sorgen.
Welche das sind, will Pw wissen – sie kleben wieder im Pfau und Hiero wird die Nacht hindurch fahren, um am nächsten Morgen die erste Fähre heimwärts zu erreichen –
- ―Welche? Du bist gut.
- ―Gebongt, aber... Sag mal: Was hat der Dassler eigentlich damit gemeint, dass er dich an den Kärich verwiesen hat? Ich an deiner Stelle würde da aufpassen.
- ―Was soll er schon damit gemeint haben. Kärich kriegt einen Ruf. Das hab ich aber erst anschließend erfahren. Außerdem ändert es nichts.
- ―Kärich? Nein! Hör mal, aber das ändert doch alles.
- ―Wieso?
- ―Also ich an deiner Stelle –
- ―Du bist aber nicht an meiner Stelle. Außerdem gehe ich nicht mit Kärich in die Provinz.
- ―Das scheint mir jetzt ein wenig voreilig...
Hiero trotzt.
- ―Ich zieh mich jetzt drei Monate aus dem Verkehr, dann werde ich das entscheiden. Du weißt ja gar nicht, ob er mich will. Ich zerbrech mir doch nicht den Kopf –
- ―Das solltest du aber.
- ―Sollte ich nicht.
- ―Na gut, wenn du meinst. Auf so eine Chance kannst du ein Leben lang warten. Ich an deiner Stelle würde die Seelage vergessen...
Nein, das hätte er nicht sagen sollen. Er hätte es nicht sagen dürfen, das sieht er an Hieros Augen. Und er setzt eins drauf.
- ―Ich finde diese Bindung sowieso unnatürlich. Wetten, du hast noch nie darüber nachgedacht, wie Scheiße das sein wird, wenn du da im Alter im Puppenheim sitzt und dir jeden Tag vorsagen musst: Soweit hat mein Vater es auch schon gebracht?
- ―Was stört dich daran?
- ―Schätze mal, das ist kein besonders erhebendes Gefühl.
Der Versucher. Kapitel? Vers? Egal. ›Unnatürlich‹ ist kein Wort, das man in ihrem Kreis in den Mund nehmen würde, ohne ihn ironisch zu verziehen oder die Stimme mit Häme aufzuladen. Vom Vater zu reden ist, seit der Attacke im Kino, explosiver Stoff. Warum tut er das...?
Danach fragt man bei Pw vergeblich, die Provokation gehört zu seinen elementaren Operationen. Wer’s nicht erträgt, hält sich besser fern. Das ist leichter gesagt als getan, in der Runde gibt er damit den Ton an. Fräulein Portiönchen, seine Schwester im Geiste, blickt bereits spottlustig und interessiert herüber, das fehlte noch, dass sie sich jetzt einmischt. Hiero könnte, was ihn zu ihr hinzieht, mit den Händen erzählen – mit beiden Händen, selbstredend, stumm. Im Tanz der Fingerkuppen liegt vieles, was das Leben verschweigt. Manchmal tut es gut daran, er möchte nicht erinnert werden, jetzt nicht, jetzt sowieso nicht... Und da schießt ihm das Blut ins Gesicht und er brüllt, übergangslos, wie er lange nicht mehr gebrüllt hat. An den Nebentischen ist man nicht gleich darauf eingerichtet, schon sieht man die ersten erfreuten Gesichter, bierglänzend, die Brüllstimme dunkelt ein und wird körnig, als käme sie aus einem Nussknacker, dem man soeben die Entlassung verkündet hat, sein heiliges Recht auf Helgoland, durch Generationen erhärtet, nur einmal durch Ausrottung – ich sage: Ausrottung! – in Gefahr, ihr werdet es nicht –
- ―Holla, holla!
- ―du nicht und Fräulein Portiönchen nicht und wer immer auf den Gedanken kommen könnte, es noch einmal zu versuchen –
- ―Also jetzt komm mal wieder auf den Teppich...
- ―Komm ich nicht, warum sollte ich, da könnt ihr auf dem Kopf stehen, meinethalben, das mag zwar lustig sein, aber es tut nichts zur Sache, hörst du: Es-tut-nichts-zur-Sache –
- ―Aber was ist die Sache? Sags mir, komm sags mir –
- ―Nein, das werde ich nicht. Jedenfalls nicht hier und jetzt. Das steht alles geschrieben, es steht geschrieben, ihr könnt es nachlesen, wenn ihr wollt, das bereitet nicht die geringste Schwierigkeit. Ich weiß, dass du da schweigst, aber ich kann dir da nicht helfen, da musst du durch.
- ―Muss ich nicht.
- ―Musst du doch.
- ―Und wenn ich mich weigere?
- ―Du kannst dich nicht weigern. Das ist das Gute daran: du kannst dich nicht weigern. Du denkst, dass du dich weigern kannst, aber du kannst dich nicht weigern. Das geht nicht.
- ―Also pass mal auf. Du bist doch nicht der einzige hier am Tisch, der weiß, was damals passiert ist. Das wird jetzt langsam... lächerlich. Nein, unterbrich mich nicht. Ich-habe-keinen-Mörder-zum-Vater-und-ich-habe-niemanden-umgebracht. Deinen übrigens auch nicht. Wir steckten damals noch nicht mal in den Windeln, wenn ich mich recht entsinne. Willst du das vielleicht auch bestreiten?
- ―Damit kannst du dich nicht herauswinden. Das Argument zählt nicht.
- ―Und was zählt, bitte sehr, dann?
- ―Was zählt? Was zählt? Willst du wirklich wissen, was zählt? Ich kann dir sagen, was zählt –
Hiero ist abgetaucht, fummelt unter dem Tisch, sein Rücken hebt und senkt sich, er wird doch nicht... hoch wölbt sich der Buckel, ein Gesicht, gerötet, verschwitzt, erhebt sich über die Tischkante, die Hand, noch unsichtbar, zieht etwas nach –
Hiero hämmert mit seinem schwarzen, glänzenden Lackschuh auf den Tisch, einmal, zweimal, fünfmal, frenetisch, an den Nebentischen brandet Beifall auf, vereinzelte Bravorufe, selbst der Wirt lächelt im Sturm der Emotionen, der Pfau ähnelt wieder mal einer rumpelnden Arche Noah, nur Lexa, die dunkel aparte Bedienung, die eine neue Runde Pils ablädt, erspart sich das Lächeln, manchmal gehen ihr die Studenten, man sieht es deutlich, ziemlich auf den Senkel.
- ―Ich-habe-nicht-gesagt, dass alle in diesem Land Mörder sind. Hab ich nicht? Nein, hab ich nicht. Das sagen ganz andere. Ich sage... ich sage... Lass mich bitte ausreden. Sie-haben-es-nur-nicht-geschafft, sich aus eigener... Kraft? Sag ich doch: Kraft! Was kuckst du mich so an! Stimmt doch. Befreien? Die wollten doch gar nicht befreit werden. Da liegt der Hase im Kohl. Wenn es nach denen gegangen wäre, dann wärt ihr hier alle – ich sage: alle! –
- ―Du auch!
- ―Ich auch. Nein, wieso ich? Wieso ich? Komm, sags mir! Wieso ich? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht.
- ―Was macht dich da so sicher?
- ―Mich? Sicher? Das kann ich dir sagen: Weil –
- ―Aha. Und du? Kannst du nicht mal davon abstrahieren?
- ―Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Will ich auch nicht. Warum sollte ich das tun? Alles, was ich bin, verdanke ich meinem Vater.
- ―Danke, das reicht. Schön für dich. Alles, was ich nicht bin, verdanke ich…
- ―Ja –?
- ―… meinem Vater. Was sagst du zu dem Satz?
- ―Das mag in deinem Fall zutreffen...
- ―Danke, reicht. Die Rechnung! Hier kommt die Sippe. Alles, was recht ist.
Hiero, verdutzt ob dieser Wendung, fühlt sich von der Seite her angesprochen. Eine Hand hat sich auf seine Schulter gelegt, den Schuh lässt er ruhen, der andere spinnt ihn vorsichtig ein, behutsam, wie es im Feuilleton heißt, verleitet ihn, den Schuh wieder anzuziehen, gemeinsam erheben sie sich, bezahlt wird am Tresen. An den im Flur wartenden und diskutierenden jungen Menschen schieben sie sich vorbei Richtung Ausgang. Das Kneipenschild glänzt, der Fluss, dunkel bewegt, strömt vorbei, der Anblick stört, unklar warum, sie laufen, mit ihrer Erregung kämpfend, zwischen Häusern umher, deren Wände die Wärme des Tages gespeichert haben und nun abgeben, sinnlos abgeben, unverlangt, denn Frische, absolute Frische täte not, jetzt, auf der Stelle, doch wer daran denkt, tut es mit Hohn, es fröstelt ihn in der Afterwärme, an die man sich halten kann, wie man sich immer an etwas hält. Hiero, den der Gedanke plagt, zu weit gegangen zu sein, zu weit und nicht weit genug, beginnt sich mit zitternden Fingern eine Zigarette zu drehen, vergebens. Dafür kommt ein Gespräch in Gang, glimmt hier und da, kommt, wenn es schon ausgegangen scheint, wieder zum Vorschein, ein kräftiger Zug und es leuchtet auf, das Kraut ist schnell weg, wenn man nicht aufpasst, man muss schon haushalten. Schlecht ist das nicht, es mindert die Spätfolgen. Beide sind erblich belastet, also: Vorsicht!
- ―Die Erzeugung ist das Erzeugnis flüstern die Lippen. Eine zitternde Hand packt den Rasierapparat in das schweinslederne Futteral zurück, das er beim letzten Besuch bei Mutter erstanden hat. Diese Hand ist die seine, kein Zweifel, obwohl... dieser Kopf auch, und diese Gedanken... sind allgemein, sind Gemeingut, soweit er das überblickt, aber es sind seine Gedanken, da – da beißt die Maus kein’ Faden ab, möchte er sagen, doch es käme ihm läppisch vor und so lässt er es bleiben. So reden andere. Lass sie reden! Woher der Drang? Nein, von Heide hat er ihn nicht, der Ausdruck fällt nicht in ihr Repertoire. Was wenig bedeutet, sie kann ihn heute aufschnappen oder morgen. Aufschnappen: wie ein Fisch. Wer nach Wörtern schnappt, schnappt auch nach Menschen. Sie hat keine Wärme, so sieht es aus. Streng dich nicht an, Hiero, hier kommt niemand durch. Hiero, Hiero, hüte deine Zunge. Belegt oder nicht, bedenke, dass jeder Satz, den sie herausschleudert, auf dich zurückfällt. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass auch Heide ihn abschießt, einen mehr dieser in der Summe unzerreißbaren Fäden, unter denen er, ein Gulliver im Lande Lilith, sich seit Wochen innerlich windet.
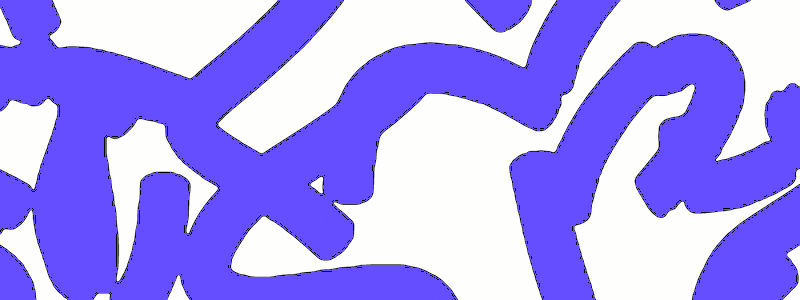
Wirklichkeitssplitter
Unter den jungen Leuten, die im Hause Leckebusch die Tronka-Gemeinde repräsentierten, fiel Hiero durch seine kaum jemals wechselnde Kleidung auf. Das braune Haupthaar wallte über den Kragen eines schwarzen Cordjacketts und schuf dort eine je nach Tageszeit und Beleuchtung mehr oder weniger ins Auge fallende Schuppenzone. Das weiße Hemd mit dem offenen Kragen, in dem ein güldenes Kettchen baumelte, stak in den obligaten Jeans. Einmal im Jahr, und zwar an Weihnachten, wurden sie durch neue ersetzt. Letzteres berichtete jedenfalls Pw, dem ich bereits die Kenntnis der Saint-Saëns-Episode verdankte. Er überlieferte die Information mit zusammengezogenen Mundwinkeln, als enthalte sie eine weitere, die ich erst in Abwesenheit der anderen herausholen und betrachten dürfe. Groß war daher mein Erstaunen, Hiero zu Hause im Ringelpullover anzutreffen. Ein Fenster seiner kleinen, düster wirkenden Wohnung ging auf den engen, verschatteten Innenhof hinaus. Dort stand, kaum eine Armlänge entfernt, eine Laube, in der, wer wollte, sich den Vermieter im Kreise der Seinen vorstellen konnte, zauberisch umrahmt von geschnitztem Wurzelwerk und einer Horde Gartenzwerge, die munter und bewegungslos mit allerlei teils auf Garten-, teils auf Bergmannsarbeit hindeutendes Gerät hantierten. Nietzsches ›toller Mensch‹ kam mir in den Sinn, der den Leutchen am hellen Mittag ins Gesicht leuchtet.Hieros Status blieb unklar, solange sich Tronkas Habilitationsverfahren hinzog. Dass er bei Tronka promovieren wollte, stand außer Frage. So wie er sich während des Studiums vermutlich verachtet hätte, hätte er jemals den Fuß in ein Leckebusch-Seminar gesetzt – während er den Garten-Einladungen ohne Zögern folgte –, so hätte er sich jetzt vermutlich eher die Pulsadern aufgeschnitten, als mit einem der üblichen Themen bei Dassler aufzukreuzen, der ohnehin in Amerika weilte, geschweige denn in Kärichs Tross den Weg in die Provinz anzutreten. Der Verdacht, an Kärichs Habilitation und rascher Berufung sei irgendetwas faul, wollte auch unter Studenten, die Tronka nur von ferne kannten, nicht verstummen, ohne dass zu erkennen war, wer ihn mit welchen Informationen nährte. Natürlich konnten das ebensogut Desinformationen sein. Man munkelte, zwischen Dassler und Leckebusch, den Institutsgöttern, die sich ansonsten gegenseitig aus dem Weg gingen und in den Köpfen der Studenten unterschiedliche Galaxien repräsentierten, habe es einen ›Deal‹ gegeben, der die Verfahren auf eine ungute Weise miteinander verband. Manche wollten von einer Stellenabsprache wissen, andere bevorzugten die für alle Seiten beleidigendere Variante, der zufolge Dassler Kärichs Habilitation zur Voraussetzung dafür gemacht hatte, dass er dem Gedanken an diejenige Tronkas überhaupt näher trat. Das war ein anderes ›überhaupt‹ als das von Leckebusch freigebig in seinen philosophischen Reden verstreute. Es schmeckte nach Erpressung und Größenwahn. Seltsamerweise fanden die Studenten, die von den Unterstellungen wussten und auf die abenteuerlichsten Mutmaßungen aus waren, mehr Geschmack an der ersten Version. Vermutlich klang sie in ihren Ohren ›abgehobener‹ und ragte gleichzeitig weiter ins ›wirkliche‹, ihnen noch bevorstehende Leben hinein. Hingegen mochte letztere auf sie wie eine jener ganz gewöhnlichen Gemeinheiten wirken, deren Gegenstücke schon von der Schule her kannten.
Beide Unterstellungen krankten an einer gewissen Unkenntnis der akademischen Prozeduren, die harte Festlegungen weitgehend unnötig erscheinen lassen. Das war verständlich, da die Verfahren hinter geschlossenen Türen stattfanden. Sah man sich allerdings in der Studentenschaft selbst um, so hätten sie, allgemein gesprochen, ganz gut Bescheid wissen können. Auch ich hatte bereits von den haarsträubenden taktischen Manövern gehört, deren sich kuriose Splittergruppen bedienten, um als Sprecher der Studenten aufzutreten und sich erfolgreich im Schatten allgemeiner Ablehnung zu behaupten. Zur gleichen Zeit, als jene professoralen Intrigen, falls sie nicht nur einer blühenden Phantasie entsprangen, ihr Ziel fanden oder verfehlten, kochte die öffentliche Seele vor Ärger über die Studenten, deren Mehrzahl darüber nur lachte, halb befriedigt und halb verärgert, weil sie von zwei Seiten vorgeführt wurde. Neugierig geworden, ließ ich mich von Anton und Eike, mit denen ich mich abseits der Leckebusch-Abende allmählich anfreundete, zu einer vom AStA anberaumten Vollversammlung mitnehmen.
- ―Vielleicht kann man ja doch etwas tun, kommentierte Anton die Einladung. Seine Rede klang unnachdrücklich, Eike wiegte den Kopf. Ich verstand: soeben hatte ich die studentische Weltformel in ihrer abgespeckten, durch ein Jahrzehnt revolutionärer Wissenskultur zurechtgeschliffenen Alltagsvariante vernommen. Dementsprechend verzichtete ich darauf, Fragen zu stellen außer der, ob meine wenig studentische Erscheinung nicht zu peinlichen Rückfragen führen werde.
Die beiden lachten.
- ―Dagegen könnte man ja wirklich was tun. Eine Langhans-Perücke zum Beispiel für drei-fünfzig bekommen Sie hier gleich drei Häuser weiter, das ist o.k. Das Cordsakko kann ich Ihnen leihen.
- ―Gute Idee, damit wirkt er dann richtig auffällig.
Was sie meinten, wurde mir klar, sobald wir die Tür des Seminarraums passiert hatten, in dem die Veranstaltung stattfinden sollte – ein, wenn die Erinnerung mir nicht etwas vorgaukelt, riesiger, schlecht ausgeleuchteter, alles andere als properer ›white cube‹, zugestellt mit verschlissenem Plastikmobiliar, das jeder Bürochef umgehend dem Sperrmüll anvertraut hätte. Ich hütete meine Zunge. Eine Handvoll Gruppen und Grüppchen verteilte sich ungleichmäßig über den Raum. Die Atmosphäre blieb ruhig, um nicht zu sagen kalt, als der AStA-Vorsitzende zu sprechen begann. Er machte keinerlei Anstalten, sich an die Versammlung zu wenden, sondern setzte einfach das Gespräch mit einer etwas größeren Gruppe fort, die, mir zur Linken, einen leicht erkennbaren Block in den vorderen Reihen bildete. Wie es aussah, hatte die mit Scherzen gewürzte Plauderei in den Geschäftsräumen des Studentenausschusses oder in der Caféteria begonnen und ließ keine Unterbrechung zu. Genauer gesagt, niemand dachte daran, sie abzubrechen, und so behauptete sie sich mit Leichtigkeit in dieser alles in allem bedrückenden, bedrückten und von einzelnen Erwartungsspuren fahrig erleuchteten Umgebung.
Ich verstand wenig, praktisch nichts von dem, was da vorne verhandelt wurde. Dass verdeckte Absichten im Spiel waren, erkannte ich an der Art und Weise, wie man dort vorne Fragen aus dem Raum aufzunehmen geruhte. Immerhin konnte ich letzteren entnehmen, dass ich nicht als einziger unter Verständnisproblemen litt. Hin und wieder blitzten in ihnen Wissensstände auf, die mir gleichfalls verschlossen blieben. Der Versammlungsleiter hob kaum die Stimme. Allenfalls erlaubte er sich eine flapsige oder bissige Bemerkung, die einen hier und jetzt nicht zu vermittelnden Diskussionsstand durchschimmern ließ. Es war klar, dass er die Frager zu lächerlichen Ignoranten oder bösartigen Widersachern stempelte, was sie sich ohne weiteres gefallen ließen. Ich fühlte mich stellvertretend verstimmt und wandte mich an meine Begleiter. Sie nickten mir aufmunternd zu, ein wenig fragend, wie mir schien, als wollten sie wissen, was ich von der Chose hielte, obwohl ich als Nichtstudent selbstredend keine Stimme in dem Spiel besaß. Vermutlich kamen sie sich wie Verschwörer vor, die mich entgegen dem studentischen Comment hereingeschmuggelt hatten und nicht recht wussten, welche Strafe sie erwartete, falls diese Ungeheuerlichkeit aufflog.
Angesichts solcher Aussichten musste sich die Sache auch lohnen. Also begannen sie, stockend und im Duett, mir mit gesenkter, fast flüsternder Stimme die seit Jahren schwelende Fehde zwischen der gewählten Studentenschaft und der Universitätsverwaltung auseinanderzusetzen. Ich lauschte. Gern hätte ich, ebenso verschwörerisch, zurückgeflüstert: ›Ach du liebes bisschen!‹ Aber es schien mir aus irgendeinem Grunde nicht tunlich zu sein.
Man stritt über alles. Was einst Sachthemen waren, über die man sich nolens volens einigen musste, um den üblichen Betrieb zu gewährleisten, hatte sich, jedenfalls schien es mir so, ausnahmslos in einen Dschungel von Status- und Prestigeangelegenheiten verwandelt, aus dem es kein Entrinnen mehr gab.
- ―Das ist alles belanglos, was zählt, ist allein die Frage, ob wir diesmal so stark sind, dass wir sie abwählen können.
- ―Wer ist wir?
Schulterzucken.
- ―Gibt es eine Kandidatenliste?
Schulterzucken.
Das erschien mir merkwürdig. Eike eilte zur Hilfe.
- ―Gibt es, ja. Das Problem ist – er pausierte kurz, um das Problem reifen zu lassen –, die Kandidatenliste existiert, und zwar seit Jahren. Die Hälfte der Leute hat sich wahrscheinlich längst ins Berufsleben verabschiedet. Das macht aber nichts, es ist ganz egal.
- ―Opposition zwecklos?
- ―Sagen wir... sie dient einem hehren Zweck.
- ―Aber sie hat keine Chance?
- ―Das weiß man nicht. Jedenfalls nicht, solange die da vorn die Tagesordnung bestimmen.
- ―Dann muss man sie halt ändern.
- ―Noch so ein Scherz?
- ―Im Ernst.
- ―Also das Spiel geht so. Sie zögern jede Abstimmung hinaus, bis die meisten gegangen sind. Dann haben sie die Mehrheit.
- ―Und wenn es nicht klappt?
- ―Dann wird am nächsten Tag eine neue Veranstaltung anberaumt und die Abstimmung wiederholt.
- ―Bis sie die Mehrheit haben?
- ―Bis sie die Mehrheit haben.
Das war eine rationale Weise, den Willensbildungsprozess in der Studentenschaft voranzutreiben, vorausgesetzt, man ließ das eigene Gruppenwohl unmittelbar mit dem allgemeinen Interesse zusammenfallen. Zähigkeit, sagte ich mir, ist eine revolutionäre Tugend. Wüsste das Gros, was es wollte, statt ins nächste Kino zu streben, dann fiele das hier in sich zusammen. Andererseits ließ sich aus den Reden meiner Begleiter eine gewisse Erbitterung heraushören, mit der sie vielleicht nicht allein standen. Wie viele potentielle Rebellen mochte es geben? Wer mochte das sein? Nach und nach kamen mir die Stimmen da vorn dünn und gefährdet vor. Wer nicht aufhören kann, sinnierte ich, riskiert gewählt oder zusammengeschlagen zu werden. Aber das war eine eher abstrakte Überlegung, der es wohl doch an Hintergrund fehlte.
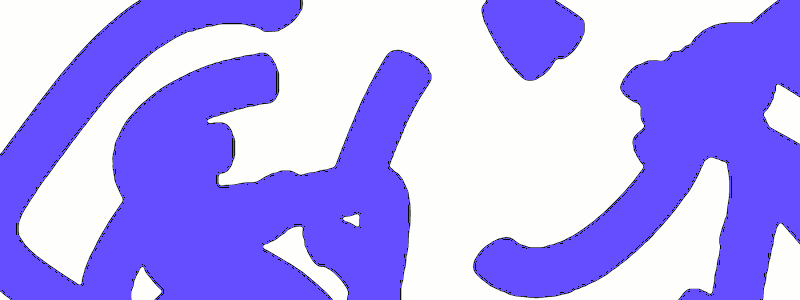
Große Fahrt
An diesem Abend, der nicht folgenlos blieb, auch wenn ich die Zusammenhänge nicht durchschaute – ein Rollkommando der Polizei kam zum Einsatz und ein Studentenwohnheim ging in Flammen auf, ohne dass ich den Abstimmungen, die spät stattfanden und durch einfaches Handaufheben entschieden wurden, etwas Einschlägiges angemerkt hätte –, an diesem Abend lernte ich, dass Prestige keine Angelegenheit selbstgefälliger Eliten darstellt oder derer, die ihnen, wie es heißt, ihren Beifall nicht versagen. Prestige entsteht nicht durch Erwählung, sondern durch Verwandlung. Was sich verwandelt und auf welchen Wegen die Verwandlung geschieht, bleibt nachgeordneter, vom gesellschaftlichen ›Umfeld‹ bestimmter Natur. Der Kern der Angelegenheit, die rituelle Versteifung, wird von den Inhalten wenig berührt. Gefragt sind Kämpfernaturen.
Die rituelle Versteifung verwandelt die Sache, für die einer kämpft, in ein Anwesen, das man als Außenstehender nur durch ein dichtes Gehölz von Anspielungen hindurch erspäht. Da gibt es Swimmingpools und verstreute Gebäude unterschiedlicher Größe und Bauart, dazu Patrouillen und jede Menge scharfe Hunde. Undeutlich lassen sich im Hintergrund Wachmannschaften und gepanzerte Fahrzeuge ausmachen. Das Anwesen ist eine kleine, funktionsfähige soziale Einheit, die einen starken Eindruck hervorruft. Fragt man allerdings nach dem Sinn der Anlage, so kommt man ins Grübeln. Zweifellos ist der Besitzer irgendein Boss, dessen Alltag man sich fern von dem reizenden Heim denken muss, das er sich hier geschaffen hat. Es steht bereit, ihn aufzunehmen, wenn seine vielfältigen Aktivitäten ihm eine flüchtige Anwesenheit gestatten. Eigentlich ist sie unnötig. Die erwartete, gefürchtete, in Erwartung des Endes ertragene Anwesenheit dessen, der hier das Sagen hat, ist, wie immer man die Verhältnisse interpretiert, der Ausnahmezustand. Sie zeigt nicht die Verhältnisse, wie sie sind. Eher zeigt sie die Ansprüche, die auf ihnen liegen. In der Regel wird über sie nicht gesprochen. Sie sind fühlbar, das muss genügen.
Was das bedeutet, wird verständlicher, wenn man zu Beispielen übergeht. Im gegenwärtigen Fall hatte die Idee der ›freien Association der Kräfte‹, die nach den Vorstellungen der revolutionären Klassiker an die Stelle hierarchischer Strukturen treten sollte, die Statur eines selbstverwalteten Studentenwohnheims angenommen. ›Selbstverwaltung‹ hieß in der Praxis Dauerfehde mit Universitäts- und Stadtverwaltung. Das war nicht weiter verwunderlich, weil letztere für den repressiven Apparat standen, der zerschlagen werden musste, wenn die Utopie Platz greifen sollte. Der Gedanke stand sonnenklar in allen beteiligten Gemütern und wurde allenfalls von stochernden Journalisten vernebelt, die das hier gut fanden und wieder verschwunden waren, wenn der zermürbende Gruppenalltag seinen Gang ging. Das fortschrittliche Bewusstsein hatte dem ›atomisierten‹ und ›depravierten‹ bürgerlichen Subjekt das Recht auf Autonomie entzogen und hin zur freien Assoziation politisch motivierter Kämpfernaturen verschoben. Diese Leute prügelten sich gern und ausgiebig mit der Polizei, die, als handle es sich darum, Asterix bei den Römern nachzuspielen, immer häufiger in Helm und Schild antrat, um die Einhaltung sogenannter sanitärer Mindeststandards durchzusetzen. Die Stadt sprach, wahrscheinlich in gezielter Übertreibung, von ›unhaltbaren Zuständen‹, sogar von Seuchengefahr in dem äußerlich ansehnlichen, etwas heruntergekommen wirkenden Gebäude, dessen misstrauische Bewohner jede unerbetene Besichtigung durch ein gestaffeltes System von Sicherheitsvorkehrungen zu verhindern wussten. Hin und wieder hörte man die Geschichte einer Studentin, möglicherweise immer derselben, die mit Decke und Rucksack das Weite gesucht hatte, weil sie es angeblich nicht mehr aushielt. Offenbar war das sanitäre Argument nicht ganz aus der Luft gegriffen. Die gezielt gestreute Vorstellung überlaufender Toiletten ist zwar immer geeignet, die Phantasie zu beschäftigen, aber die Argumentation der Besetzer blieb in diesem Punkt seltsam schwankend. Sie gaben die Schuld an dem, was sie energisch bestritten, der Behörde, die angeblich ›aktiv‹ die Verrottung des Gebäudes betrieb.
Dass ich mit Hiero anfangs kaum ins Gespräch kam, lag an einer einfachen, aber wirkungsvollen Sperre: mit Fremden tat er sich schwer. Nicht in Gedanken (da nun wirklich nicht), auch nicht in seiner Phantasie – wie ich bald merken sollte, hatte sie ihn ins Zentrum einer von bedeutenden und skurrilen Persönlichkeiten unterschiedlichster Herkunft bevölkerten Welt gestellt –, wohl aber im ›alltäglichen Umgang‹, wie die Umgangssprache das nicht ohne Herablassung nennt. Zog man mögliche Prägungen durch die frühen Jahre ab, so lag der Grund auf der Hand. Zu Zeiten, die Hiero nicht mit der Lektüre philosophischer Texte zubrachte, regte sich in ihm das Bedürfnis, über das Gelesene nachzudenken oder, falls er sich zufällig in Gesellschaft befand, darüber zu reden. Unwillkürlich suchte er daher die Nähe von Personen, von denen er wusste oder annahm, dass seine Sätze in ihnen einen Widerhall finden würden. Der mochte ausfallen, wie er wollte, stark und energisch oder schwach und einfallslos – er war genehm. In diesem Punkt gab er sich nicht wählerisch, sondern weltoffen: wer bereit schien, sich seiner Führung anzuvertrauen, konnte sicher sein, dass sich früher oder später eine Informationsflut über ihn ergoss, die an den Grenzen allgemeiner Belehrung über Personen und Theorien keineswegs Halt machte, sich vielmehr zügig in Ableitungen und komplizierte Beweisgänge hinein verlängerte, so dass die Stunden sich einerseits ins Endlose dehnten, andererseits im Fluge vergingen.
Das berichtete mir jedenfalls, wenn auch zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, eine gemeinsame Bekannte, die, selbst der Philosophie nicht unkundig, während einer Autobahnfahrt eine ausgedehnte Inspektion der Husserlschen Phänomenologie erleben durfte. Selbstverständlich in kritischer Absicht, denn dass eine Theorie, nach der das Denken selbst in der Phänomenwahrnehmung wurzeln und aus ihr seine eigentümliche Struktur beziehen sollte, vor den Augen eines Geistes keine Gnade fand, der in Kants Zweistämmigkeitstheorem – hie Verstand, dort Sinnlichkeit, die Erkenntnis als mehr oder weniger wohlgeratenes Kind in der Mitten – nur Murks zu erkennen gewillt war, konnte vorausgesetzt werden. Dass sie ›leicht genervt‹ dem Wagen entstieg, rührte auch weniger vom Gegenstand der Unterhaltung her als vom maschinenhaften Ablauf der Belehrung, die sie erfahren hatte. Eine Beweiskette, darauf bestand Hiero, durfte an keiner Stelle unterbrochen werden. Das willkürliche Weglassen von Argumenten war ihm ein solches Gräuel, dass er manchmal aus einem Gespräch auf und davon ging, weil er es nicht mehr aushielt, wie leichtfertig Behauptungen aufgestellt und belegt wurden, deren sachliche Irrelevanz für jeden, der sich einigermaßen auskannte, auf der Hand lag.
Das wunderte die anderen, weil sie sahen, wie rasch er selbst sich verhakte und dann nur noch eifrig bemüht war, sie ans Kreuz monoton wiederkehrender Feststellungen zu nageln, deren Informationswert gegen Null tendierte und deren unausgesprochene Aufgabe offenbar darin bestand, den Fortgang des Gesprächs zu blockieren. Sie verstanden nicht, dass sich hier ein Lebensproblem anbahnte. Auch ich wollte nichts davon wissen. Stattdessen hatte ich eine Vision. Ich sah, wie in diesem Einzelgänger die revolutionäre Ungeduld jener Jahre sich gleichsam wütend auf einen unangefochtenen Wissensbereich konzentrierte – überdrüssig der Rhetorik der Revolte und des Geschreis der Kombattanten, auf den Grund ernüchtert vom Terror und das durch ihn erzeugte ›Umdenken‹ in der Gesellschaft. Seine Reden wandelten Wasser zu Wein, das lose Wissen der anderen zum Wissen seiner selbst, und es war gut. Nur so konnte es gelingen, rücksichtslos die Schmach zu tilgen, dass sich ein großes Lebensgefühl ohne weiteres in das Geschwätz und die haltlose Borniertheit mehr oder weniger geltungssüchtiger Subjekte, mit denen man privat nichts hätte zu tun haben wollen, und eine halb und halb im Schatten agierende, auf Gruppenprozesse und Gruppenegoismen setzende Gesinnungskumpanei aufgelöst hatte. Was die anderen als puren Starrsinn betrachteten und belustigt hinnahmen, nahm für mich die Form der Unnachsichtigkeit an, die einer zur Purgation entschlossenen Geisteshaltung notwendig innewohnt.
Ich hatte ihn, wie sie meinten, ›noch nicht erlebt‹. Das war richtig, aber einmal zugegeben verschob es das Wahrnehmungsraster nicht unwesentlich: Hiero, das hieß es, war einer, der gelegentlich ausrastete. Damit musste man leben. Nun hatte ich zwar in jener Nacht, in der ich mit ihm den Pfau verlassen hatte, um eine unerträglich gewordene Situation aufzulösen und um ihn, wenn möglich, zu beruhigen, etwas in dieser Art erlebt. Aber ich hatte es anders empfunden. Offenkundig hatten ihn, obwohl er als Angreifer auftrat, Pws Bemerkungen verwirrt und er war in dem Bemühen, einen für alle gangbaren Weg ins Freie zu weisen, zu weit gegangen. Mein eigenes Bemühen fiel mir ein, es Elisabeth recht zu machen und dadurch unser Verhältnis zu retten. Mir schien, ebenso wie ich seinerzeit hatte auch er sich in sich selbst verheddert und damit zu dem Sündenbock gemacht, den er als Interpretationsfigur so gern ins Gespräch brachte.
Natürlich war über ihn geredet worden, nachdem wir im Dunkeln verschwunden waren. Wahrscheinlich hatte Pw, gewohnt, ihm bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen, hoheitsvoll dazu geschwiegen. In diesem Punkt blieb Hiero merkwürdig naiv. Er wollte nicht wahrhaben, dass er wie jedermann im Trommelfeuer der Urteile stand, die andere über ihn fällten. Er wollte als einer der ihren durchgehen, das war alles und gerade das wurde ihm verwehrt. Er wollte sich nicht unterscheiden. Währenddessen nahm er jede Gelegenheit wahr, das, was ihn von den anderen trennte, polternd in den Raum zu stellen. Das war paradox und es gab einen Vorgeschmack dessen, was er vermutlich im Sinn hatte, als er sich Jahre später zu der Aussage verstieg: Außerhalb der Wissenschaft habe ich keine Stimme. Noch war es nicht so weit. Immerhin hätte es vorausgesetzt, dass seine Stimme innerhalb der Wissenschaft etwas galt. Davon konnte bislang nicht die Rede sein.
Eigentlich hätte er die Voraussetzung ablehnen müssen. Sie war zwar psychologisch plausibel, aber nicht logisch zwingend. Doch in diesem Fall machte er eine Ausnahme. Daher fehlte ihm der ›Stand‹, der es ihm erlaubt hätte, Personen wie mir in freier Sprache zu begegnen. Wäre er bereits Professor gewesen, so hätte er mich wohlwollend angeblickt und meine vermuteten Defizite mit einem Lächeln à la ›Heute abend findet keine Prüfung mehr statt‹ vom Tisch gewischt. Aber der Schwebezustand zwischen dem Dasein eines einfachen Studenten und dem eines Doktoranden stellte ihm kein geeignetes Verhaltensmuster zur Verfügung. So begnügte er sich damit, freundlich, aber ausweichend zu antworten, wenn ich einmal das Wort an ihn richtete, und sich möglichst unauffällig aus meinem Aktionsradius zu entfernen. Ein anderer hätte ihn aufgrund dieses Verhaltens vielleicht für ›schwierig‹ gehalten. Ich hingegen hatte die Empfindung, die fremdelnde Hülle mit ein, zwei Sätzen durchstoßen zu können – unter einer Voraussetzung: dass ich es ebenso offen und ehrlich mit ihm meinte wie er mit der Philosophie. Das wollte überlegt sein.
Die altadelige Bereitschaft, für eine Sache, falls nötig, mit dem eigenen Leben einzustehen, genießt in modernen Gesellschaften kein besonderes Ansehen. Doch besteht weiterhin das Bedürfnis, das Leben in die Schanze zu schlagen. Was also tun? Hiero, der gern aus innerster Überzeugung, auch mehrfach, für die Philosophie gestorben wäre, hätten die herrschenden Auffassungen das gut geheißen, brannte stattdessen auf das exquisite Vergnügen einer Weltumseglung auf eigene Faust: ohne Skipper, auf sich allein gestellt wie jene schmächtige Japanerin, die ihm nun leider, leider zuvorgekommen war. Er würde damit zwar nichts beweisen können, aber er hätte dem stumpfen Frondienst an der Alltäglichkeit, Dasein geheißen, gezeigt, was eine Harke ist, und ihn damit auf eine höhere Stufe gehoben. Als Erbe verfügte er über genügend Barschaft, um sich das Abenteuer leisten zu können. Nur die Rücksicht auf seine Mutter verbot ihm vorerst, dem Unternehmen näherzutreten. Das war auch gut so, denn dadurch kam er nicht in Versuchung, die längst gefallene Entscheidung für die Philosophie als Beruf durch Herumtrödeln auf den Ozeanen zu verunklaren und eventuell in Gefahr zu bringen. Es gab noch kein satellitengestütztes Navigationssystem für Privatleute und die Sache kam mir ein wenig gefährlich vor. Er schien meine Bedenken zu genießen.
- ―Das ist der irrationale Rest, meinetwegen, warum denn nicht? Warum denn nicht? Das Meer ist nicht logisch, es ist nicht unlogisch, es ist das Meer. Was soll ich dazu sagen? Ich bin kein Poet, Proust würde das sicher anders ausdrücken, leider kann man ihn nicht mehr fragen.
- ―Aber ist es nicht so, dass das Meer bloß eine Metapher –
- ―Kommen Sie mir nicht mit Psychologie. Bitte das nicht. Wenn Sie am Meer aufgewachsen wären, würden Sie nicht so reden. Dann wäre Ihnen das alles – durchsichtig, das kann man nicht anders ... sagen. Hier auf dem platten Land muss man alles erklären. Warum? Ich wollte, wir wären nicht hier und ich könnte es Ihnen zeigen...
Die Rede zog ihn fort und ich, der ich die Seelage vor nicht allzu langer Zeit selbst frequentiert hatte, verführt, was er nicht wissen konnte, von dem, der zufällig, abseits der Seminarhierarchien, sein wirklicher Lehrer war und sich gerade jetzt anschickte, sein Lebensschiffchen unter Wind zu setzen – denn auch mit Tronkas Habilitation wurde es in diesen Tagen Ernst –, nickte bedächtig dazu und versuchte, meiner Stimme einen Anflug von Ironie zu verleihen.
- ―Man gerät leicht an die Philosophie da draußen...
- ―Überhaupt nicht. Wer hat Ihnen denn diesen Blödsinn beigebracht?... Aach, ich verstehe. Vergessen Sie es. Tronka ist eine Landratte.
Leviathan contra Behemoth. Langfristig zeichnete sich hier ein Konflikt ab.
›Vergessen Sie es...‹ Die Sentenz kam mir bekannt vor. Hiero war auf Tronka geprägt. Anders als dessen Verhältnis zu Leckebusch, das von subtilen Bezugslinien bestimmt wurde und sich erst dem Röntgenblick des Analytikers offenbarte, lag dieses hier offen zutage. Hiero war ein Gefolgsmann. Daran ließen weder die Seminarberichte, die mich aus dem Munde Pws erreichten, noch gelegentliche Anzüglichkeiten aus dem Munde Antons oder Eikes Zweifel aufkommen. Es schien sich um eine langwierige, nichtsdestoweniger prestigefördernde Krankheit zu handeln, entfernt einem Liebesverhältnis vergleichbar – nichts besonders Erstrebenswertes also, außer dass etwas wie Neid ins Spiel kam, sobald es Hiero einfiel, eine klassische Zweifelsbetrachtung aufzulegen, aus Lust am Argument und aus Freude an der Provokation, aber in jedem Satz einem schülerhaften ›So‑wird’s‑gemacht‹ verpflichtet, das dem anderen sauer aufstieß, auch wenn er kein anderes Mittel dagegen fand als Ironie und Sarkasmus.
Wie man’s machte, darüber gaben die Texte Auskunft, über die Tronka und Hiero sich mit gleichem Ernste beugten, wenn sie ›zur Sache‹ kamen. Diese Texte waren durchaus nicht mit denen identisch, die ich auf Tronkas Rat hin mit auf die Insel genommen hatte. Genau genommen waren sie, sofern ich die beiden richtig verstand, nicht einmal mit sich selbst identisch.
- ―Welche Auflage meinen Sie denn?
- ―Ist das wichtig?
- ―Wichtig? Ich würde sagen, es macht den schlechthinnigen Unterschied.
Verstand ich richtig, so ging die Rede von Erst-, Zweit- und Drittauflagen – Versionen ein und desselben Werks, die sich in der ›Faktur‹ und selbst im ›theoretischen Anspruch‹ grundlegend voneinander unterschieden.
›Grundlegend‹ sagte Hiero. Noch lebt die Stimme in meinem Ohr. Er gebrauchte auch all die anderen Wörter, während er sich eine Zigarette drehte. Mir schien, dass das auffällige Zittern seiner Hände in solchen Momenten zum Erliegen kam. Als einziger im Kreis drehte er seine Zigaretten selbst, vielleicht, um die zitternden Finger zu kontrollieren, vielleicht, weil er sich damit ein Western-Emblem ansteckte, so wie Pw, dem die anderen eine Ähnlichkeit mit John Wayne nachsagten, mehr oder weniger unwillkürlich dessen Gang imitierte, auch wenn er sich persönlich aus Humphrey Bogart – oder war es doch Humbert Humbert? – ›mehr machte‹.
Filmgesten zu zitieren, gehörte zum Auftritt und wurde von allen sorgsam gepflegt, um sich ein Aussehen zu geben und die eigene Persönlichkeit herauszustreichen. Das entsprach einer Praxis, der man auf der Straße überall begegnete, wenn man davon absah, dass dort in der Mehrzahl der Fälle das Fernsehen den Ton angab. Selbstverständlich durfte man gerade davon nicht absehen, das hätte ja geheißen, den einen grundlegenden Unterschied zu missachten, der einen vom konsumierenden Haufen trennte. Der zweite bestand darin, dass Filme wie Casablanca oder High Noon einer bereits vergangenen Popularkultur angehörten, also ›historisch‹ waren und daher von vornherein den elitären Blick verlangten, um als die Klassiker gesehen zu werden, für die sie zweifellos, bei Strafe des Banausentums, gehalten werden mussten.
Das war sogar praktisch, da sie häufig im Spätprogramm der staatlichen Sender liefen. Man konnte daher seine Abneigung gegen das ordinäre Medium Fernsehen pflegen, ohne einen Fuß vor die Haustür zu setzen. Auch hier erwies sich Pw, der nicht gern ins Kino ging – vermutlich, weil er sein Geld lieber in ein gutes westfälisches Pils verwandelte –, als Meister der geselligen Verwertung. Die ›kleinen Gesten‹, die er in den Filmen aufspürte, dienten hauptsächlich dazu, seine Kennerschaft in Bezug auf alles wahrhaft Klassische einerseits und, andererseits, das Leben der Distinguierten zu dokumentieren, zu denen er sich unauffällig selbst zählte. Finde die Nuance und Sei den anderen stets einen winzigen Schritt voraus: offenkundig lauteten so die ererbten oder in komplizierten Ablösungsprozessen angeeigneten Devisen, die er den Mitgliedern des Kreises gegenüber rücksichtslos exekutierte. Hieros Selbstgedrehte betrachtete er mit dem wohlgefälligen Blick des Mentors, sagte nur Rio Bravo und richtete den Blick ins Weite, während Hiero betreten den Fußboden absuchte. Das erhärtete natürlich den Verdacht, Hiero habe seinen kleinen Test einem wackeren Leinwand-Alkoholiker abgeschaut. Auch ich fasste die Episode anfangs so auf. Irgendwann durchschaute ich die Strategie der gezielten Denunziation, mit der Pw seine Umgebung überzog. Sie sollte sich selbst in seinen wissenschaftlichen Arbeiten als wirksam erweisen. Dort allerdings wurden andere Mechanismen wirksam und der Erfolgsfaden riss abrupt ab.
Seit ich Hiero besser kennen lernte, begriff ich langsam, wie hilflos er solchen Frotzeleien ausgeliefert war. Seine Erregbarkeit bestimmte ihn zum idealen Opfer und Pw stand nicht an, sie zu stimulieren, wann immer beide in meiner Gegenwart aufeinander stießen. Ein ruhiger Konter war von Hiero nicht zu erwarten, das betreten wirkende Schweigen, das ihn in den Augen der anderen ›schuldig‹ sprach, bezeugte den Grad der Selbstbeherrschung, dessen er fähig war. Wie viele Menschen praktizierte er die Technik des Vorbeigehenlassens, mit deren Hilfe sie sich unsichtbar zu machen glauben, während sie den anderen dadurch gerade sichtbar werden. Auch Pw war gegen diesen Irrtum nicht gefeit, wie sich eines Tages zeigte, als Hiero ihm, völlig überraschend, die neuerdings alle bewegende Frage stellte:
- ―Und was machst du, wenn sie dich nicht nehmen?
Hätte er gefragt: ›... wenn dich keiner nimmt?‹, so hätte er damit das übliche Karrierethema angesprochen. Diese Frage hier war perfider, sie zielte unmittelbar auf die Gelassenheit dieser jungen Leute, die sich bisher in der Sicherheit wiegen konnten, nach Ausbildung und Referendariat auf alle Fälle vom Staat übernommen zu werden. Damit war es neuerdings vorbei.
Fräulein Portiönchen, wie die anderen sie gutmütig nannten, hatte gerade das Wort an mich gerichtet; jetzt wanderten ihre hellen Äuglein hinüber zu Pw und ich merkte, dass ich mir die Antwort schenken konnte. Ihre allzu hörbare Stimme besaß einen hohlen Beiklang, wie ein falsch geblasenes Horn, was sich mit dem knatternden Grundton zusammen nicht übel, aber immer ein wenig ›nervig‹ anhörte, obwohl sie auch besinnliche Momente kannte.
- ―Ja, Herr Wichterich, das würde mich auch interessieren.
Sie sprach, absolut unüblich, ihre männliche Umgebung konsequent mit ›Herr‹ an, zitierte sie am Nachnamen herbei und hieß sie so förmlich Rede und Antwort stehen. Vermutlich hatte sie sich damit die eigene Anrede eingefangen. Pw, der mit Vornamen Peter hieß, ein Unding in jenen Jahren, unaussprechbar, kostete von dem Pils, das ihm die Bedienung frisch hingestellt hatte. Das Resultat schien nicht überwältigend. Seine Braue zuckte, die Lippe kräuselte und glättete sich in einer durchlaufenden Bewegung.
- ―Tja –
Kein sonorer Klang konnte die Ratlosigkeit in dieser Antwort verdecken. Doch Hiero, vom Erfolg überwältigt, zerstörte ihn im Nachsetzen.
- ―Tja. Dann bist du nämlich, entschuldige, wenn ich das so sage, im Arsch.
Pw schaltete auf Angriff.
- ―Wenn ich im Arsch bin, wie du dich auszudrücken beliebst – ich dachte, wir gingen hier etwas anders miteinander um –, dann geht es mir, würde ich mal sagen, immer noch deutlich besser als dir.
- ―Und warum bitte?
Hieros Rede troff von falschem Hohn. Er hinkte dem Stand der Dinge bereits hoffnungslos hinterher.
- ―Weil ich... nicht so korrupt bin. Ich kann mein Leben überall leben, ich brauche dazu keine Anerkennung.
- ―Keine Anerkennung, was ist das denn? Jeder braucht Anerkennung. Das wissen doch die Hühner.
Pw brachte tatsächlich ein Beben in seiner geräumigen Stimme unter:
- ―Die vielleicht. Da magst du recht haben. Unter vernünftigen Leuten sieht die Sache ein wenig anders aus.
- ―Was willst du damit sagen?
- ―Wäre ich so korrupt wie die andern, dann wüsste ich, was ich dir antworten würde. So sage ich nur: Spar dir deine Fragen. Es bringt nichts, hörst du... das bringt alles nichts. Eliot würde sagen...
- ―Eliot? Eliot? Höre ich recht: Eliot? Sagtest du Eliot? Ich hör doch nicht recht. Lass diese Spielchen. Die Sache ist ernst.
- ―Sag ich doch.
- ―Und warum sollen gerade die anderen korrupt sein?
- ―Das muss ich dir doch nicht erklären, oder?
- ―Mag sein. Aber ich bin nicht korrupt.
- ―Sicher? Na dann wollen wir mal anfangen.
Atemlos hatte Portiönchen den Wortwechsel verfolgt, die Augen unverwandt auf Pw gerichtet. Hier schaltete sie sich ein.
- ―Was ich schon immer wissen wollte, Herr Wichterich: –
- ―Sag mal, Mechtel, kannst du mir diese Stelle bei Valéry kopieren, von der du neulich geredet hast? Das würde mich nämlich ernsthaft...
- ―Lenken Sie bitte nicht ab, Herr Wichterich. Ich möchte Sie fragen, ob Sie sich im Klaren darüber sind, was Sie gerade gesagt haben...
- ―Ja, völlig.
- ―Umso besser. Aber dann verstehe ich nicht, warum Sie uns neulich diese Geschichte von dem kleinen Jungen zum Besten gegeben haben, der...
- ―Welcher kleine Junge? Was ist das für eine Geschichte?
- ―Ich hätte mir natürlich denken können, dass Ihre werte Person nicht in Geschichten vorkommt, die von kleinen Jungs handeln. Na, ist egal.
- ―Also Mechtel...
- ―Sieh an. Lassen Sie das, Herr Wichterich. Mechtel gibt immerhin zu, einmal als kleines Mädchen unter diesem Namen existiert zu haben. Von den Herren ist soviel Ehrlichkeit natürlich nicht zu erwarten.
Da waren sie, die ›Herren‹, mit denen Fräulein Portiönchen – ›Mechtel‹, wie Pw sie hin und wieder nannte – die Runde traktierte. Das Wort kam nicht aggressiv aus ihrem Mund, es entschlüpfte ihr auch nicht, es troff nicht einmal von Ironie, aber ... lustig wirkte es auch nicht, das schon gar nicht, es zeigte den Angesprochenen, wie leicht man an peinliche Differenzen erinnert werden konnte, und so kamen sie sich in einem Zug denunziert und geehrt vor, als erinnere diese junge Frau sie daran, welche Bürde sie von Geschlechts wegen vor der Geschichte und der Zukunft dieses Landes trugen.
Hiero hielt es nicht länger aus.
- ―Komm schon, Pw, natürlich hast du uns deine Kleinejungengeschichte erzählt, ich war schließlich Zeuge. Ist doch nichts Schlimmes dran, oder? Das wollen wir jedenfalls hoffen. Also raus mit der Sprache.
Pw räusperte sich, die Tentakel züngelten.
- ―Ich kann mich an keine Kleinejungengeschichten erinnern. Was soll das jetzt überhaupt? Ist das ein Examen oder was? Da seid ihr mir die Richtigen. Ich muss auch gleich gehen. Lexa, zahlen!
- ―Sehen Sie, Herr Wichterich, das wars, was ich meinte. Sie sind immer so schnell durch mit den Sachen, dass man sich hinterher fragt, wie Sie das gemacht haben.
- ―Was willst du damit sagen? Hört sich nach Taschenspielertricks an oder so. Willst du das damit sagen?
- ―Du machst es einem schwer. Aber jetzt mal ohne Scheiß: Kannst du mir sagen, wie ein Mensch ohne Anerkennung überhaupt existieren soll?
- ―Phänomenologie des Geistes, Teil B, Kapitel vier, schnarrte Hiero dazwischen. ›Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl... seeehr wohl als Person anerkannt werden, aber es hat die Wahrheit‹ – Wahrheit, Pw, Wahrheit! – ›dieses Anerkanntseins als eines selbständigen Selbstbewusstseins nicht erreicht.‹
- ―Jetzt mach mal halblang, erregte sich Anton, der Hegel nicht ausstehen konnte und das Zitat, wie alle sehen konnten, abscheulich fand. Er hatte lange geschwiegen und fand es an der Zeit, diesen unbefriedigenden Zustand zu beenden. Pw fühlte sich um seine Antwort gebracht und ging auf Gegenkurs.
- ―Wo er recht hat, da hat er recht.
Ob das auf Hegel oder auf Hiero zielte, war nicht zu erkennen. Pw dachte gar nicht daran, den Knoten aufzulösen.
- ―Dann muss es aber auch das Leben sein. Richtig, mit Blut und allem.
- ―Und was wird damit bewiesen? Stell dir vor, du gehst hin und verreckst. Wo bleibt dann die Anerkennung?
- ―Ganz richtig. Dann bist du im Arsch.
Das konnte Hiero nicht so stehen lassen.
- ―Anerkennung gibts natürlich für den, der überlebt. Das ist doch klar.
Pw, der in Antons Richtung gesprochen hatte, drehte, langsam, langsam, den Kopf zu Hiero hin. Sein Blick fiel wie ein Richtschwert.
- ―Von den Toten, willst du sagen? Willst du das wirklich sagen? Willst du so weit gehen? Na gut, wir haben es gehört. Ich sage nur: Hut ab! Das nenne ich konsequent. Unter uns Pastorentöchtern ... ein wenig irre ist das schon, oder? Aber: Hut ab!
- ―Die Herren lieben es wieder extrem.
- ―Na klar, wie denn sonst?
Ausgerechnet Hiero, erblasst und merkwürdig zittrig, musste das sagen.
Fräulein Portiönchen hielt sich nicht bei ihm auf. Sie steuerte anderen Zielen entgegen.
- ―Nach meiner Auffassung begeht ihr alle einen Fehler.
- ―Da sind wir aber gespannt.
- ―In diesem Fall meine ich es durchaus ernst. Es ist nicht lustig, wenn man dauernd unterbrochen wird. Das hat auch etwas mit Anerkennung zu tun, zumindest mit fehlender, aber lassen wir das. Wenn ich jemanden anerkenne, dann meine ich es ernst. Darin steckt zum Beispiel schon ein Stück Kritik. Aber das pflegt in diesem Kreis ja nicht so rüberzukommen. Habe ich mich jetzt klar ausgedrückt? Das ist auch so etwas, worüber man einmal nachdenken könnte...
Ich war mir nicht sicher, worauf sie hinauswollte. Einen leisen Verdacht hegte ich schon. Mit ihrer Kritik an dem, was man das Insider-Gebaren der ›Herren‹ nennen konnte, stand sie nicht allein. Die Liste der abgewiesenen, respektive ausgebissenen Kommilitonen schien lang zu sein, auch wenn die Anspielungen auf den einen oder anderen Abgang von einem Augenzwinkern begleitet wurden und dazu bestimmt waren, mich zu beeindrucken. Man hatte mich an-, wenngleich nicht aufgenommen. Angesichts meines Alters und meines abweichenden Status fand ich das nicht weiter verwunderlich. Schließlich war ich kein Student. Fräulein Portiönchen wiederum – ob vor biblischen Zeiten oder drei Wochen, war nicht zu ergründen, die Wunde jedenfalls glänzte frisch wie am ersten Tag – hatte den Fauxpas begangen, einen Freund anzuschleppen, den der Kreis nicht vorher abgesegnet hatte. Ein netter Kerl im Grunde, aber darin lag bereits das Vergehen.
Selbst der Name schien gegen ihn zu zeugen. Hans-Hajo ließ lange Gesprächsperioden verstreichen, ohne sich zu Wort zu melden. Man hätte argwöhnen können, er kämme in Gedanken sein langes, gewelltes Blondhaar, wäre da nicht dieser seltsam fragende Ausdruck gewesen, den die Natur seinem Gesicht eingeprägt hatte, ohne dass er daran beteiligt gewesen oder gar gefragt worden wäre.
Besonders bissig reagierte Hiero. Mehr als einmal fuhr er ihn aus dem Stand heraus an:
- ―Und was sagst du dazu?
Hans-Hajo schreckte zusammen. Er kramte seine Stimme aus diversen Abwesenheiten hervor wie ein anderer die Fahrzeugpapiere bei einer unvermuteten Polizeikontrolle und krächzte: Ich, ich... ja, ja sicher...
Hiero ließ nicht locker.
- ―Das kann doch nicht wahr sein. Du musst doch etwas zu sagen haben.
- ―Ja, sicher.
Hans-Hajo ›musste‹ nichts zu sagen haben, er hatte auch nichts zu sagen, jedenfalls nichts, was er dieser Runde anzuvertrauen gedachte. Soviel hatte sich nach und nach ergeben. Aber er saß dabei, steckte jede Kränkung weg und duldete es, dass er, anders als ich, zwar auf-, aber nicht angenommen wurde. So sah es aus. Für Fräulein Portiönchen ergab sich daraus die knifflige Lage. Sie musste jetzt bei Bedarf rochieren und ihre Schlagfertigkeit an Stellen einsetzen, an denen seine gefragt war, ohne geradezu an seiner Stelle zu antworten, was ihn auch in ihren Augen herabgesetzt und nur den Hohn der anderen hervorgerufen hätte.
Dass ihr beim Thema Anerkennung Hans-Hajo auf der Seele lag, ergab sich also quasi von selbst. Aber falls es ihr darum ging, reinen Tisch zu machen, so hatte sie den Zeitpunkt ausgesprochen schlecht gewählt. Pw, im triumphalen Besitz der stoischen Maxime ›Glücklich ist, wer sich entziehen kann‹, noch ohne Kenntnis der Fallstricke, die das Leben für die bereithält, die ihr Folge leisten, spendete Hiero offenen Hohn. Beide waren zu sehr darauf erpicht, sich keine Blöße zu geben, um zu bemerken, aus welcher Richtung das Sperrfeuer kam. Hiero, der ein vergleichsweise riesiges Rückzugsgebiet sein eigen nannte, war sich in puncto Entzug auf einmal gar nicht so sicher. Gerade in der Kleinstadt hatten sich die Mechanismen der Anerkennung schon früh als allerorts wirksam erwiesen. Unmöglich schien es, ohne Titel und das Übrige zurückzukehren, ohne sich der Missachtung und schlimmer, der falschen Schonung durch Menschen auszusetzen, die von Kindesbeinen an einen Anspruch auf ihn zu haben glaubten.
Auf dieses rigide Regime baute übrigens Pw. Listig erwog er die Möglichkeit, sich nach erfolgter Promotion auf einer Ostseeinsel niederzulassen, Fehmarn zum Beispiel, wo der Wind nicht so abartig wie an der Westküste blies und einen noch niemand kannte. Einige Wochen früher wäre dies als das übliche Gerede durchgegangen, doch der Wind hatte gedreht. Quasi im Stillen, an den anderen vorbei, hatte Pw das Examen absolviert und ›schrieb‹ bereits zügig, wiewohl ausschließlich in den Nachtstunden, die Doktorarbeit ›herunter‹, nach einem Zeitplan, der sorgfältig auf seine Finanzmittel abgestimmt war, so dass der Bedarf an Alkoholica nach menschlichem Ermessen bis zum Schluss nicht darunter zu leiden hatte. Das stattete ihn im Hinblick auf kommende Lebensführung mit einer Autorität aus, der Hiero, durch seine anhaltende Untätigkeit gehandicapt, wenig entgegenzusetzen hatte. Im Grunde hätte er die stoische Linie fahren müssen. Dass er es nicht tat, zeigte den anderen auf eine naive und fast schon provokative Weise, dass sein Ehrgeiz höher zielte und der Titel für ihn nicht den Abschluss des Studiums, sondern den Einstieg in die universitäre Laufbahn symbolisierte. Umso seltsamer musste ihnen dieses Auf-der-Stelle-Treten erscheinen, das er nur unwillig und wenig überzeugend zu begründen unternahm, wenn man ihm zu sehr auf die Pelle rückte.
Fräulein Portiönchen ließ nicht locker.
- ―Sie wollen also ihr Leben als Schulmeister auf der Insel Fehmarn beschließen, Herr Wichterich.
- ―Hoho. Von ›beschließen‹ war bisher nicht die Rede.
- ―Also gestalten. Das hört sich ja gut an. Mich dauern nur die armen Kinder, denen Sie etwas beibringen sollen.
Pw gab sich amüsiert. In Wirklichkeit hatte sie ins Schwarze getroffen. In welchem Ausmaß, das konnten weder sie noch die anderen zu dieser Stunde wissen. Es lag im dunklen Rat der Göttin beschlossen, von dem manche zu wissen glauben, er gleiche einem Schoß, dass ein frustrierter Pw, nachdem alle Züge in Richtung Universität abgefahren waren, mit einer Verbissenheit, die man sich bei ihm zur Stunde nicht vorstellen konnte, an seiner wissenschaftlichen Reputation bastelte – ein vollkommen zweckloses und sogar, wenn man die Auswirkungen auf die Nahumgebung einbezog, heillos zu nennendes Unterfangen, für das selbstredend vor allem die jungen Leute zu büßen hatten, die ihm der Gang des Schicksals in die Klassenräume schickte. Besagter Hans-Hajo hingegen, der bereits als Aushilfslehrer an einer Privatschule arbeitete, stand, ohne davon das Geringste auszustrahlen, im Begriff, den entgegengesetzten Weg zu gehen und sich über Auslandseinsätze, in deren Verlauf bei ihm so etwas wie eine natürliche Autorität sichtbar wurde, asymptotisch dem wissenschaftlichen Herd anzunähern.
Hier und heute nützte ihm das gar nichts.
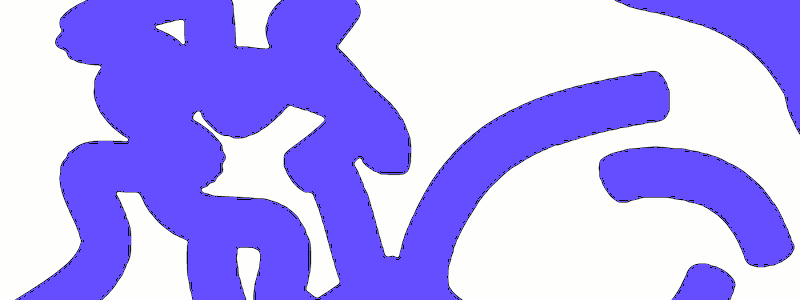
Techtelmechtel
Auch nicht bei Portiönchen, die ihm ihre unbestrittene Geistesgegenwart und einen trockenen, etwas mickrigen Charme zur Verfügung stellte. Auch sie hatte schließlich etwas anderes erwartet. Ihr ganzes Verhalten war darauf ausgerichtet, die negative Aura des Partners im Kreis der anderen zum Verschwinden zu bringen. Und wie es der Zufall wollte, gab sie sich mit dieser Rolle ein Innenleben, das keiner bei ihr vermutet hatte, ehe Hans-Hajo in den Dunstkreis der Gruppe getreten war. Denn Portiönchen, das hatte ich rasch begriffen, galt als zickig und ein wenig gemütsarm. Vielleicht war das sogar der Grund, dass sie in der Männergruppe mitlief. Ihre Nummer bot wenig Überraschungen, aber da sie klug und beschlagen war, weckte die etwas sture Art, in der sie ihre Einsprüche zelebrierte, keinerlei Überdruss. Sperrig, das war sie, aber es gab niemanden in der Runde, der das Prädikat nicht auch für sich in Anspruch genommen hätte. Insofern war sie, alles in allem, hier gut aufgehoben.
Was Hans-Hajo hielt, verstand niemand. Ein gewisser Masochismus schien im Hintergrund mitzuwirken. Nur der Vorteil, den Portiönchen daraus zog, lag auf der Hand. Der stumme Gast war ein vitaler Bursche. Seit es ihn gab, kam die junge Frau auch für den Rest der Truppe in Betracht. Jeder Blick, der dem ungleichen Paar galt, endete in einer ›starken‹ Hypothese über ihr Sexualleben, die fast wie ein Vorwurf auf die anderen zurückfiel. ›Er ist nicht schlagfertig, er ist nicht geistesgegenwärtig, mag sein, er besitzt überhaupt keinen Geist, das ist durchaus möglich, auch wenn ich es immer bestreiten werde, aber allein, dass ihr so gemein zu ihm sein könnt, dass ihr es besinnungslos seid, zeigt mir zur Genüge, wie recht ich habe, wenn ich ihn in euer Spiel einführe und dafür sorge, dass ihr seiner Gegenwart nicht entkommt. Worin die besteht, muss ich nicht extra sagen, euer törichtes Gebaren zeigt mir, dass ihr mich gut verstanden habt, während ihr all die Zeit davor nichts verstanden habt. Dass ihr euch jetzt wie Kinder auf dem Pausenhof benehmen müsst, ist eure eigene Schuld. Seht, wie ihr aus der Patsche herauskommt. Helfen kann euch da keiner.‹ So etwa mochte die stumme Ansprache lauten, die von Portiönchen ausging, wenn sie, ihren Hans-Hajo im Blick, eine läppische Entgleisung mit nadelspitzen Anmerkungen zur Lage aufs Tablett hob.
Ganz stimmte das Argument nicht. Schließlich lag es an ihr, die Situation auflösen. Sie konnte dafür sorgen, dass Hans-Hajo den Kreis verließ, sie konnte selbst den Kreis oder auch Hans-Hajo verlassen, je nachdem, an welcher Seite ihr mehr lag. Vielleicht hätte sie auch eine Klärung in der Gruppe herbeiführen können, wozu es ohne Zweifel einer starken Persönlichkeit bedurft hätte. Das alles war in der Theorie richtig, aber in der Praxis besaßen die Dinge eine andere Farbe und Gestalt. Manches, das denkbar erschien, erwies sich einfach als undurchführbar, weil ein gewisser unübersehbarer Selbstbestrafungstrieb Hans-Hajo inzwischen in seine Rolle bannte. Jedenfalls dachte sie nicht im Traum daran, die von ihr schmallippig apostrophierten ›Herren‹ auch nur eine Zeitlang sich selbst zu überlassen. Wer konnte schon wissen, ob sie sich sonst damit begnügten, Dummheiten von sich zu geben statt sie zu begehen.
Es war schwach, was Pw da redete, aber irgendwie auch interessant. Es machte ihr schlagartig deutlich, dass Hans-Hajo, der zu ihrem stillen Verdruss nichts als Lehrer werden wollte, auch im Lehrerzimmer ›seinen Mann stehen musste‹, weil er selbst dort auf Konkurrenten stieß, die an die Stelle des schlichten Berufswunsches ein kompliziertes und, wie sie instinktiv verstand, ziemlich mieses Spiel gesetzt hatten. Lehrer zu werden bedeutete für Pw nicht, in einen Kreis einzutreten, in dessen Mittelpunkt die Ausbildung und ›Bildung‹ – man traf die Unterscheidung mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, die bedeutete, dass man das eine nicht restlos im anderen aufgehen lassen, aber wiederum auch keinerlei Aufhebens von einem etwaigen Unterschied machen wollte – der jungen Leute stand. Was es für ihn bedeutete, war nicht leicht zu erkunden, es war eine leere, aber staatlich gesicherte Form, die er, wenn es an der Zeit war, sich anzueignen gedachte, so wie einer das Auto einer gediegenen Mittelklasse-Marke zu fahren begehrt, weil Ausstattung und Fahrkomfort nichts zu wünschen übrig lassen, auch wenn die bieder distinguierte Ausstrahlung den Lachmuskel reizt. Sicher würde er, einem Piepel aus der trostlosen Rotte der Möchtegern-Porschefahrer vergleichbar, die das Fahren auf der Autobahn zu einer höllischen Angelegenheit machten, die Schule für die klammheimliche Befriedigung andersartiger Wünsche missbrauchen und sich damit in die lange Front der Pauker einreihen, an denen die Schüler ihr Mütchen kühlten, weil das untrügliche Gefühl junger Menschen, schikaniert zu werden, seit alters nach Kompensation ruft.
Andererseits – o dieses zwanghafte ›andererseits‹ – umgab ihn die Pose dessen, der sich bewusst für diesen Lebensweg entschieden hatte, mit einer Aura der Unabhängigkeit. Sie zeichnete ihn vor den anderen aus, die in einem eher undefinierten Ehrgeiz verharrten, und machte ihn irgendwie zum Mann. Zwar mochte man sich nicht sicher sein, dass er es mit seinem Entschluss ernst meinte. Darüber konnte nur die Zukunft aufklären. Er besaß das Geheimnis der Anerkennung, das Hans-Hajo so sehr zu schaffen machte, dass es sie heimlich, falls es in diesen Dingen überhaupt Heimlichkeit gab, zur Verzweiflung trieb.
Virilitätsposen, so bestimmte die Regel, besaßen eine Anziehungskraft, die nur im Tonfall des Darüberstehens und in Gestalt sarkastischer Kommentare angesprochen werden durfte. Das Genre war unstrittig, auch wenn seine Stoßrichtung gegenstandsbedingt eine gewisse Asymmetrie der Geschlechter beschwor. Pw, der es nicht für nötig befand, die freien Enden der Parabel vom anderen Leben wenigstens rhetorisch miteinander zu verbinden, lag hier im Vorteil. Während er darauf achtete, dass der freie Blick auf seine Männlichkeit durch keine dazwischengeschobenen Ladenhüter verstellt wurde, stand er jederzeit bereit, mit bedeutungsvoll gehobener Braue und beträchtlichem Timbre anzudeuten, dass er sich auf der Höhe des Geschlechterdiskurses befand und sich so seine Gedanken machte. Auch mit Portiönchen führte er gelegentlich solche Gespräche. Mehr als einmal riefen sie in ihr die unklare Empfindung hervor, sie könnte sich ebensogut auf den Soziussitz eines Motorrades schwingen, um als entführte Europa über die Abgründe der Gefahr auf Leben und Tod hinweg, in die sie der ›Herr‹ da verwickelte, die Macht ihres Geschlechts zu genießen. Ideologisch war das bedenklich, daran ließ sich nicht deuteln. Aber insofern diese Formel ohnehin nur zur Artikulation ironischer Distanz taugte, verharrten die Dinge in einer Schwebe, die sie lebbar erscheinen ließ.
Wie auch sonst? Kämpferisch stimmte sie eher der Anblick Hans-Hajos, dem seine Lammnatur nicht erlaubte, diese Dinge zu nehmen, wie sie eben lagen. Tagelang konnte er über einer Invektive gegen das eigene Geschlecht brüten, die er in Emma, der Apothekenzeitung der Neuen Weiblichkeit, aufgeschnappt hatte. Er blieb selbst dann unbelehrbar, wenn sie ihn mit sprühenden Blicken oder gelindem Lächeln aufforderte, er solle sein begrenztes Zeitkontingent gefälligst auf anspruchsvollere Lektüren verwenden. In seinem Bücherregal ruhten die Kritik der praktischen Vernunft und Emma gleich nebeneinander. Inbrünstig glaubte er, sie müssten sich eines Tages umarmen, um eine neue Wahrheit zu zeugen.
Das war naiv. Es lag schließlich auf der Hand, dass beide Seiten, die reiche Tradition transzendentalphilosophischer Ethik und das kaum weniger lange Nachdenken über die Emanzipation des weiblichen Geschlechts, schon seit längerem auf Techniken der künstlichen Befruchtung auswichen. Denkbar war alles, doch nichts darunter, was einen auch nur entfernt berührte. Warum sollten gerade sie sich näherkommen? Nicht dass Portiönchen den mild-utopischen Sinn ihres Partners abgelehnt hätte – ganz gewiss nicht, schließlich hatte er sie, im Verein mit gewissen Ansehnlichkeiten des Körperbaus, bewogen, dem Träger ihre Huld zu schenken. Aber es gab Gelegenheiten, bei denen er ihren Eigensinn zu Widerspruch und sogar Zorn reizte, den sie nach erfolgtem Ausbruch lebhaft bedauerte, von dem sie jedoch wusste, dass er sich bei der nächstbesten Gelegenheit wieder melden würde.
Woher dieser Zorn? Gute Frage, wie alle guten Fragen dieser Art nicht leicht zu beantworten. Gewiss kam er aus dem Zorn-Zentrum des Gehirns irgendwo in den Tiefen ihres limbischen Systems, ein eingeschlossener Unhold mit Anbindungsproblemen, dem die ganze Richtung nicht passte, obgleich er unfähig war, sie zu ändern. Er regte sich, wann es ihn ankam. Hans-Hajo, der Sanfte, hatte ja recht. Dass er unter den anderen so unbedarft dastand, verwies auf Gründe, die eher gegen die anderen als gegen ihn zeugten. Andererseits durfte er sich der Aufgabe nicht einfach entziehen, dafür zu sorgen, dass er nicht den Esel vom Dienst gab –
- ―Wieso? fragte er erstaunt, es ist doch niemand da außer uns beiden, wieso setzt du mir so zu? Ehrlich gesagt finde ich es ungerecht – sie fand es, ehrlich gesagt, auch –, wie du mir zusetzt. Da müssen Motive bei dir im Spiel sein, über die zu diskutieren du dich weigerst. Was ich, ehrlich gesagt, nicht ganz verstehe.
Nein? Wirklich nicht? Ach Gottchen, da müsste schon ein anderer kommen, ein ganz anderer, der das sagen dürfte. Und überhaupt! Wenn er jetzt den Überlegenen spielte, dann konnte man sich auch fragen, warum er es nicht dort tat, wo es angebracht war. Ja, er war ein Esel, ein großer Esel, aber Größe muss nicht immer und überall von Vorteil sein. Ehrlich gesagt, sie kann ganz schön lästig werden. Größe, sobald sie menschlich wird, ist vor allen Dingen ein unhandliches, jede feste Form verschmähendes Stück Selbstbewusstsein, das kaum glatt durch eine normale Wohnungstür kommt, ohne anzuecken. Musste er zu diesem völlig ungeeigneten Zeitpunkt anfangen, über die Frauenfrage nachzudenken, die es schon länger gab und die sicher noch eine Weile weiter existieren würde, jedenfalls solange diese Schicksen nichts Besseres im Kopf hatten, als sie am Köcheln zu halten? Lästig genug, aus dem Mund der eigenen Mutter, die nicht vom Herd loskam und zwanghaft jede Woche Hausputz hielt, endlose Reden über das ungerechte Schicksal der Frauen zu hören. Auch glaubte sie den Vorwurf gegen den eigenen studentischen Lebenswandel deutlich herauszuhören. Ehrlich gesagt, traute sie ihrer Mutter nicht über den Weg. Schon gar nicht ihrem Freiheitswillen, in dem, wie sie lange festgestellt hatte, die eingeschliffene Bosheit jeden Handlungsimpuls bei weitem überwog. Wenn Hans-Hajo jetzt mit Emma zu turteln anfing, so würde sie ihn scharf im Auge behalten.
- ―Du träumst ja. Aufwachen! Aufwachen!
Wirklich? Das musste ihr entgangen sein.
Verklärt blinzelte sie in Hieros Gesicht, das verdächtig nahe herangerückt war. Was hieß schon verdächtig? Der Verdacht verfolgte sie schon länger.
Es war kein Verdacht, es war ein Gefühl.
Wurde Pw markig, so wurde Hiero breiig. Jedenfalls in Situationen wie jetzt, sofern kein Stück Philosophie vom Himmel fiel, mit dem er sich beschäftigen konnte. In dem Fall wurde er unerbittlich, fast wie ihr Vater, aber anders, freihändig sozusagen. Freihändig und gebunden. Die zwanghafte Vermeidung des Lebensrisikos, die aus Pws sonor gesetzten Maximen sprach, verkehrte sich bei ihm ins unbestimmte Gegenteil. Die Götter Griechenlands oder Marburgs hielten ihn fest umschlungen, so dass selbst der freie Fall kein Problem zu werden versprach, falls er je eintreten sollte, eine milde Form der Psychose, Philopsychose, besser unheilbar, denn das Erwachen konnte nur fürchterlich. Was sollte das jetzt?
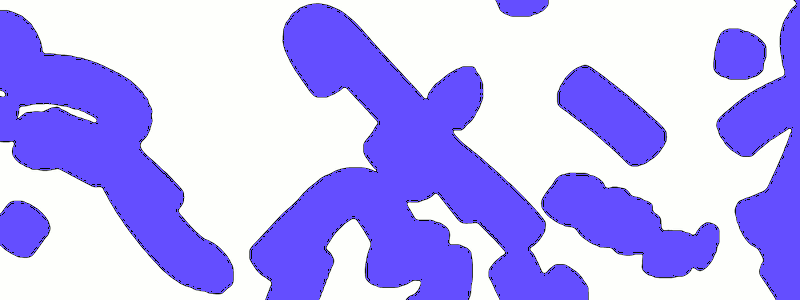
Kreisverkehr
Hiero strolchte durch den Kaffeebunker, blitzwach der Junge, wedelte mit einem dünnen Papier, a blank sheet of paper, aber so blank auch wieder nicht, eher vollgekritzelt, von oben bis unten, ein Exzerpt, weiß Gott, ein Exzerpt. Er schleppte diese Sachen mit sich herum. Wahrscheinlich, mutmaßte Mechtel, vertiefte er sich in seine Aufzeichnungen, sobald er sich unbeobachtet glaubte. Sie selbst und die anderen dienten nur als Pausenfüller zwischen Vertiefungsphasen – reizend! Dass er das jetzt herausholte, war ein unbedingter Vertrauensbeweis. Er weihte sie ein, das konnte ja heiter werden.
- ―Sag mal, Mechtel...
- ―Ja?
- ―Du warst doch auch in dem Seminar letzte Woche. Erinnerst du dich an den Beweis...
- ―Du meinst diesen angeblichen Beweis, dass alle Gedanken einen Zeit- und Ortsindex tragen und deshalb –
- ―Genau. Und deshalb auch nicht die These vom souveränen Bewusstsein zu stützen...
- ―Das ist doch kalter Kaffee. Was ist los, hast du eine Sinnkrise? Für einen von Tronkas Leuten redest du ziemlich defätistisches Zeug.
- ―Da bin ich mir eben nicht sicher. Es könnte ja sein, dass Tronka etwas übersehen hat. Ich meine natürlich nicht, dass Bewusstsein nur eine Funktion...
Mechtel glänzte.
Dieses Gespräch war nicht für mich bestimmt, ich trollte mich. Zu gern hätte ich noch aus Pws, notfalls sogar aus Eikes Munde die Kleinejungengeschichte erfahren, der zwar ›irgendwie auch‹ Schriftsteller werden wollte, aber kein gutes Wortgedächtnis besaß und immer wieder heikle Substitutionen vornahm. Doch das hatte, wie das hier, keine Eile. Nicht dass mich die Frage des souveränen Bewusstseins nicht brennend berührt hätte. Ich wunderte mich darüber, an einem Ort wie diesem das fundamentum certum et inconcussum, den Dreh- und Angelpunkt der Bewusstseinslehre Tronkas von seinem engsten Schüler so leichtfertig in Frage gestellt zu sehen. Tronka unterschied scharf, vielleicht zu scharf zwischen animalischer Bewusstheit und ›bewusster Animalität‹ – also der scharfen Kontrolle aller animalischen Funktionen. Offensichtlich gab es Lagen, in denen eine solche Trennung als unerwünscht empfunden wurde.
Ach was. Ich zog es vor, mich nicht zu sehr zu wundern. Die Wege des Sexus ebenso wie die der Konkurrenz zwischen kommenden Geistesgrößen sind, ungleich denen der Vergangenheit, alles andere als unergründlich. Eher könnte man sie breit und ausgetreten nennen. So sah ich die beiden auf ihrer Straße dahinzockeln, ganz in ihr Gespräch vertieft. Entschlossen drehte ich mich um und eilte dem nächsten Kundentermin entgegen. Deutlich empfand ich das unerfüllte Dreieck der Begierden, dessen fransige Enden den beiden und ihren fleißig das unerschöpfliche Kapitel ›Souveränität‹ studierenden Artgenossen einen unsichtbaren Abschiedsgruß entboten.
Hiero, Mechtel, Pw, Eike, Anton und die anderen – es wäre übertrieben zu sagen, ich hätte mich in ihrer Umgebung verjüngt gefühlt. Dafür war der Altersunterschied zu gering. Aber wann immer ich bei meinen sporadischen Besuchen im akademischen Milieu auf einen oder wie üblich auf zwei oder drei von ihnen stieß, glitt ein Teil der Daseinsbürde, die man als erwachsener Mensch geschultert hat und mehr oder minder unsichtbar mit sich herumträgt, von meinen Schultern. Hier war er, der homo ludens, der spielende Mensch. Es gab ihn wirklich, er existierte in mir selbst und diese Menschen besaßen das Geheimnis oder die Macht, ihn herauszulocken.
Es war derselbe Effekt, den die Berührung mit der Welt der Wissenschaftler bereits früher, wenngleich auf einer anderen Ebene, ausgelöst hatte. Alterslos kam sie mir vor, diese Welt, seltsamerweise, wo doch die Generationenfolge in ihr mit Händen zu greifen war. Dafür sorgte schon die abgestufte und strikt an Altersklassen gebundene Laufbahn, aber auch das in allen Beziehungen mitschwingende Lehrer-Schüler-Verhältnis. Von ungebremster, nicht selten die Grenzen zum Selbstbetrug und zur Komik überschreitender Nachwuchsmentalität sprachen die zwanghaft über alle Altersgrenzen fortgesetzten Versuche, sich einen Namen zu machen. Aber wie, jedenfalls wenn man einer gewissen Schule folgte, die Möglichkeit der Falsifikation – ›wissenschaftlich sind Sätze, die grundsätzlich immer widerlegt werden können‹ – den Raum der Wissenschaft eröffnete und begrenzte, so erschloss das Bedürfnis, teilzuhaben und sich einen Ruf zu erwerben, eine helle Zone der Gleichzeitigkeit, in der die grelle Dumpfheit, in der die Welt draußen ihren kommenden Schicksalen entgegenfloss, schier unbegreiflich oder zumindest schwer durchdringlich erschien.
Das stellte, aus Wissenschaftler-Augen betrachtet, kein Unglück dar. Auf diese Weise schaffte sie unerschöpfliche Vorräte an Material für immer neue Untersuchungen heran. Jedenfalls sah man es so, wenn man in bestimmten Disziplinen arbeitete. In anderen hielt man sich vornehm zurück. Auch innerhalb der Fächer selbst gab es, wie der Blick in die einschlägige Literatur mir bald klar machte, in dieser Hinsicht große Unterschiede. Manche Fächer wurden zwischen den Fraktionen der Theoretiker und der Empiriker buchstäblich zerrissen. Sie bedachten sich gegenseitig mit Spott und einer unfeinen Herablassung, die gelegentlich Zweifel an der Kinderstube ihrer Vertreter rechtfertigte.
Die Philosophie kam hier weniger in Betracht, ihre berühmt-berüchtigten Beispiele – ›Nehmen wir einmal an, dieser Aschenbecher befindet sich außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums‹, ›Sokrates ist ein Athener‹ – konnten nicht im Ernst als Einfallstor für die empirische Welt betrachtet werden. Doch bestanden Verbindungslinien nach draußen, die man leicht übersah. Sie leuchteten auf, wenn etwa Tronkas Kollege Einhart seine Parteiarbeit bei den Grünen durchaus philosophisch vertreten konnte oder Leckebusch auf solide finanzierten Tagungen, die er von Zeit zu Zeit abhielt, in betont souveräner Manier ›die Moderne‹ als das ›Schicksal des abendländischen Geistes‹ ausrief. Damit erinnerte er zwar stark an den kleinen Jungen, der, neben dem Bahndamm im Gras sitzend, die vorbeirauschenden Züge sortiert und im Geist auf die Handvoll Bestimmungsorte verteilt, die in seinem Kopf existieren, während sie vielleicht zu ganz anderen Zielen unterwegs sind. Aber das Verfahren besaß doch einen reellen Kern, insofern er in den Arbeiten, die ihm seinen speziellen Ruf eingetragen hatten, ›solide Begriffsgeschichte‹ trieb, also in einem Genre tätig war, das demonstrierte, wie hinieden auch die scheinbar feststehendsten Gedankenprägungen einem andauernden Erosions- und Umschichtungsprozess unterlagen.
Darüber hatte ich mir nie zuvor Gedanken gemacht. Ehrlich gesagt, bereitete die Vorstellung mir Unbehagen. Schuld daran mochte auch die triumphale Rhetorik sein, in die Leckebusch sie kleidete. Einmal entdeckt, lief diese Art von Untersuchungen wie auf Schienen in eine mit Beamtenstellen und Forschungspfründen gepflasterte Zukunft hinein. Ihr Dorado lag in jener famosen Sattelzeit, dem von dem Historiker Hölzchen gern als ›lang‹ bezeichneten Übergang vom achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert, in dem die ›alteuropäisch‹ geprägten, noch von Aristoteles und den mittelalterlichen Denkern herkommenden Begriffe allesamt ihr Bedeutungsspektrum wechselten. Damals, so las man bereits bei dem mittlerweile betagten Kollegen, der den Ausdruck so überaus glücklich lanciert hatte, gewannen sie, einmal ins Laufen gekommen, ihre bis heute zu registrierende Beweglichkeit, die neben den großen Fortschritten sowohl das große Geschwätz als auch die große Klage um die aus den Fugen geratene Welt ermöglicht. Die große Klage... Noch ahnte niemand in Leckebuschs Umgebung, wie bald er, nachdem ihn Elisabeth erst einmal von der Sorge um das gemeinsam geschaffene Heim befreit hatte, vom bloßen Erforscher vergangener zum authentischen Deuter künftiger Prozesse avancieren sollte. In dieser Rolle hängte er dem ›Schicksal der Moderne‹ das Wörtchen ›tragisch‹ an, um ansonsten weiterhin in der Art von akzentuierendem Nachsprechen fortzufahren, die ihn bekannt gemacht hatte. Mit den Gewährsleuten wechselten ganz von selbst die Akzente samt zugehörigem Tremolo.
Man darf sich vom Eindruck, den solch ein Wandel bewirkt, keine übertriebene Vorstellung fertigen. Es fällt leichter, das Schicksal des großen Ganzen zu prognostizieren als das eigene oder das irgendeines Nebenmenschen, den man in- und auswendig zu kennen glaubt. Empiriker erklären dieses scheinbare Paradox mit der Behauptung, das verwirrende Durcheinander der Einzelschicksale hebe sich im Gesamtprozess auf und zücken die Möglichkeiten der Statistik gegen etwaige Zweifler. Alle starren auf diesen Gesamtprozess – zweifellos, weil sie dort etwas sehen. Und doch... Manchmal beschleicht einen der Gedanke, dass sie einfach nur zu sehen behaupten, während eine große, träge Wolke an ihnen vorbei und durch sie hindurch segelt.
Etwas war bei den jungen Leuten anders. Sie beseelte nicht der Geist der Wissenschaft, sondern der Geist, der sich mokiert. Fräulein Portiönchen gab dafür ein anschauliches Beispiel, wenn sie gegen die ›Herren‹ stichelte, die selbst die Lizenz zum Abschuss zu besitzen glaubten. Ein Witzwort, ein aus der Tasche gezaubertes Argument, ein abfälliges Geschmacksurteil, der rasche Appell an einen internalisierten Gruppenkonsens genügten gewöhnlich, um ein Buch, eine Theorie, ein Seminar, eine Person oder eine Gesinnung zu ›liefern‹, wie sie sagten – ans Messer vermutlich, falls jemand das Bedürfnis haben mochte, den Ausdruck im Stillen zu vervollständigen. Unter die prall gefüllte Rubrik ›unsäglich‹ fiel auch die zum Ritual gewordene Gesellschaftskritik, wie das Feuilleton sie verbreitete und wie sie reihenweise Eingang in die Fußnoten und Problemexpositionen der nur ein paar Jahre älteren Jungwissenschaftler fand.
Nach meinem Eindruck ließ das Wort zwei Auslegungen zu: ›nicht anzuhören‹ (auf Grund grenzenloser Seichtigkeit) und, zumindest wenn man sich schalkhaft von der Lautassoziation leiten ließ, ›nicht abzusägen‹, soll heißen, durch keinerlei kritische Anstrengung aus der gesellschaftlichen Position zu vertreiben, die das linke ›Paradigma‹ im vorangegangenen Jahrzehnt errungen hatte. So blieb nur Hohn übrig, mit Sarkasmen gepfeffert und gelenkt von der spielerischen Erprobung der eigenen Intelligenz, die sich, angesichts des Zeitgeistes, als abgründig empfand und gleichzeitig unbekümmert Zukunft für sich reklamierte.
War es wirklich Zukunft? Anton zum Beispiel, ein fast hünenhaft zu nennender junger Mann mit einem Körper, dessen unbekümmertes Muskelspiel ganz andere Lebensoptionen denkbar erscheinen ließ, hatte sich in einer sperrigen Distanz zur Theologie eingerichtet, die nach menschlichem Ermessen geradewegs in den erstaunlicherweise durch die Wahl des Studienfachs verweigerten Dienst an der Schöpfung münden musste. Es sei denn, eine immer denkbare Konversion beendete die auf Patt gestellten Spiele des religiösen Bewusstseins und aus der Larve des Philosophiestudenten, der ein Problem besaß, mit dem wer? Gott? die anderen nach deren Bekunden verschont hatte, schlüpfte der Schmetterling eines stromlinienförmigen Auslegers all der Texte, auf die es wirklich ankam, wenn man die Hürden des Kathederdaseins meistern wollte. Vorderhand machte ihn seine religiöse Krankheit interessant. So wie er darüber sprechen konnte, wusste er das und fing bereits an, sie mehr oder weniger gezielt einzusetzen.
Es geschah in Maßen. Was andere Leute damals als das schlichte notwendige Fortkommen bezeichnet hätten, ohne das es keine akademische Berufswelt geben konnte, mutierte in seiner Rede zur übel beleumdeten ›Karriere‹ und er lehnte es rigoros ab. Das über eine vorsichtig angedeutete familiäre Konstellation erworbene Sonderverhältnis zur Transzendenz – dieser Sache mit Gott – ließ derlei Ansichten als vollkommen integer erscheinen. Dabei war gerade ›diese Sache‹ im Gespräch der Freunde gesperrt und durfte nur in selbstironischen Wendungen kommuniziert werden. Was wie Gruppenzwang hätte aussehen können, stieg in Blasen aus ihm auf und deformierte seine Rede, ohne dass es dazu irgendwelcher Anzüglichkeiten von außen bedurfte. Ein seltsamer Heiliger: umgetrieben von einer existentiellen Frage, die er nichtsdestoweniger als Ding präsentierte, als einen Sack Nüsse oder ein Schneuztuch oder eine abgebrochene Kuchengabel, von der der süße Stoff in einem ungeeigneten Moment herunterfiel.
Nein, er fuhr nicht zu Kirchentagen und der fröhlich ergriffene Gesang der Jesus-Freunde war ihm innerlich fremd. Er war Menschenfreund. Doch rührte er keinen Finger, wenn es darum ging, sich, wie das hieß, bei Organisationen wie Amnesty International oder Greenpiece zu ›engagieren‹. Hier zeigte er sich als ausgesprochen filigraner Kenner unfeiner Neben-, Unter- und Seitenmotive. Mich störte das nicht, da es mit den wenigen Erfahrungen, die ich in den Gefilden freiwillig kollektiver Beihilfe zum Menschheitswohl gemacht hatte, mehr oder weniger übereinstimmte. Doch wunderte mich die Heftigkeit der Abwehr. Ich fand, solche Einrichtungen waren auf Leute wie ihn angewiesen. Er wäre durchaus im Stande gewesen, dort den Leitwolf abzugeben und durch den vollkommenen Ernst seiner Überzeugungen den Zynismus, der immer und überall durchschlägt, wo es etwas zu holen gibt, sei es Prestige, Geld oder nur das Bewusstsein, auf der richtigen Seite zu stehen, soweit zurückzudrängen, dass ein Auskommen möglich wurde.
- ―Du meinst also, ich sollte beitreten, um die Glaubwürdigkeit des Ladens zu heben.
Er verfügte über ein Lachen, das nicht ansteckend wirkte, sondern nach innen gerichtet schien, wie ein Brand im Entstehen, der noch zu sehr mit sich sich selbst beschäftigt ist, um überzuspringen.
- ―Sagen wir, du wärst der geeignete Mann, um etwas dafür zu tun.
- ―Das habe ich mir auch schon überlegt. Die Sache ist die, dass man vorher nicht weiß, worauf man sich da einlässt. Okay, ich akzeptiere, das ist kein Argument, man weiß nie, worauf man sich einlässt. Nur in diesem Fall scheint es mir so, dass die glaubwürdigen Leute schnell mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie werden auch benützt, was nicht weiter schlimm wäre, schließlich wollen sie zu etwas nütze sein, das ist nicht das Problem. Aber es gibt zweierlei Art von Nutzen, darauf möchte ich eigentlich hinaus. Was den anderen nützt, nützt nicht unbedingt der Sache. Das klingt jetzt wieder komisch, ich weiß, ich mein ja nicht, dass man um der Sache willen alles andere vernachlässigen muss, ich meine, es gibt auch Freunde und so eine Art Grundeigennutz, ohne den man nicht weit kommt. Aber das stört mich schon wieder. Dieses Weiterkommen ist so eine Art Naturgesetz von Organisationen, man tritt in sie ein, um weiterzukommen, das stört mich.
Anton war der erste aus dem Kreis, mit dem ich mich duzte. Es geschah ohne Vorwarnung, wir merkten es beide erst nicht, dann holten wir die Förmlichkeit nach, ohne die wir es spontan denn doch nicht hingehen lassen wollten – ironisch gebrochen, wie es sich gehörte, aber nicht ohne eine gewisse Feierlichkeit und sogar Rührung, die ein Versprechen auf die Zukunft enthielt.
Ein solches Du kann auch wieder zurückgenommen werden, Stück für Stück, Scheibchen für Scheibchen. Das erfuhr ich zur gleichen Zeit in meinem Verhältnis zu Rennertz. Auch hier hatte, um es vorsichtig auszudrücken, die halbherzig negierte Förmlichkeit des Übergangs einen Zukunftsindex getragen: die vage Ausicht, einmal dort aus dem Vollen zu schöpfen, wo man fürs erste extrem vorsichtig zu Werke gehen musste, um nicht das Gesicht zu verlieren.
Das Herz ausschütten ist das Mindeste dessen, was einer tun kann, deshalb wird er sich hüten, es hier und heute zu tun. Alle Aufwände zwischen den Leuten laufen, um im Bild zu bleiben, darauf hinaus, nichts zu verschütten, als sei das Herz etwas, das mit äußerster Vorsicht ins Ziel getragen werden muss, was zweifellos eine gewaltige Leistung darstellt angesichts der unterschiedlichsten Gangarten, die ihnen das Leben nach und nach abnötigt. Freundschaften scheinen eine Art Exerzierfeld zu sein, auf dem Menschen üben, wie weit man sich gehen lassen kann, ohne sich etwas zu vergeben. Das verleiht der Sache einen aggressiven Kern, der nicht zu jeder Zeit, gelegentlich jedoch bereits bei minimalen Anlässen unverhüllt in Erscheinung tritt. So attestierte Hiero, der fünf Minuten vorher Antons ›Bude‹ im Sturmschritt geentert hatte und gerade seine Hände am Kachelofen wärmte, ihm ungerührt, als sei daran nun wirklich nichts Bemerkenswertes, Heuchelei. Anton schlug sofort zurück.
- ―Du hast es ja nicht einmal versucht. Sich das Hirn mit transzendentalen Deduktionen vollstopfen ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen wenig. Eigentlich ist es armselig. Armselig, das ist genau das Wort. Dazu stehe ich auch.
- ―Dazu kannst du stehen wie du willst. Die Grundlagen stecken hier drinnen.
Hiero hielt den gestreckten Zeigefinger gegen die rechte Schläfe. Seine Stimme hatte einen angerauten Klang und kam für meinen Geschmack etwas zu sehr von oben herab. Mich sah er dabei mit einem unterdrückten Lachen von der Seite an, als sei die Einschätzung dessen, was Anton da von sich gab, zwischen uns unstrittig. Das befremdete mich, da wir uns darüber niemals ausgetauscht hatten und ich mich in diesem Fall eher zu Antons Position hingezogen fühlte. Vielleicht war sie ja naiv und Hieros Rigorismus barg das größere Potential. Aber das hätte ich, eingedenk meiner Inselerfahrung, gern selbst herausgefunden.
Erneut klingelte es und in der Tür stand Pw, in der Hand einen Blumenstrauß, das Mienenspiel geschäftsmäßig angespannt, als sei er bereits im Hereingehen begriffen und das Begrüßungszeremoniell ein Hindernis, an dem er widerstrebend auflaufe.
- ―Ah, das ist schön, sprudelte Anton mit einem Lachen in der Stimme, das sich von dem vorangegangenen himmelweit unterschied, so einen Strauß bekommt man nicht alle Tage.
Pws Gesicht verfinsterte sich beiläufig.
- ―Neinnein, den will ich nach der Mensa bei jemandem vorbeibringen. Hast du eine Vase oder sowas, wo man ihn für ein Stündchen absetzen könnte?
Anton besaß keine Vase, am Ende betteten die beiden den Strauß ins Waschbecken. Die ›Bude‹ lag eine Querstraße von der Mensa entfernt und war gerade groß genug, um das Häuflein Studenten aufzunehmen, das sich hier vor dem Mensagang nach und nach zusammenfand. Schuld daran trug nicht allein die strategisch günstige Lage, sondern auch das geräumige Gemüt des Bewohners, dem es überhaupt schwer fiel, jemandem etwas abzuschlagen. Er war sich dieses Gebrechens sehr bewusst und ruderte hilflos dagegen an. Es war also sportlich zu verstehen, wenn alle paar Minuten die Klingel anschlug und ein neuer Besucher in der Tür stand oder wenigstens kurz vorbeischaute, um zu erklären, warum er gerade heute, beschäftigt wie er war, nicht bleiben könne.
- ―So beschäftigt möchte ich auch sein, seufzte Anton gelegentlich, eigentlich bin ich es ja auch, aber – da kommt ja schon der Nächste. Also: keine Chance heute, mal wieder. Wann soll ich eigentlich das Studium abschließen?
- ―Du wirst doch nicht gerade bei mir anfangen, heikel zu werden.
Unverkennbar: Eikes hohe Stimme.
- ―Lass mich doch erst einmal rein, dann können wir das in Ruhe diskutieren. Du solltest dir einen Zeitplan machen, ich habe damit gute Erfahrungen...
Das Fenster neben der Tür stand offen, so dass nichts den Gesprächsfluss behinderte.
- ―Gut pariert! rief Pw. Nur zu. Wer wird denn Montags um halb zwölf zu studieren anfangen? Das wäre ja pervers, überdies pure Zeitverschwendung.
- ―Ich möchte dich darauf hinweisen, dass es erst elf ist. Außerdem höre ich diese Reden andauernd, ganz egal, wie früh oder spät es ist. Ich werde das Zimmer aufgeben, ich weiß nur noch nicht, wohin ich ziehe. So geht es jedenfalls nicht weiter. Letzte Nacht hat einer von den Pennern im Flur geklingelt. Es war ihm zu kalt, er hatte es an den Nieren oder sowas. Was soll ich denn machen?
- ―Du hast den doch nicht etwa hier schlafen lassen?
- ―Rein ethisch gesehen...
- ―Ich kann das alles aber nicht rein ethisch sehen, beim besten Willen nicht. Ich muss auch einmal zum Abschluss kommen.
- ―Dennoch die Schwerter halten... zitierte Hiero mit vor Ironie bebender Stimme. Pw warf ihm einen verächtlichen Blick zu.
Anton schnüffelte.
- ―Gib mir ein Schwert und ich stürze mich hinein. Aber nicht, bevor ich jemanden damit bedroht habe.
- ―Was sagt denn Kierkegaard über den Selbstmord? Er wird ihn doch nicht etwa zulassen? Bisschen ungewöhnlich, unter Pastorentöchtern.
- ―Kierkegaard...
Hiero prustete. Pw hakte ein.
- ―Was ist denn mit dir los?
- ―Ich stell mir gerade eine Pastorentochter vor, die versucht, Selbstmord zu begehen.
- ―Man sollte Pastorentöchter nie unterschätzen. Außerdem ist die Abbrecherquote per Exitus höher, als man meint.
- ―Exitum, wenn schon.
Niemand hörte auf Hiero.
- ―Ach ja? Da könnte man noch einen draufsetzen.
- ―Das ist ja wie Selbstmord im Bordell. Auf alle Fälle kommst du in die Schlagzeilen.
- ―Kennst du Benns Studie über Selbstmord im Heer anno ’40? Staatsbiologie. Schon interessant, womit man sich damals beschäftigte.
- ―Apropos Benn – gib mir doch mal einen Tipp, womit ich anfangen soll. Die Gedichte können es ja nicht sein.
- ―Vergiss das Reimgeklingel. Aber das Parlando-Gedicht – große Klasse. Versuchs mal damit. In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs...
- ―In meinem auch nicht. Schreibe ich deswegen Gedichte?
- ―Dann lies Weinhaus Wolf, das liegt dir sowieso näher. Trümmerprosa, wohin du blickst.
- ―Ich habs befürchtet. Also wie ist das mit der absoluten Metapher?
- ―Gibts nicht. Was soll denn daran absolut sein? Der absolute Referent ist der absolute Nonsens.
- ―Auf was verweist eigentlich Gott?
Die Frage stammte von Eike, der dem Wortwechsel zwischen Pw und Anton bis zu diesem Punkt stumm gefolgt war.
- ―Gute Frage. Auf sich selbst wahrscheinlich.
- ―Na dann soll er mal.
Pw war vor kurzem mit einer kleinen Publikation hervorgetreten und benützte den Prestigevorsprung hauptsächlich, um bei anderen Stirnrunzeln hervorzurufen. Schwer zu sagen, ob ich ihn mochte. Nächtens, wenn die Lokale schlossen, begleitete er mich jetzt manchmal zu meinem Hotel, das auf seinem Weg lag. Dabei lernte ich eine Person kennen, die im Beiseitenehmen geübt war. Er beherrschte die Kunst, einem unter vier Augen das Gefühl zu vermitteln, es gäbe da eine Vertrautheit, die stärker und ursprünglicher sei als die der Gruppe. In meinem Fall kam er dem Nicht-Studenten auf halbem Weg entgegen. Wir siezten uns strikt. Auch der Geschäftsjargon schien ihm, woher immer, nicht fremd zu sein.
Eine reife Person – in jeder Hinsicht. Im Gespräch mit dem Älteren gab er sich sofort älter, als er war oder realistischerweise sein konnte. Einmal allein, blickten wir auf die unschuldigen Unterhaltungen der soeben verlassenen Gruppe etwa so, wie man als Reisender vom Piazzale Michelangelo herunter aus auf das im Schlaf versinkende oder bereits wieder erwachende Florenz schaut, wenn die von den Liebespaaren in ihren langsam erkaltenden Fahrzeugen verursachten Geräusche daran erinnern, dass im Leben neben den intellektuellen noch handfestere Genüsse in Erwägung zu ziehen sind.
Pw und die Frauen: ein Kapitel, zu dem ich überraschend an diesem Nachmittag Zugang fand, als er mich auserkor, ihn bei der anstehenden Überreichung des Blumenstraußes zu begleiten. Warum auch immer – überflüssig und überzählig, wie ich mir vorkam, machte ich so meine Beobachtungen. Die junge Frau, die ich kennenlernte, mochte sich ihm durch einen Blick empfohlen haben, in dem sich der Aufbruch nach Cythére mit der resignierten Einsicht mischte, die ganze Sache werde früher oder später ohnehin im Schatten einer Bahnhofskneipe enden. Was daran habituell wirkte, entstammte vielleicht einer mächtigen Wunschnatur, die sich durch trübe Erfahrungen nicht unterdrücken ließ. Allerdings fügte es ihrem Wesen eine abgelebte Komponente hinzu, die schlecht zu ihrem Alter und ihrer studentischen Lebensweise passte. Das machte neugierig.
Sie hauste über einer Kneipe in einer winzigen Wohnung, deren Fenster auf eine enge Gasse hinausgingen. Jeder schweifende Blick landete prompt im vorhanglosen Schlafzimmer gegenüber. Die Gasse strahlte etwas von der Halbintimität aus, die, vielleicht zu Unrecht, einst Adorno den Straßen von Lucca attestiert hatte. Ich war auf den kleinen Aufsatz wieder gestoßen, als ich reflexhaft meine Bücher sortierte, weil mir ihre hergebrachte Ordnung die in meinem Wissenshaushalt neuerdings eingetretenen Veränderungen nicht mehr angemessen wiederzugeben schien. Noch war ich nicht bereit, meine Bibliothek ohne Wenn und Aber dem Regular des Alphabets zu überlassen. Es gab in ihr hervorgehobene Orte neben Zonen minderer Zuwendung, deren Bewohner von mir gleichsam abgestraft wurden, weil ihre Aussagen zu den mich augenblicklich beschäftigenden Themen diffus oder rückständig auf mich wirkten. Auch wenn Tronka in seinen Schriften nur Bildungsschrott zu erkennen vorgab: ›Teddy‹ gehörte zum emotionalen Unterfutter jener Jahre. Die Pws und Hieros ließen, wann immer es anging, lauten und leisen Spott auf diese Gestalt herunterregnen, während nebenan die einschlägigen Dissertationen von Verfassern erblühten, die sich damit Zutritt zu den Kreisen verschafften, in denen das kulturelle Klima des Landes erkungelt wurde. Undenkbar eine Welt, in der nicht die leiseste Anspielung auf eine seiner Schriften oder ein mythisches Lebensdetail angekommen wäre.
- ―Teddy, sagte die junge Frau träumerisch, ihr Blick huschte aufblitzend an mir vorbei. – Ist der nicht tot?
Die nachmittägliche Plauderei der beiden vermittelte den Eindruck, es mit den Kindern mächtiger Zauberinnen zu tun zu haben, die lustvoll auf dem schmalen Grat zwischen Wissen und Unschuld balancierten und sich wechselseitig durch die Apartheit ihrer Rede und ihres Benehmens der werten Frau Mutter empfahlen. Als säßen einander der ideale Schwiegersohn und die ideale Schwiegertochter gegenüber, rührten sie in ihren Tässchen und pflegten Konversation. Das entfernte sich zu deutlich vom Zeitgeist, um nicht gestellt zu wirken. Doch mochte es bereits ein Stück unkonventioneller Gemeinsamkeit sein, das an eine auf Zukunft gestellte Intimität denken ließ. Ich wunderte mich daher ein wenig, als Pw mich anschließend auf dem Weg zur Bibliothek in ziemlich abgebrühter Manier über die Vorzüge und Handicaps der Dame ins Bild setzte und meine vorsichtige Erkundigung nach dem Grad vorhandener oder avisierter Gemeinsamkeit mit einem kargen Gelächter quittierte. In Worte übersetzt, konnte es nur heißen: Die nun wirklich nicht. Dafür hatte er mich gebraucht.
Zu den auffälligeren Requisiten in der Wohnung der jungen Frau gehörte ohne Zweifel die Toilette. Ich stieß auf sie in der Küche, gleich neben dem Herd, nachdem ich mich erboten hatte, eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank zu besorgen. Man durfte aus der ungewöhnlichen Kombination auf die ältere Anlage des Hauses, auf Nachkriegsnot und -findigkeit schließen, man konnte sich, wenn man wollte, über die Chuzpe von Vermietern wundern – das Faktum blieb immer bestehen und belebte das Nachdenken über die Bewohnerin, deren Stil und Auftreten nur schwer mit der Derbheit der Anlage in Übereinstimmung zu bringen war.
Der jungen Dame schien es, zog man die übrige Einrichtung und das Auto vor der Tür ins Kalkül, finanziell nicht schlecht zu gehen. Nein, sie betrachtete die Wohnung nicht als Notlösung, sondern, sie sprach die Worte mit klarer, harter, ein wenig störrischer Stimme, als ›idealen Stützpunkt‹, den sie für die Dauer ihres Studiums nicht aufzugeben beabsichtigte. Sie sagte bei der Gelegenheit noch manches andere, das mich davon überzeugte, einen Fall von gekränkter Tochterliebe vor mir zu haben, die in Männerbekanntschaften vornehmlich unzureichende Substitute für den einzig in Betracht kommenden, leider auf biologischen und wohl auch sozialen Abwegen wandelnden Vater wahrnahm. Mag sein, dass ihr das Handicap Besucher zuführte, die sonst fern geblieben wären. Zu ihnen gehörte in der Folge auch ich, dem es im Traum nicht einfiel, ihr Anträge sexueller Art zu machen. Mir gefiel es, mit ihr zu plaudern, und als Mit-Überbringer des Pwschen Blumenstraußes schien ich hinreichend eingeführt zu sein, um einen kleinen Anteil an den Nachmittagen eingeräumt zu bekommen, an denen sie Besuche empfing.
Dass auch leidenschaftlichere Varianten denkbar waren, diese Einsicht verdankte ich Hiero. Ich wusste nicht, dass die beiden sich kannten, bis er eines späten Abends im Pfau auftauchte, vor Enttäuschung und Wut schäumend – bereits im Aufbruch begriffen, verstand ich eine ganze Weile nicht, was ihn in diesen Zustand versetzt hatte, bis er Stück für Stück damit herausrückte. Sie waren miteinander essen gegangen –
- ―okay, so macht man das eben, sie ist keine Leuchte, was Konversation angeht, aber was solls! –
artig hatte er die Rechnung übernommen, sich in wirkliche Unkosten gestürzt, wie er ausdrückte, wobei mir das griechische Studentenlokal, in dem er außerhalb des Pfau verkehrte, ausgesprochen preiswert vorkam und ich sicher war, dass er in diesem Punkt unnachsichtig geblieben war. Sodann hatte er sie, in Erwartung kommender Dinge, nach Hause begleitet, sich dreimal ausschweifend von ihr verabschiedet und schließlich, gegen den Türstock gelehnt, eine geschlagene Stunde auf sie eingeredet. Es hatte alles nichts genützt. ›Betrug!‹ brüllte es in ihm und Betrug! bellte es aus ihm heraus, so dass der am Tresen hantierende Wirt unruhige Blicke herüberwarf – auch er ein Choleriker, man musste vorsichtig sein. Ja, Hiero kam sich bestohlen vor – nicht in irgendeinem übertragenen Sinn, sondern ganz reell, an Zeit und Beutel, wobei der Verlust an Zeit mehr schmerzte, denn er betraf den Dienst am Buch, was immer er gerade lesen mochte.
Gut gemacht, dachte ich, während ich Mitgefühl heuchelte, und wunderte mich, dass Personen, die nichts miteinander gemein hatten, überhaupt so weit gelangen konnten. Ich versuchte mir vorzustellen, dass Katerina – so hieß die Frau, deren erotische Ausstrahlung sich in dem auf Dauer gestellten Lustblick erschöpfte –, vielleicht nicht wirklich abgeneigt gewesen war, aber nach der Regel, dass Druck Gegendruck erzeugt, dem etwas zu geradlinigen Drängen des philosophischen Kämpen reflexhaft einen Riegel vorgeschoben hatte.
Offenbar waren hier zwei Menschen aneinander geraten, die, jeder auf seine Weise, ein Anrecht auf die Sache zu besitzen glaubten: nicht als Dienstleistung, bewahre, sondern auf die Sache selbst. Das mag komisch klingen und war es sicher auch. Der Grund ist einfach: beide bewegten sich zwanghaft im Spiegel ihrer Mitwelt und waren daher stets von der Angst beseelt, sie könnten ›im Leben‹ zu kurz kommen. In Katerinas Fall war mir dieser Zug gleich bei meinem ersten eigenen Besuch aufgegangen. Sie verdankte ihm einen Anflug wirklicher Beseeltheit, der wahrscheinlich auch Pw angelockt hatte, so wie er mich zu allerlei Gesprächen verführte, die, ohne nichtssagend zu wirken, sich in einem mit Träumen und beginnenden, aber von langer Hand vorbereiteten Bitterkeiten bebilderten Nichts bewegten.
Hätte ich mir Gedanken darüber gemacht, so hätte ich bereits an jenem Nachmittag begriffen, dass Pw, der seine Umgebung so gern durch ein betont viriles Gehabe unter Strom setzte und sich den Cineasten unter seinen Kommilitonen als diskret agierender Schauspieler-Imitator empfahl, es peinlich vermied, sich dem Risiko einer Zurückweisung auszusetzen. Paradoxerweise war er darin Hiero, dem dergleichen immer wieder passierte, gar nicht unähnlich. Beide empfanden Zurückweisung umstandslos als Zurücksetzung. Das war das Band, das sie Abend für Abend zusammenführte und gegeneinander in Stellung brachte. Wo Hiero stürmte, ging Pw mit einer Überlegtheit vor, die manchmal an Hinterlist grenzte, und genoss das Glück, den anderen ein ums andere Mal ›vorzuführen‹, soll heißen, ihn in jene Verfassung sinnlosen Brodelns und Schäumens zu versetzen, in dem sich ihm das Ziel, das definitive, den Gegner matt setzende Argument, immer weiter entzog. Pw triumphierte.
Es war wirklich Glück. In Wahrheit gingen ihm verhältnismäßig früh die Argumente aus. Statt adäquat zu replizieren, verlegte er sich auf waghalsige Wendemanöver und rhetorisch unterfüttertes, anhaltendes Nichtverstehen, das Hiero, der sich seiner Sache sicher wusste, an Stellen ins Stocken brachte, die er gewissermaßen nur aus der Perspektive des Durchreisenden kannte und die er jetzt fluchend und zutiefst verständnislos aus dem Blickwinkel eines Menschen betrachten lernte, der einfach nur, koste es, was es wolle, weiterzukommen wünscht. Daran war, solange Pw die Zügel des Gesprächs in Händen hielt, nicht zu denken. Das Brodeln und Schäumen stellte sich also unter gleichsam experimentell zu nennenden Bedingungen ein. Hiero kannte und fürchtete sie, aber er verstand ihnen nicht anders auszuweichen als dadurch, dass er sich ostentativ in die Rolle des Angreifers begab, in der er kläglich unterging. Es sei denn, er holte, sobald das Vergebliche seines Unterfangens sichtbar wurde, das letzte und einzige Pfund heraus, mit dem er relativ ungestraft wuchern konnte – die deutsche Schuld. Dann war es Pw, dessen Blick zu flackern begann und der nun seinerseits, koste es was es wolle, einen Vorteil über den anderen anstrebte, der nach Lage der Dinge nicht zu erreichen war. Gewöhnlich befand sich Hiero zu diesem Zeitpunkt leider bereits im Zustand hochgradiger Erregung, es war ihm daher nur selten vergönnt, seinen sich abzeichnenden Sieg in vollen Zügen zu genießen. So gingen oft genug – aber was ist schon genug? – beide als Düpierte aus ihren nächtlichen Kabbeleien hervor. Den Beweis dafür lieferten sie, wenn sie am nächsten Morgen unter vier Augen gegenüber dem einen oder anderen Vertrauten nachkarteten.
Auch dann dachte nicht im Traum einer von ihnen daran, dem anderen seine ›Kompetenz‹ streitig zu machen. Sie empfanden wirkliche Hochachtung voreinander und gaben ihr in entspannten Momenten oft und gern gegenüber Dritten Ausdruck. Für Pw vor allem schien außer Frage zu stehen, dass Hiero einer philosophischen Karriere entgegen ging, die er selbst ›nicht sah‹, aber gern beschritten hätte, allerdings ohne dafür auch nur den kleinen Finger zu rühren. Stattdessen ließ er sich vor den Seminarsitzungen bei Tronka, in die sie gemeinsam gingen, von Hiero präparieren, was dieser gern übernahm, nicht ohne gelegentlich zu sticheln.
- ―Lies doch einfach selber nach.
- ―Warum sollte ich? Ich finde, du machst das gut. Efficiency, du verstehst.
Nein, Hiero verstand nicht. Oder vielmehr: Er verstand zu gut, was Pw da sagte und er sonnte sich, insgeheim und leise ächzend, in der Rolle des Riesen, auf dessen Schultern das philosophische Leichtgewicht Pw, mit Ferngläsern hantierend und locker die allgemeine Richtung weisend, ins Seminar eintrabte. Was ihn störte, war die allzu große Bereitschaft, mit der Tronka diese Rollenverteilung als gegeben ansah und entsprechend Pw als das Haupt ihrer Beziehung behandelte.
Mag sein, Hiero, der wusste – obwohl darüber nicht gesprochen wurde –, dass Pw nach ihren nächtlichen Diskussionen im Pfau oft noch einem verschwiegenen Stelldichein entgegenstrebte, hatte, als er Katerinas Widerstreben an der Haustür heraufbeschwor, die Rivalität willentlich auch auf dieses Feld ausgedehnt. Sollte das der Fall gewesen sein, dann musste er erfahren, dass selbst hier, in Abwesenheit des Gegenspielers, dieselbe Ordnung galt und er sich nur ein weiteres Mal eine blutige Nase holte. Es ging um nichts Bestimmtes zwischen den beiden, ihre Rivalität bezog sich, um exakt zu sein, auf das Universum, dessen Besitz sie sich gegenseitig streitig machten. Eine solche Aussage kann leicht übertrieben klingen, dabei ist sie nur in dem Sinne genau, in dem sich jeder Geringschätzung enthalten muss, wer begreifen will, worüber Kinder sich streiten oder auch Erwachsene, sobald sie sichtlich außer Rand und Band geraten oder eine scheinbar belanglose Auseinandersetzung zur Dauerfehde ausschlägt.
Natürlich ließe sich einwenden, keiner könne das Universum besitzen oder einen solchen Besitz überhaupt wollen. Wer so redet, hat nicht bedacht, dass es Weisen zu verfügen gibt, die nur in der entgrenzten Auseinandersetzung sichtbar werden. Manchmal genügt es, dass zwei aneinander geraten, wo immer sie aufeinander treffen, und schon kommt es ins Spiel: nicht groß genug, um beide zu fassen, wird es zum Schauplatz ihrer Reibereien, ihrer Kämpfe, ihrer Niederlagen und rasch zerrinnenden Siege. Zu dieser Einstellung mochte stimmen, dass Pw, wann immer sich Gelegenheit bot, mit bedeutungsvoll hochgezogener Braue eine Lehre hervorholte, die in der umgebenden Gesellschaft als geächtet galt und ihn dem Verdacht aussetzte, ein ›Rechter‹ zu sein. Politik wurde ihr zufolge durch die Unterscheidung von Freund und Feind ›konstituiert‹. Wem es freistand, die Welt in dieser Weise aufzuteilen, der war souverän. Das bezog sich, so wie es geschrieben stand und in den einschlägigen Kreisen diskutiert wurde, auf Staaten, doch gab sich Pw damit keinen Augenblick zufrieden. Er wollte als Person souverän sein – und nicht nur ›wirken‹, wie es die soziale Regel vorschrieb. Das Bequemste – und der studentischen Verfassung Angemessenste – war, den Freund als Feind zu traktieren, sobald einen das entsprechende Gelüste ankam.
Hiero hätte die auf ihn gefallene Wahl ablehnen oder annehmen können. Dass er keinen Moment zögerte, sie anzunehmen, ließ ihn einerseits ebenfalls ›souverän‹ erscheinen, stempelte andererseits jedoch seine Wahl ausweglos zur zweiten Wahl, was sein patziges, in entscheidenden Momenten einfach ratloses Verhalten hinreichend zum Ausdruck brachte.
Wider Willen, so könnte man sagen, war Hiero zum Souverän befördert worden und befand sich in der kuriosen Situation, tagtäglich eine Freiheit exekutieren zu müssen, die ihm von anderer Seite aufgedrängt, ja aufgenötigt wurde. Er registrierte die Auszeichnung wohl, die darin lag, und wollte ihr mit allen Mitteln gerecht werden. Er konnte sehr unwirsch werden, wenn ihn jemand, den seine Blessuren mit Mitleid erfüllten, aus der Schusslinie zu ziehen versuchte. Auf der anderen Seite tat Pw alles, um ihm die einmal gefällte Entscheidung zu versüßen. Er umgab ihn mit einer Art sorgender Aufmerksamkeit, die selten nachließ, er ließ neben seinen Sticheleien und wirklichen Bosheiten links und rechts genügend Schmeichelhaftes vom Stapel, um für einen Ausgleich zu sorgen, der keiner war, aber die Aufgabe hatte, den Gegenspieler bei Laune zu halten und zur nächsten Duellrunde eintraben zu lassen.
Ein verhaltener Glanz trat in Hieros Augen, sobald die Rede auf seinen Gegner kam. Er hielt den Blick eine Weile gesenkt und richtete ihn dann in die Weite, bevor er sprach. Selbst wenn er in Wut geriet, redete er nicht abschätzig über Pw, sondern absprechend: wie jemand, der immer wieder erstaunt die Liste der angeblichen Vorzüge des Gegners durchgeht, um seine wirklichen Stärken zu erkunden und dadurch den Respekt zu rechtfertigen, den er ihm entgegenbringt. Selbstredend kamen die tatsächlichen Vorzüge des anderen dabei nicht zur Sprache. Warum auch? Sie verstanden sich von selbst und darüber zu reden wäre in der gegebenen Verfassung einem selbstquälerischen Akt gleich gekommen. Die Gesprächspartner, die beide kannten, waren auch so im Bilde und versuchten eher, mit lindernden Worten die Wogen zu glätten oder erst gar nicht entstehen zu lassen, sie behandelten ihn instinktiv wie einen Patienten und riefen damit oft genug seinen Zorn erst auf den Plan.
Natürlich sprach keiner der beiden von Feindschaft. Dieses Wort war, wie die Sache, im persönlichen Bereich tabu. Es wäre auch dem Verhältnis nicht gerecht geworden – schon deshalb, weil beide nie bis zum Äußersten gingen. Keiner hätte dem anderen Schaden zufügen wollen. Im Gegenteil: jeder sah die Zukunft des anderen offen und konnte sich einfach nicht vorstellen, dass es dabei ohne Prominenz abgehen würde. Gleichermaßen im voraus und im Konditionalis rangelten sie darum, wem sie zustünde, falls es, was nicht anzunehmen war, in der Welt gerecht zuginge. Allerdings gab es Abstufungen. Zwar hielten die Zeiten, in denen Hiero voller Geringschätzung in Pw den künftigen Pauker monierte, nie lange an, aber die Tatsache ließ sich nicht aus der Welt schaffen: es gab sie. Das Gegenteil wäre auch unwahrscheinlich gewesen, denn Pw schloss jede andere berufliche Möglichkeit für sich im Gespräch kategorisch aus, während er Hiero mit schönem Gleichmut die philosophische Karriere prophezeite, die dieser in aller Offenheit für sich reklamierte. Auch das sollte sich, wie so manches, ändern und den Blick auf eine ganz neue Konkurrenz freigeben: härter, verbissener, unwirklicher als die, von der hier zu berichten ist.
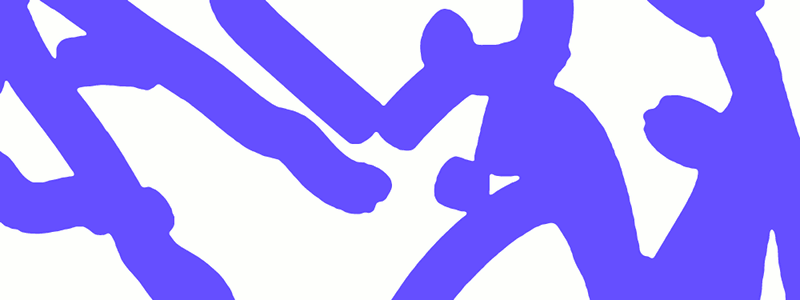
Die Herren des Diskurses bringen sich in Stellung
Dieselbe Art Konkurrenz, durch die sich Pw und Hiero gegenseitig aufwerteten und die zwischen ihnen eine Art Knechtschaft begründete, wie man sie ebenso auf dem Schulhof wie in den sinnlosen, aber für Fernstehende aufschlussreichen Duellen berühmter Geister findet, regte sich in diesem Herbst noch an anderer Stelle. Der Historiker Hölzchen, der gern so auftrat, als trage er das ganze Pathos seiner Disziplin in Form eines kleinen handlichen Amuletts mit sich herum, konnte seiner diskussionsgewohnten Stimme einen harschen Klang geben und ihr sozusagen andere Saiten aufziehen, sobald das Gespräch auch nur von Ferne gewisse Kollegen streifte. Eine Zeitlang fragte ich mich vergeblich, ob sie eine verschworene Gemeinschaft oder Schule bildeten oder ob jeder auf eigene Rechnung operierte. Ehrlich gesagt, gelang es mir nicht einmal herauszufinden, wie groß der ›inkriminierte‹ Personenkreis war und wer zweifelsfrei dazu gehörte. Da immer wieder einzelne Namen fielen, bildete sich so etwas wie ein mit Rotstift gezogener Kreis um sie. Es genügte, einen von ihnen auszusprechen, um stets dieselben heftigen Bemerkungen und Wortwechsel zu provozieren.
Hölzchen zufolge handelte es sich um Renegaten. Sie hatten einen bestehenden ›Konsens‹ verlassen und behaupteten nun Dinge, die zu perfide waren, als dass sie einer der Anwesenden in klaren, runden Worten hätte wiedergeben können. Der siegfriedhaft wogende Germanist Rosshammer, der nur gelegentlich an den Leckebusch-Abenden teilnahm und deshalb als kontinuierlicher Diskutierer ausfiel, hatte als erster den Einfall, den ganzen Themenkomplex mit dem mir inzwischen aus dem Tronka-Zirkel geläufigen Wörtchen ›unsäglich‹ in den Orkus zu befördern. Seine samtene Art, das ›ä‹ ein wenig auseinanderzuziehen und dadurch in eine verwegene Freiheit zu drängen, in der es sich unweigerlich am schroffen ›g‹ stieß und gleichsam selbst auslöschte, entzückte mich von da an jedes Mal aufs Neue. Auf mehr ließ er sich nicht ein, vermutlich, weil er Fachgrenzen von Natur respektierte und den Grundsatz der Nichteinmischung zur Grundlage seiner kollegialen Verbindlichkeit gemacht hatte.
Leckebuschs emsig der nächsten Einladung nach Oxford entgegenstrebender Assistent Einhart verlangte, getreu seinen sprachanalytischen Überzeugungen, hier und da sprachliche Klärungen. Doch begnügte er sich überraschend schnell damit, vor der geballten Macht politischer Interessen zu kapitulieren, die er aus den Reden der anderen heraushörte, zumal sie grosso modo den seinen entsprachen. Was Leckebusch anging, so folgte er aufmerksam, neigte das Haupt und schwieg. Ein Historiker der Gedankenblitze hätte auf seinem Gesicht das Widerspiel einer gewaltigen, in die stillen Gründe der Seele eingeschlossenen Schlacht begütigender Impulse und ungeduldig den Konflikt anschärfender Elemente wahrnehmen können. Nicht so Hölzchen – er bemerkte nichts. Das war von Vorteil, denn wann immer er auf sein Lieblingsthema zu sprechen kam, scharte sich aus dem Nichts heraus ein Kreis aus jüngeren Wissenschaftlern um ihn, darunter einige, die sonst wenig zur sprachlichen Gestaltung der Abende beitrugen, aber auch solche, deren Beredtheit sich am oberen Rand des Spektrums bewegte oder es ganz und gar sprengte.
Was an den Universitäten ›Mittelbau‹ heißt und vordergründig die Personengruppe der abhängig Forschenden und Lehrenden umfasst, die den berufenen Professoren zuarbeitet, enthüllte sich mir, der ich von Stellen- und Amtsfinessen so gut wie nichts wusste, nach und nach als eine Geisteshaltung, getragen von den unterschiedlichsten Charakteren, aber mit unverkennbar eigenem Gepräge. Ich musste nur auf den Punkt achten, an dem der wortreiche Ansturm gegen die professoralen Bastionen übergangslos in exekutive Bravheit umschlug. Es kam mir so vor, als wollten sie vorwegnehmen, was sie selbst in ihren künftigen Rollen zu geben imstande sein würden, aber im Modus der Folgsamkeit, als gehe es darum, gebeugten Hauptes die Schwellen zu überschreiten, die zwischen ihrer gegenwärtigen, durch Erwartung gekennzeichneten, und ihrer kommenden, im Zeichen der Erfüllung stehenden Existenz lagen. Kein Wunder, dass Hölzchens Thema der Konsens-Abtrünnigen sie magisch anzog. Immerhin versprach es Aufschluss über die magischen Gleise, auf denen man auf Sicht, aber unsichtbar gelenkt, in eine Zukunft fuhr, über der das ›C 4‹, die Gehalts- und Ansehensklasse derer blinkte, die es definitiv geschafft hatten.
So konnte ein Zuhörer leicht den Eindruck gewinnen, dass Hölzchen über Betriebsgeheimnisse sprach, wenn er, was durchaus vorkam, den ehrenwerten, in der Regel deutlich älteren Kollegen in der Ferne auf zweideutige Weise in Schutz nahm, indem er ihn von Anwürfen reinigte, die zunächst einmal aus seinem, Hölzchens, eigenen Munde kamen, und dabei über Motive sprach, deren Quellpunkt, wie bei einem Historiker kaum anders zu erwarten, in Erfahrungen lag, die dem Krieg und den Jahren danach angehörten. Wie viele seiner Kollegen zählte Hölzchen zu einer Altersgruppe, die noch durch die Nabelschnur der ersten Kindheit mit jenen heiklen Jahren verbunden war. Diesen vagen Kompetenzvorsprung gegenüber den Jüngeren kostete er hemmungslos aus, so wie er ihn umgekehrt, unter dem Vorzeichen eines unschuldigen Wissens, gegenüber den Älteren in Anschlag brachte. Ihm und seinesgleichen, und zwar ihnen allein, gehörte die Gegenwart, insofern sie, dank ihrer bequemen historischen Lage, mit Fug die Deutungshoheit über sie beanspruchen konnten. Das jedenfalls entnahm ich seinen Worten, nachdem sich meine anfängliche Verwirrung etwas gelegt hatte und ich nahezu sicher war, dass vieles von dem, was er vorbrachte, einfach ›gegriffen‹ genannt werden konnte.
Über diese Deutungshoheit wurde, vor allem in Zeitungsartikeln, gelegentlich auch im Fernsehen, viel gestritten. Mir war unbehaglich zumute, wenn ich dergleichen las oder hörte, weil es neben der großen, gütigen, wenngleich ein wenig unheimlichen Maschine der Vernunft, die ich in den blitzenden Hallen der Wissenschaft unentwegt Erkenntnisse und wirkliches Wissen auswerfen sah, das Vorhandensein einer zweiten Maschine behauptete – oder, für Skeptiker, bestätigte –, die statt der Bilder eines gelassenen Neben- und Miteinander der Forschenden die Aussicht auf Getümmel und Geschrei heraufbeschwor, auf Sieg und Niederlage, auf triumphales Behaupten und schweigendes oder zähneknirschendes Hinnehmen seitens der Unterlegenen, die ich aus anderen Lebensbereichen zur Genüge zu kennen glaubte und hier nicht vorzufinden gehofft hatte. Dass der wissenschaftliche Prozess Sieger und Verlierer kannte, schien mir einerseits trivial, andererseits nicht weiter beunruhigend, solange der unterlegene Teil im Spiel blieb und man ihm erlaubte, erneut auf Beutefang zu gehen, gemäß dem Seefahrer-Bild, das mir auf Angram solchen Eindruck gemacht hatte. Eines waren jene hartnäckigen Streitereien im Dienste der Wahrheit, die zuverlässig verhinderten, dass Wissenschaft sich als etwas Schönes präsentierte, ein anderes der Pranger, vor den hier bei bestimmten Gelegenheiten immer wieder dieselben Leute gezerrt wurden, nachdem man ihnen Arme und Beine ausgerenkt hatte, so dass sie weder stehen noch gehen konnten. Hörte man ihnen aufmerksam zu, so merkte man, dass sie, zweifellos um sich zu rechtfertigen, einfach nur dummes Zeug von sich gaben, beseelt von jener Furcht, die sie angeblich denen einflößten, die an ihnen das Henkeramt verrichteten.
Mechtel, mit der ich mich beiläufig darüber unterhielt – ich scheute mich, sie wie die anderen ›Fräulein Portiönchen‹ zu nennen, aus Besorgnis, mir damit eine unangenehme und völlig unstudentische Reaktion einzufangen –, verstärkte hörbar den Ironieanteil ihrer Stimme:
- ―Also ich kann daran nichts Besonderes erkennen. Die Tronka-Truppe macht es doch keinen Deut anders. Wissenschaft ist eine Männerdomäne, wussten Sie das nicht?
- ―Also wenn du mich fragst, ist das Mobbing. Ganz normales C 4-Mobbing, mischte Hans-Hajo sich ein. Das gibt es nicht nur bei Männern. Die Frauen machen es irgendwie anders, aber auch ziemlich giftig, wenn man mich fragt. In der Wissenschaft sieht man das nicht so, weil sie da unterrepräsentiert sind, aber komm’ mal einer an die Schule, sage ich euch, da herrschen andere Zustände.
- ―Welche Zustände? fragte Mechtel scharf.
Ich wunderte mich im Stillen, dass sie nachhakte, ich fand, dass er sich mit seiner Äußerung gut geschlagen hatte. So kam, was kommen musste: er begann zu stammeln. Mechtel wandte sich ab. Offenkundig wurmte es sie, dass er in Hörweite der Tronka-Truppe, aus der angeblich jeder, mit Ausnahme Hieros, keinen dringenderen Wunsch kannte als den, ›an die Schule zu gehen‹ und den noch formbaren Teil der Menschheit mit den lichten Höhen des Denkens vertraut zu machen, so ungeniert von seinen vor Ort gesammelten Erfahrungen sprach. Ebenso gut hätte er sich als Hausmeister oder Müllkutscher zu erkennen geben können. Die Differenz schien ihr, so wie sie sich gebärdete, ziemlich schnuppe.
- ―Ich staune ja immer, rührte sich Eike, der die letzten Brocken aufgeschnappt hatte und den Zusammenhang witterte, dass seit ’45 die Männer alle irgendwie schuldig und die Frauen alle irgendwie unschuldig sind. Die ganzen Nazi-Weiber fallen einfach unter den Tisch: sowas hats nicht gegeben, stattdessen Trümmerfrauen, wohin man blickt.
- ―Was soll denn das? Ich nehme an, das ist wieder eine typische Männerphantasie, drehte Mechtel auf. So hättet ihr die Frauen gerne.
- ―Naja, umziehen könnten sie sich schon, brummte Anton. Mechtel, überraschend graziös, berührte mit ihrer Hand seinen Arm.
- ―Röckchen, was? Blüschen, was? Ihr seid doch...
Und sie zog die Hand wieder weg.

Blitz und Donner
Zum Eklat kam es, als für alle Anwesenden überraschend – nur der Hausherr lächelte abgründig –, Kärich bei Leckebuschs auftauchte und Hölzchens Tiraden schneidend unterbrach:
- ―Das ist doch alles unbewiesenes Zeug. Geben Sie’s wenigstens zu, wenn Sie einen aus Ihrer Zunft fertigmachen wollen.
Dieser Ton war neu. Der Kreis um Hölzchen und Kärich vergrößerte sich im Nu.
- ―Nun, lieber Freund, nudelte Hölzchen, ›fertigmachen‹ ist ein Wort, dessen Gebrauch ich hier nicht empfehlen würde. Aber um auf Ihre Diktion einzusteigen: unfertig ist unsere Rede von Anfang an. Es scheint jedoch Kollegen zu geben, die...
Er sah sich um, als suche er den Beistand der anderen.
- ―… sagen wir einmal: fertiger zu sein scheinen als andere. Sie verstehen? Sie sind gewissermaßen mit dem Stoff durch, möchte ich sagen, der, möchte ich sagen...
- ―... für alle reichen muss? Kärich grinste.
- ―Natürlich muss er für alle reichen. Dafür sind wir Historiker, das ist doch klar. Aber Sie haben mich unterbrochen. Was ich sagen wollte...
Was immer Leckebusch, der nicht zu den geschmeidigsten Gastgebern zählte und stets für den einen oder anderen kleinen Fauxpas gut war, bewogen haben mochte, den pinocchiohaften Noch- oder Ex-Mitarbeiter des Kollegen einzuladen, dessen Name an diesem Ort niemals fiel, es wurde bei weitem übertroffen durch die Geste, durch die er die beiden Streithähne womöglich versöhnlicher stimmen wollte. Ziemlich abrupt, mit einer schlenkernden Bewegung, die neue Unruhe schuf, breitete er die Arme aus und legte sie auf Hölzchens und Kärichs respektive Schultern, die sich unter dieser Last keineswegs zu senken, sondern zu heben begannen, als wollten sie die unvermutet aufliegende Last so rasch wie möglich wieder loswerden. Doch sie hatten, wie man so sagt, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Leckebusch verstärkte den Druck wie ein Politiker, der sich vorgenommen hat, ein paar aus dem Ruder laufende Parteifreunde zur Raison zu bringen, und dabei auch subkutane Mittel in Anwendung bringt. Ich musste ihm darin Recht geben, schließlich ging es um Themen von hoher Brisanz und es mochte sich rasch herumsprechen, wenn in seinem Haus lose Reden geführt wurden, die er weder verantworten konnte noch wollte. Kärich, als langjähriger Untergebener sensibler, wenngleich störrischer gegenüber derlei Pressionsversuchen, gab als erster klein bei und wechselte das Thema, wenngleich nicht ganz.
- ―Wir kennen das in der Philosophie ja auch...
Leckebuschs Arm fiel herunter.
- ―Wie meinen Sie das?
Kärich kostete die wiedergewonnene Freiheit.
- ―Nun ja, langsam sollte sich einmal herumsprechen, dass, sagen wir seit Spinoza, die Philosophiegeschichte weitgehend Bluff ist. Kollege Hölzchen hier macht uns doch vor, wie das geht. Zugegeben, auch ich komme in meinen Seminaren nicht ohne Buhmann aus. Wie machen Sie das eigentlich? Ich meine, was hat einer von uns wirklich gegen Wittgenstein? Ich kann ihn nicht lesen, mir schläft der linke Arm ein, aber was heißt das schon? Ich schätze, Kollege Einhart – er scheint gerade nicht zuzuhören – versteht in diesem Fall keinen Spaß. Ich schon. Wenn Sie wollen, lese ich auch über Heidegger, den ganzen Heidegger, nicht nur den Blender, den alle kennen, ich kenne seine Hintergedanken, ich habe sie ausstudiert, wenn Sie verstehen, was ich meine, aber – wollen Sie Heidegger? Will einer hier Heidegger?
- ―Ich, sagte Hölzchen energisch, stellte einen Fuß vor und wiederholte:
- ―Ich.
In der Gruppe entstand Bewegung, einige der Jüngeren zogen sich zurück.
Zu meinem Erstaunen schob sich die Tronka-Truppe nach vorn.
- ―Ja – das muss ich erklären, was?
Hölzchens Blick schweifte zum Rand der Zimmerdecke, als gelte es, die richtige Perspektive für das zu wählen, was nun kommen musste, und sank dann zu Boden. Leckebuschs Arm lag noch immer auf seiner Schulter.
- ―Der
junge Kollege hier hat ja recht, natürlich brauchen wir einen
Buhmann, ich brauche einen Buhmann, warum sollte es anders
sein? Heidegger ist für mich kein Buhmann. Ich kann Sie verstehen,
wenn Sie das anders sehen, aber ich kann mich dem nicht anschließen.
Ein Versager, ja, nennen wir ihn einen Versager, warum nicht, einen
politischen Versager, da sind wir uns vermutlich sogar alle einig.
Wer sagt uns eigentlich, dass wir keine Versager sind?
Wir, die wir hier stehen, sind vielleicht die nächsten Versager. Vielleicht stehen die, die uns verhöhnen werden, schon vor der Tür. Das ist möglich, ich sage nicht, es ist wahrscheinlich, aber es ist möglich und ... lassen Sie mich ausreden. Aber: ein philosophischer Versager ist er nicht. Ich sage Ihnen das, weil Sie Philosophen sind und ich, streng genommen, von der Philosophie nichts verstehe. Sie müssen streng sein und ich kann gerecht sein. Kommen Sie mir nicht mit der Idee der Gerechtigkeit und den Schwierigkeiten, die so ein Konzept aufwirft. Ich bin auch nicht gerecht, ich bin nur redlich, weil mein Interesse sich auf die Lektüre beschränkt. Ja, ich lese Ihre Bücher und die Ihrer Vorgänger, das wollte ich damit gesagt haben. Ich wollte damit keine Betretenheit auslösen, tut mir leid, falls ich das geschafft habe.
- ―Aber das ist ja wunderbar, flötete Leckebusch, der seinen Arm jetzt zurückzog. Polyphem reklamiert sein zweites Auge. Das muss ich sofort meiner Frau – Elisabeth!
Wo war Elisabeth? Verschwunden, diffundiert, lautlos in die hinteren Räume entrückt oder lachend und – vielleicht auf Tronkas zurückliegenden Rat hin – mit wem auch immer Händchen haltend in einem abgedunkelten Kinosaal gegen alle philosophischen Zweifel abgeschottet. Wo immer sie sich aufhalten mochte, Hölzchens und Kärichs Buhmänner waren ihr sicherlich schnuppe, solange über den eigenen kein Zweifel bestand. Kein Zweifel? Ich spürte, wie ein älteres Unbehagen in mir aufstieg.
Mag sein, dass Hiero in diesem Augenblick seine Chance erspähte, mag sein, dass es ihm nur herausrutschte, jedenfalls gelang es ihm, die schon gelöste Stimmung augenblicklich umschlagen zu lassen, sofern angesichts einer flüchtigen Zusammenballung von Personen wie dieser überhaupt von Stimmung die Rede sein kann.
- ―Ihre Frau ist mit Herrn Tronka spazieren gegangen. Ja, ich weiß das zufällig, weil ich den beiden auf dem Herweg begegnet bin. Aber ich möchte doch noch etwas zu Herrn Kärichs Ausführungen sagen. Ich sehe in dieser Diskussion keinen Buhmann. Ich beziehe mich jetzt nicht auf Heidegger, das mag ein anderer Fall sein, obwohl ich meine, dass ein Rektor der Marburger Uni in SA-Uniform schon ein Fakt darstellt, auch in der Philosophie – aber sei’s drum, wir sind hier nicht unter Klosterbrüdern. Aber wenn ein Historiker, ein deutscher Historiker heute öffentlich, während Deutsche schon wieder Hakenkreuze auf jüdische Grabsteine pinseln, unter den Augen der Welt... ich meine, man kann das doch nachlesen –
- ―Wissen Sie, was Sie da sagen? fragte Leckebusch mit gerunzelter Stirn. Er sprach nicht laut, aber mit einer Stimme, die gleichzeitig konsterniert und bedrohlich wirkte, als erinnere ein großer grauer Kater eine vor ihm stehende Maus an die Folgen ihrer plötzlichen Unerschrockenheit.
- ―Ich glaube schon.
- ―Nein, das glauben Sie nicht. Sie können es nicht glauben, weil Sie nicht wissen, was Sie da sagen. Sie können es nicht wissen, nein, Sie können es nicht wissen... Sehen Sie – der unbestimmt eine Ecke des Raumes fixierende Vorlesungsblick erwachte –, es gehört zu den Gepflogenheiten totalitärer Gesinnungsträger, jeden, der ihnen nicht passt, in eine Ecke zu stellen, ihm immer wieder dasselbe Etikett aufzukleben und ihn zusammen mit Menschen zu nennen, mit denen man bereits fertig geworden ist oder die man sich ebenfalls vorzunehmen gedenkt. Diese Praxis ist illiberal, sie zerstört, wenn man sie lang genug praktiziert, jede freiheitliche Verfassung. Wissen Sie, der Historiker, über den Sie so abfällig reden, ist ein Mann von Ehre, er stammt aus einer untadeligen Familie, er ist ein liberaler Denker, übrigens einer der unerschrockensten, die wir haben, Kollege Stöckchen wird Ihnen das gern bestätigen. Wie kommt man dazu, ihn in einem Atemzug mit Mördern und Rassefanatikern zu nennen? Das ist infam, so wie diese Diskussion überhaupt – entschuldigen Sie, Kollege Stöckchen – nur als Teil einer infamen Praxis begriffen werden kann. Diese Praxis hat die Weimarer Gesellschaft und am Ende den Weimarer Staat zerstört und sie dauert – in Teilen unserer Öffentlichkeit – an.
Er hatte wirklich ›Stöckchen‹ gesagt, aber der entschiedene Ernst seiner Stimme bändigte die Spötter und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf anderes. Man spürte, dass der entfernte, von ihm so nachdrücklich gerettete Historiker nicht zu seinen persönlichen Bekannten zählte und dass er ihm im Grunde seines Herzens gleichgültig war. Man merkte aber auch, dass seine Rede einen persönlichen Einschlag besaß und dass er von Dingen sprach, die ihm ganz und gar nicht gleichgültig waren, dass sie in eine Region reichten, über die man gemeinhin nur indirekt Auskunft erhält, es sei denn, man ist mit der betreffenden Person sehr gut befreundet oder man ›weiß‹ über sie ›Bescheid‹, woher und aus welchen Gründen auch immer. Der zweimal angesprochene Hölzchen räusperte sich kurz und merkte dann ›als Historiker‹ an, er stimme, was den ›untadeligen Ruf‹ des entfernten Kollegen, seine großbürgerlich-liberale Herkunft und seine denkerischen Fähigkeiten angehe, völlig mit Leckebusch überein, aber:
- ―Wissen Sie, für uns liegt da ein Problem. Wir wissen nicht so genau, ob er überhaupt ein Historiker ist oder nicht doch vielleicht eher ein Philosoph. Historiker denken anders, sie wollen für alles Belege, sie wollen nicht, dass ihnen einer die Welt erklärt, sondern dieses Stück Papier, diese eine Entscheidung: Warum fällt sie jetzt, am siebenundzwanzigsten achten, warum nicht am Tag davor oder danach, welche Faktoren spielen mit, was genau sind die Hintergründe, das geht bis hinein ins Private. Das Private ist überhaupt ein ungeheures Reservoir, wir stehen noch davor, es uns ganz zu erschließen, dafür brauchen wir Hilfe, vielleicht von der Literaturwissenschaft, wir wissen es nicht. Wir wissen es noch nicht. Dieser Mann ist einer der Ihren, wir überlassen ihn Ihnen, sagen Sie uns, wie wir ihn lesen können, ohne dass all diese Fragen entstehen, die man stellen können muss. Das ist auch liberal, nicht nur das Geltenlassen.
- ―... nicht nur das Geltenlassen. Leckebuschs Stimme klang zerstreut, es hatten auch nicht alle verstanden, der Kreis zog sich enger zusammen.
- ―Sie sagen da etwas Bedenkenswertes. Man muss gelten lassen und man darf es nicht. Man kann es gar nicht und das ist die Wahrheit. Wir alle sind im Innersten illiberal und das ist die Wahrheit. Es gibt einen Teil in uns, der kämpfen möchte, sobald er das Haus verlässt, manche fangen auch bereits im Haus damit an und da beginnt das Unglück. Diese ganzen Kampfparolen sind Ausdruck unserer inneren Schäbigkeit. Vor jedem Inhalt. Vor jedem Inhalt. Ja, das ist wahr.
Fast schien es, als wolle er sich auf Hölzchens Schulter stützen, aber er besann sich rechtzeitig und lachte etwas gekünstelt.
- ―Sie sind mir einer. Sie wollen uns erzählen, dass Sie jemanden, der Sie als erster mit stichhaltigen Definitionen und einer überzeugenden Gesamtdarstellung der faschistischen Bewegungen versorgt hat, nicht unter die Historiker zählen wollen? Aber das ist Amnesie, Herr Kollege. Unter Historikern! Also ich muss schon sagen...
Zufällig stand ich neben Rosshammer, der vor Aufregung von einem Bein aufs andere stieg und murmelte:
- ―Ach ist das komisch, ach ist das komisch.
Bei dem Wort ›Amnesie‹ begann es in Kärich zu rumoren, die ersten Worte, die seinem Mund entschlüpften, klangen, als kämen sie direkt aus den Eingeweiden, erst nach und nach verfestigte sich seine Stimme.
- ―... wissen? Nichts daran ist gewiss, Herr Stöckchen, und Sie wissen das, sonst wären Sie kein Historiker. Sie sind doch Historiker? Sie haben Fakten, soso. Wo haben Sie sie denn? Am Hals? Wie haben Sie sie denn? In der Weise des Hunger-Habens? Oder des Satt-Habens? Haben Sie sie satt oder haben Sie sie über? Wenn Sie sie satt haben, wo bleibt dann die Singularität? Wenn Sie sie über haben, wo bleibt dann die Pluralität? Ist Ihre Geschichte ein Ereignis oder sind es viele? Ist sie im Ganzen singulär oder in Teilen? Im Ganzen? Gut. Das ist sehr gut. Im Ganzen singulär. Nur: Argumentieren können Sie dafür ebenso wenig wie für das andere. Sagen Sie mir doch: Gibt es Koordinaten außerhalb eines Koordinatensystems?
- ―Natürlich nicht.
- ―Warum behaupten Sie es dann?
- ―Behaupte ich das?
- ―Wie kann ich wissen, was Sie behaupten? Vielleicht behaupten Sie gar nichts. Vielleicht bewegen Sie sich nur. Mein Rat wäre: Hören Sie einfach auf, Äpfel und Birnen zu vergleichen. Oder fangen Sie damit an. Fangen Sie damit an. Vielleicht bekommen Sie etwas heraus? Vergleichen Sie endlich die Lagersysteme, eines um das andere. Vergleichen Sie die Terrorsysteme, eines um das andere. Vergleichen Sie die Mordsysteme, eines um das andere. Fangen Sie endlich an! Sie sind die Historiker. Warum verweigern Sie Ihre Pflicht? Haben Sie kein Interesse? Woher dann die fertige Erkenntnis?
Man musste das Netz der Anspielungen nicht durchschauen, um zu bemerken, dass Kärichs parodistische Hebammenkunst etwas auf den Punkt gebracht hatte, was sonst nur unterschwellig durch die Reden der anderen geisterte – übrigens auch Hölzchens, der den verfemten Kollegen vordergründig in Schutz nahm, aber ihn nur desto gewisser eintunkte – mit einem Nachsatz, einem Epitheton oder, auch das kam vor, mit einem maliziösen Lächeln. Das konnte einen auf den Gedanken bringen, dass es seine eigenen Hintergedanken waren, die er auf den anderen verschob, um sie dort dem unsichtbaren Kollektiv preiszugeben, das mit geschmeidiger Präzision dafür sorgte, dass bestimmte Sätze nicht ausgesprochen oder auf der Stelle mit Sanktionen beantwortet wurden. Die Schweißtropfen, die auf seiner Stirn sichtbar wurden, verdankten sich vielleicht weniger dem Einspruch, der sich bereits den Weg zu den Lippen bahnte, als dem Schrecken, ertappt und bloßgestellt zu sein.
Vermutlich musste einem Historiker, der gewohnt war, in seinem Proseminar Singularität und Kontextualität als die Kennzeichen historischer Ereignisse ›als solcher‹ herauszustellen, es wie ein Hohn auf die eigene Zunft erscheinen, einen, der im besonderen, zugegeben schwierigen Fall nichts anderes behauptete, ans Kreuz der öffentlichen Verachtung genagelt zu sehen. Woraus sie ihre Kraft bezog, war schwer zu ergründen. Es war, als hätten die Wissenschaftler, die sich da vor den Augen von Journalisten, Bankangestellten und Zeitungsverkäufern öffentlich beharkten, sich verschworen, gerade diesen Aspekt unerörtert zu lassen. Handelte es sich um ein nationales Ritual, das darauf zielte, eine verheerende Vergangenheit von sich abzuspalten, einzukapseln und als schwach, aber dauerhaft leuchtenden Trabanten in den erdnahen Raum zu entsorgen? Je singulärer die Ereignisse, deren Schatten die Gegenwart durchwebten, desto leichter fiel es, die kollektive Gemengelage aus Scham, Entsetzen, Wut und Selbstabkehr durch Stigmatisierung Einzelner in einfache, klare und wohltuende Empörung zu überführen. Alles, was das allgemeine Fassungsvermögen übersteigt, nährt das unfassbar Andere und damit das Andere schlechthin, es entschlüpft gleichsam jedem neuen Versuch, es zu fassen, und bleibt bedrohlich.
- ―Infam, zischte Hiero, das ist infam!
Alle Blicke ruhten auf ihm. Er trat, wie vorhin Hölzchen, einen Schritt vor und kratzte sich am Kinn. Seine Augäpfel leuchteten in einem eigenen Feuer. Er wirkte nicht aggressiv, nicht einmal entschieden, sondern – ich kann es nicht anders sagen – beseligt und unübersehbar nervös. Darin glich er Kärich, der seiner Haltung etwas Verächtliches zu geben bemüht war, so wie jemand nach einem Wort sucht, das der Gesprächspartner längst erraten hat.
Von keinem der Kontrahenten wahrgenommen, tauchten Elisabeth und Tronka im Türrahmen auf.
Tronka konnte es nicht lassen, mit einer vollkommen sinnlosen Armbewegung der Dame die bereits weit offene Tür aufzuhalten, so dass der Eindruck entstehen konnte, die beiden wollten die Schwelle zur selben Zeit passieren. Elisabeth gab sich amüsiert und gelangweilt wie immer, sie schien ihren Begleiter gar nicht zu bemerken. Umso intensiver heftete sie den Blick auf die kräftige Gestalt Hieros, der offensichtlich im Begriff stand, die Dummheit seines Lebens zu begehen.
Gut möglich, dass er es sogar wusste. Jedenfalls verstand ich so den angerauten Ton seiner Stimme und einen Zug an seiner Erscheinung, der im voraus um Verzeihung bat. Man findet ihn manchmal bei Ärzten, die einem nicht weh tun wollen, obwohl es sich nicht vermeiden lässt. ›Es hilft doch nichts‹, sagte dieser Zug, ›wir beide müssen da jetzt durch.‹
In diesem Fall hätte er ihn sich sparen können. Ich will nicht sagen, dass Kärich bei dem Wort ›infam‹ erstarrt wäre. Das traf eher auf die anderen zu, denen, wie man so sagt, der Mund offen geblieben war. Kärich stellte sich starr, in einer Geste sozialen Hochmuts, als erklimme er ein rasch herbeigeschafftes Podest, das ihm gestattete, das den Sockel umstreichende Ungeheuer einfach zu ignorieren. Aber so, wie er da stand, gleichsam als dieses Ignorieren selbst, verschmolz seine Gestalt mit der in die Nichtbeachtung verstoßenen Bestie zur Figur einer asymmetrischen Feindschaft.
Dagegen hatte Hieros Verhalten – man mochte es, je nach Blickwinkel, vielleicht als ›mutig‹, ›töricht‹ oder ›bestürzend‹ bezeichnen – nichts Feindseliges an sich. Im Gegenteil, es baute auf eine vertrackte Weise auf Zustimmung, übrigens auch von Kärichs Seite, so als unterbreite ein antiker Feldherr nach einer deprimierenden Serie ergebnisloser Schlachten ein Friedensangebot, das sonderbarerweise nur Beschimpfungen enthält.
Ich hatte nicht gewusst, dass Hiero sich mit Kärich im Krieg befand. Wenn meine Information zutraf, hatte letzterer ihn bereits im kleinen Kreis als künftigen Assistenten ins Auge gefasst. Und doch ... und doch verstand ich ihn, verstand, welche Art von Zustimmung er mit dem denkbar ungeeignetsten Mittel herausforderte. Zumindest glaubte ich ihn zu verstehen, ohne allerdings mein Verständnis in einen klaren Gedanken oder die entsprechenden Worte fassen zu können.
Heute, nach einer Reihe damals nicht abzusehender Erfahrungen, denke ich, er könnte damals zwanghaft eine Art Abspaltung betrieben haben. Hiero sah sich als Sohn eines Exilanten, der während seiner Kindheit in weitgehendem Einklang mit seiner Umgebung gelebt hatte und nach dem Krieg in sie zurückgekehrt war. Für ihn verkörperte der Prominentensohn, ohne dass er oder sein Vater etwas dafür konnten, eine ungute Kontinuität: zusammen repräsentierten sie das eine Land. Er selbst stand ›auf der anderen Seite‹. Nein, er empfand keinen Hass auf die Nation, wie er mir mehrere Monate lang auf meinen Fahrten von einer kleinen Autobahnbrücke entgegenstarrte. Ein Unbekannter hatte dort neben das schwarze Zeichen der Anarchie die Worte ›Deutschland verrecke‹ gepinselt – tagtäglich wortlos wahrgenommen von einigen Tausend Autofahrern, die ihrer Arbeit nachgingen oder sich ein paar Tage frei genommen hatten und, aus dem Süden heimkehrend, diesen Moment als eine Art rituell erneuerter Zwangseinweisung in die geistigen Verhältnisse ihres Landes empfinden mochten. Auch er bestand darauf, die Nation zu repräsentieren – anders, wie denn sonst. Man durfte daher, vorausgesetzt, man konnte und wollte es, Hieros giftige Wortmeldung als eine paradoxe captatio benevolentiae betrachten – weniger für sich, der ihrer nicht bedurfte, als für die Gemeinde der Gerechten, von der sich einige Glieder unter den Anwesenden aufhalten konnten. Selbst Kärich war ja kein hoffnungsloser Fall, er war zuallererst Sohn, so wie Hiero selbst, einer, der mit seinem Erbe zurechtkommen musste und, Philosoph, der er ebenfalls war, der Aufgabe mutig ins Auge blickte.
Vielleicht hätte sich die Gruppe in diesem Moment zerstreut, hätte nicht Ruffmann, der gewöhnlich zu solchen Diskussionen schwieg und sich lieber bei den Damen aufhielt, sofern er nicht unter den jüngeren männlichen Semestern auf Proselytenfang ging, unvermutet das Wort ergriffen. Seit Einharts spöttelnder Erklärung hatte sich die angebliche Schwängerung der Assistentin als gezielte Bosheit der Sekretärin herausgestellt, so dass alle, die die Nachricht mit Fleiß verbreiten geholfen hatten, ihm neuerdings aus dem Bewusstsein heraus, in seiner Schuld zu stehen, mit einer Bereitwilligkeit zuhörten, die ihn sicher gerührt hätte, hätte er sie nicht, getrieben von einer gewissen Instinktlosigkeit, seinem wachsenden philosophischen Ruhm gutgeschrieben, von dem in diesem Raum niemand wusste.
- ―Infam sagen Sie? Das verwundert mich ein bisschen, aber es interessiert mich natürlich auch. Das ist ja eines dieser Wörter aus der Fremde, denen die Sprache Gastrecht gewährt und von denen man gar nicht recht weiß, was sie dann noch bedeuten. Was genau meinen Sie, wenn Sie den Ausdruck gebrauchen? Er bedeutet ja zunächst einmal ›ruch-‹ oder ›ehrlos‹, aber in einer massendemokratischen Gesellschaft sind diese Wörter selbst nicht mehr fix im Gebrauch verankert, sondern frei flottierend – wenn einer sie überhaupt benützt, wovon man nicht ausgehen kann. Eine Infamie allerdings... Was ist eine Infamie? Ich frage Sie. Sie haben vielleicht nicht darüber nachgedacht, das mag sein, ich auch nicht, muss ich gestehen, aber das macht ja nichts. Das macht ja ... nichts...
Was ihm die Entgeisterung ins Gesicht trieb, war die – umwerfende – Rückansicht Elisabeths, die der Tür zustrebte, eng an Tronka gelehnt, der sich dieser unvermuteten Bürde mit der Gebärdensprache eines taktstockschwingenden Dirigenten zu bemeistern versuchte. Ruffmann wirkte ungläubig, ja entsetzt, wobei nicht zu entscheiden war, wer von den beiden den Affekt in ihm auslöste.
- ―Es ist infam, wiederholte Hiero leise, als sei er augenblicklich mehr mit sich selbst beschäftigt und könne dem sich anbahnenden Verhör keinen Geschmack abgewinnen. Auch er starrte den beiden nach und dieses Starren hatte einerseits etwas Sprachloses, andererseits redete aus ihm eine wissende Erbitterung, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Tronkas noch immer ausstehende, wenngleich angelaufene Habilitation hing daran, dass Leckebusch sich aktiv für seinen Assistenten einsetzte. Allein diese einfache Überlegung schien mir nicht ganz zu dem Anblick zu passen, den Hiero und sein Idol augenblicklich boten.
- ―Erklären Sie es, wiederholte Ruffmann sanft. Sein in säuerlich gepresste Mundwinkel auslaufendes Sybaritenhaupt schwankte leise. ›Myrmidonenhelm‹, durchfuhr es mich. Doch blieb keine Zeit, dem Gedanken nachzuhängen.
Hiero kam in Fahrt.
- ―Das kann ich gerne tun. Es ist infam, die Opfer nachträglich zu Tätern zu machen.
- ―So meinen Sie das. Und Sie denken, das sei hier geschehen? Das wäre in der Tat infam. Aber ist nicht jedes Opfer auch Täter? Ist es deshalb weniger Opfer? Wenn dem so ist, frage ich Sie: wie denken Sie sich das? Sie meinen, ein Opfer muss rein sein wie... wie...
- ―... wie die Rasse? Das wollten Sie doch sagen, oder? Wollten Sie das sagen? Nein, das meine ich nicht. Das ist ja ungeheuerlich.
- ―Sie meinen, die Ehre gebietet...
- ―Die Ehre gebietet gar nichts. Die Ehre ist mir vollkommen schnuppe. Zum Teufel mit der Ehre.
Hiero hatte eine Verfassung erreicht, in der er nicht länger zwischen Freund und Feind, zwischen ehrenvoller Replik und verheerender Invektive zu unterscheiden gewillt war. Es genügte, dass Kärich, vermutlich, um der Sache ein Ende zu machen, ihn kalt von oben bis unten musterte und sich anschickte, den Kreis zu verlassen, um ihn laut werden zu lassen.
- ―Ich weiß, was Sie alle hier denken. Sie wollen ganz normale Menschen sein, mit ganz normalen Gedanken und einer ganz normalen Vergangenheit. Das wird Ihnen nicht gelingen.
- ―Sind Sie kein normaler Mensch?
- ―Ich? Natürlich bin ich ein normaler Mensch. Warum sollte ich kein normaler Mensch sein?
Kärich ging. Er ging durch dieselbe Tür, die einen Moment vorher von Elisabeth und Tronka freigegeben worden war, mit elastischen Schritten, die Aussicht auf einen Kahlkopf Blicken freigebend, die ihm nachdenklich folgten, denn Hiero war beileibe kein Unbekannter und das unausgesprochene Angebot einer Stelle, die den Weg zur akademischen Laufbahn öffnete, stand auf diffuse Weise im Raum und verlieh dem augenblicklichen Schweigen seine empfindsame Note.

Distanzlose Ferne
Das war, man muss es so sagen, eine Überschreitung, nicht geringer als das, was Tronka und Elisabeth mit ihrem Kurzauftritt den Anwesenden geboten hatten. Leckebuschs Rolle als Gastgeber hatte eine Einbuße erlitten, doch dafür war er, merkwürdig genug, ›einer von uns‹ geworden, mit allen Vor- und Nachteilen dieser Position. Er war, jedenfalls hier und jetzt, nicht länger ›der Leckebusch‹, als den ihn Tronka einst tituliert hatte und wie ihn die Studenten sahen, sondern ein Gezeichneter des Eros, der mit der Situation zurechtkommen musste und sich dieser Aufgabe vornehmlich als Zuhörer annahm. Seine naturgegebene, gewöhnlich durch den Zwang zur Lehre in den Hintergrund gedrängte Aufmerksamkeit schuf eine neue Atmosphäre. Auch legte er einen ungewöhnlichen Appetit an den Tag, wodurch er am Büffet Anlass zu allerlei kollegialen Scherzen gab. Dabei blieb mir ›durchaus unklar‹, was Elisabeth mit ihrer Darbietung bezweckt haben mochte. Dass sie die Fäden zog und Tronka dabei einmal mehr als Assistent gefragt war, bedurfte keiner weiteren Begründung. Dass er es tat, dass er es stellvertretend tat, wie seine kurios bemühte Gestik verraten hatte, überraschte mich, wenngleich nicht sehr. Die unterschwellige Verbindung zwischen dem Schicksal, nicht in Betracht zu kommen, und seinen großspurigen Reden mochte ihn bewogen haben, an einer Stelle zuzugreifen, wo es, davon war ich überzeugt, nichts zu greifen gab. Vor allem nicht für ihn, den Elisabeth, wie ich vermutete und heute weiß, in anderen Orientierungen befangen glaubte. Seine übertriebene Hochachtung vor ›der Frau‹ machte es ihr sicher leicht, ihn in ihr Spiel einzuspannen, vorausgesetzt, er durfte sich in der Pose des Ratgebers sonnen, was sie ihm zweifellos gestattete.
Alles schien möglich. Vielleicht war es zwischen ihr und Rennertz zu einer neuen Vereinbarung gekommen. Vielleicht hatte sie auch seinen Antrag zurückgewiesen und musste nun an Leckebusch ihr Mütchen kühlen. Natürlich wusste sie von den Spannungen, die mit Tronkas verzögerter Habilitation zusammenhingen. In diesem Vorgang lagen die Nerven aller Beteiligten blank – naturgemäß vor allem diejenigen Tronkas, der überzeugt war, mit seiner noch unpublizierten Schrift bereits in den Reihen der Klassiker angekommen zu sein. Er konnte nur verstört darauf reagieren, dass die in aller Regel so geschmiert laufende Rezeption der Texte just an dieser Stelle ins Stocken geraten war und seine Gutachter sich beharrlich zu sehen weigerten, was doch für jeden, der sich auskannte, auf der Hand liegen musste. Kein Wunder also, wenn er selbst sich auf keinen Fall nachsagen lassen wollte, nicht zu sehen und nicht zu reagieren, falls sein Rat gefragt war – fatalerweise gerade hier, wo es sich um Probleme im Hause Leckebusch handelte, die ihn klugerweise nichts angehen sollten. Vermutlich beschäftigten sie ihn gerade deshalb ernsthaft. Elisabeth wiederum, auf den Spuren ihrer Tochter wandelnd, wäre nicht die Person gewesen, die ich kannte, hätte sie sein kompetentes Herz nicht für sich einzuspannen gewusst. Dieses Herz existierte wirklich – allerdings nur in Verbindung mit kuriosen Äußerungsformen, die Kompetenz durch Inkompetenz vergalten. Sicher wollte sie Tronka mit dem gemeinsamen Auftritt nicht schaden. Falls er allerdings Schaden nahm, so war ihr das ziemlich gleichgültig. Höchstens bestätigte es sie in ihrem Vorurteil gegen Philosophen, das sie mir so eindrucksvoll bewiesen hatte.
Das klingt, als hätte ich ihr Spiel an diesem Abend durchschaut. Dabei gilt auch in diesem Fall, was wohl auf alle Erinnerung zutrifft. Selbst wenn es so gewesen wäre, könnte ich darüber keine Auskunft erteilen. Zwar ›sehe‹ ich den Auftritt noch ›vor mir‹ und registriere dabei eine starke Gefühlskomponente. Aber was ich da sehe, sind nicht meine Gedanken und Hintergedanken während des Auftritts. Sie gerade sehe ich nicht und was ich dabei denke, sind meine heutigen Gedanken, deren Verbindungen zu meiner damaligen Gedankenwelt mir äußerst lose vorkommen, um es nachsichtig auszudrücken. Und was auf die Gedanken zutrifft, das trifft, vielleicht in abgeschwächter Form, auch auf die Empfindungen zu. Zwar suggeriert mir die Erinnerung, alles geschehe auf eine ungreifbare Weise noch einmal, aber sie enthält keinerlei Bürgschaft, es seien dieselben Empfindungen und dieselben Gefühle, die mich damals heimsuchten. Echt ist die Suggestion, nicht die Erinnerung, allenfalls noch der Erinnerungsanker, der mir die Gewissheit eingibt, alles sei so und nicht anders passiert. An dieser Gewissheit lasse ich nicht rütteln. Sie ist ein zu kostbares Gut, als dass ich bereit wäre, sie der Skepsis zu opfern, selbst wenn sie im modischen Gewand einer physiologischen Theorie daher käme. Dafür habe ich zuviel gesehen und weiß, wie schütter wissenschaftliche Begriffsbildungen sind, mögen noch so viele Laborratten aufgeschnitten und Reagenzgläser dazu geschüttelt worden sein.
Wo war ich? Ach ja, ich war ›konsterniert‹. Statt Gedanken oder Empfindungen nachzuhängen, die, hätte ich Interesse gezeigt, bequem die meinigen hätten werden können, saß ich in der Küche herum und lauschte den Tiraden eines frisch aus Tel Aviv eingeflogenen Jungwissenschaftlers, dessen Redefeuer von einer Erinnerung anderer Art angefacht wurde. Auch er sprach über Empfindungen. Er hatte gerade, als Reservist, einen Einsatz im besetzten Palästinensergebiet hinter sich, nichts Aufregendes vermutlich für ein militärisches Gemüt, aber tief aufwühlend für einen Menschen wie ihn, der sich bis dahin hauptsächlich damit beschäftigt hatte, an klimatisierten Schreibtischen spekulative Gedanken über die menschliche Gleichheit zu hegen, und nicht gewillt schien, sich dieser Beschäftigung in allzu naher Zukunft zu entschlagen. Als ich hereinkam, war er bereits in Fahrt. Ich bemerkte ein Stocken und eine leichte Verlegenheit, die durch den stakkatohaften Redefluss rasch übertönt und fortgeschoben wurde. Etwas älter als Hiero, jedoch deutlich jünger als ich, mochte er einen Moment lang in mir den Aufpasser gewittert haben, in dessen Gegenwart man unwillkürlich die Stimme dämpft und den Inhalt der Reden überschlägt, die man in den letzten Minuten geführt hat. Das war, was meine Person betrifft, natürlich Unsinn, aber es traf mich nicht unvorbereitet. Ich erkannte darin eines der Zeichen beginnender ›Anciennität‹, vor denen sich viele Menschen fürchten. Und wappnen muss man sich, das ist wahr. Lange bevor das wirkliche Alter eintritt, erhebt sich eines Morgens quer durch die innere Stadt eine stacheldrahtbewehrte Front, von der gestern noch weit und breit nichts zu sehen gewesen war. Wie am Vortag sucht der erstaunt sich weitende Blick die vertrauten Bezirke der Jugendlichkeit, es zuckt in den Beinen, aber ohne Folgen: Weitergehen zwecklos! Dabei ist es eine Sache des Inneren, von langer Hand vorbereitet und immer vorhanden gewesen, auch wenn sie so taufrisch erscheint, als erwache sie gerade aus dem Dornröschenschlaf und der Jüngling, der sie wachgeküsst hat, müsse noch als Verwehter im Raum stehen.
Diese geteilte Stadt im Bewusstsein und der durch eine frische Demarkationslinie auseinanderdividierte Zufallsort, an dem der junge Mann seinen Dienst mit der Waffe geleistet hatte, verband vielleicht mehr miteinander, als er ahnte, wenn man davon absieht, dass es mit seiner Ahnung nicht weit her sein konnte. Anfangs fühlt es sich an wie... wie... etwas Vorläufiges, ein Provisorium, leicht zu beseitigen. Die Grenze ist da, aber nicht wirklich, die Gedanken gehen über sie hinweg und der Passierschein, sollte es ihn geben, ist eine Lappalie, über die das Bewusstsein hinausdrängt wie über den Stich einer Mücke. Erst der Rückblick gibt die Einsicht frei, dass sie von Beginn an gerade so unzerreißbar oder zerreißbar war wie jede andere Trennlinie, hinter der Menschen stehen, die bereit sind, sie mit Waffengewalt aufrecht zu erhalten, auch wenn sie zur gleichen Zeit ihre Unmöglichkeit empfinden und sich in Rausch und Katzenjammer flüchten. Am Anfang steht aber weder der Rausch noch der Katzenjammer, sondern die Sprachlosigkeit der Erkenntnis, an einen Ort gestellt – besser: unaufhaltsam geschoben – worden zu sein, von dem es kein Entkommen gibt, außer vielleicht im Schlaf oder im Wachtraum des Exils, das andere, ähnlich konstruierte Orte bereitstellt. Aus dieser Sprachlosigkeit erwächst, wie sonst, der Entschluss, dem Anderen ins Auge zu sehen – dem Gegner, dem Alter oder der misstrauischen jungen Person, die einen daran erinnert, auf welche Seite man gehört. Er erwächst, ungerufen, unbeabsichtigt, wie ein Furunkel sich eines Morgens auf der Haut zeigt, sich andeutet, sich ausführt, als habe man ihn gerufen und werde für die Ausführung der anstehenden Arbeiten aufkommen und alles habe seine Richtigkeit, während das Gegenteil der Fall ist und er nicht nur ungerufen, sondern in jedem Fall zur Unzeit auftritt und einem nur Scherereien und ein gemindertes Lebensgefühl einträgt.
Über eine solche Minderung sprach der junge Mann. Er beschwerte sich vehement, aber während er sich beschwerte, zeigte sich, dass ihn das Erlebte, von dem er nicht loskam, bereicherte. Er mochte seine schockierende Erfahrung bereits nicht mehr missen: diesen Einschnitt, jenseits dessen sich das Leben in neue Bereiche hinein erstreckte. So also fühlte es sich an, einem Land zu ›dienen‹ (eine bis vor kurzem noch als lächerlich und abstrus empfundene Vokabel), das seine Maßnahmen, zu denen die Okkupation fremder Gebiete und die Kujonierung der dortigen Bevölkerungen gehörte, durch einen tödlichen Abwehrkampf rechtfertigte, in dem es sich befinden mochte – oder auch nicht. Wer sollte das entscheiden? An der Realität des Kampfes war jedenfalls nicht zu zweifeln, ebenso wenig wie an den Erfahrungen einer weit zurückreichenden Vergangenheit und einer von Terror und Tod geprägten Gegenwart. Das machte den Dienst zu einer ernsten Sache, der man sich nicht einfach entziehen konnte.
Ganz ähnlich beginnt der älter werdende Mensch eines Tages zu dienen: der Gesundheit, der täglichen Arbeit, der Partei, dem ›Wohl der Angehörigen‹ oder, seltsame Zwitter, ›der Arbeiterklasse‹ oder ›der Kunst‹, während die Begeisterung für die Menschheit, in die sich das anfängliche mit-dem-Körper-und-seinen-Empfindungen-Einssein einhüllt wie in eine Fahne, sachte in den Hintergrund tritt, bis nur noch ein gelegentliches Rauschen daran erinnert. Anders als der Staat, der nicht altert, weiß ein Mensch, wenn er so weit gekommen ist, dass es mit ihm – nicht gleich, aber sachte – zu Ende geht. Er weiß es in sich, das Irgendwann hat für ihn die Form des hier und heute wirksamen Aufschubs angenommen. Es bleibt ›in diesem Lebens‹ so mancherlei zu erledigen, dem man sich weder entziehen möchte noch entziehen kann, doch eben in diesem Leben, womit, laut oder leise, ein anderes in der Tür steht.
Die simple Rede von ›diesem Leben‹ belehrt darüber, dass es für den Einzelnen noch ein anderes gibt, geben sollte, geben muss: ein Jenseits, das sich ohne große Probleme dem Diesseits zuschlagen lässt, wenn der alte, ›religiös‹ genannte Glaube an ein Leben jenseits des Grabes nicht länger forthilft, sei es, dass er durch einen entschiedenen Nichtglauben oder, besser, einen ›Glauben-dass-nicht‹ ersetzt wurde, sei es, dass er stückweise in sich zusammenfiel und nun das große Fortkommen als gelegentlich störende, manchmal auch verstörende Erinnerung begleitet. Nur wenige Menschen gehen auf ihr Jenseits zu, über das so wenig verlautet, obwohl die Kunde davon ganze Bibliotheken füllt. Sie lassen es an sich herankommen, bis der müde gewordene Körper rät, auch diese Bürde abzuwerfen und auf ein bescheidenes Verschwinden zu setzen wie ein ratloser Wettvogel, der den eigenen Verlust als Gewinnquelle entdeckt. Ein solches Jenseits oder sein Vorspiel ist der Dienst, in den ein junger Mensch sich unversehens, durch fremden oder eigenen Beschluss genötigt findet – ein erzwungener Vortod, den er als ein anderes, gleichermaßen ärmeres und reicheres Leben empfindet. In diesem Zustand geht es nicht um Gleichheit, sondern um Identität. Opfer und Täter, der Gedemütigte und der Demütiger, der Kranke und sein Wärter, der Analphabet und sein Helfer, der Hungrige und der satte Vertreter einer kämpferischen Organisation gehen darin eine verschwiegene Symbiose auf Zeit ein, in der die Zeit selbst – oder was man so nennt – einen nicht mehr zu löschenden Beigeschmack bekommt.
Dass Zeit schmeckt, dass sie ›einem schmeckt‹ – oder nicht –, gehört zu den Eigentümlichkeiten des Lebens, die erkundet werden müssen, will das Ich nicht, wie es heißt, ›auf der Strecke bleiben‹. Sie soll ja schmecken – warum sonst unternähme man solche Anstrengungen, sie zu füllen, und warum sonst unternähme man sie, wäre man nicht von der Angst besessen, sie könnte, für sich genommen, nach nichts schmecken? Irgendwann, wenn sie nach nichts mehr schmeckt, wenn es mit dem Schmecken an ein Ende gekommen ist, soll sie wenigstens nach Erinnerung schmecken, gleichgültig, welche vergangenen Ereignisse sich in ihr drängen. Nur eigen müssen sie sein, auf jeden Fall und um jeden Preis. Bloß was man selbst erlebt hat, ist etwas wert, das verleiht der ›kollektiven Erinnerung‹, wenn es denn so etwas gibt, den nicht wegzubringenden Beigeschmack des Unwahren.
Eine Erinnerung, die nicht die eigene war, auf Grund der unerbittlich verrinnenden Zeit auch gar nicht mehr sein konnte, aber durch Berichte, Filme, Interviews, familiäre Gespräche, Geschichtsbücher und Schulungskurse einen festen Platz im Leben jedes Einzelnen zugewiesen bekommen hatte, eine solche, durch die ihr innewohnende Gewalt jeden persönlichen Bezugsrahmen sprengende Zwittererinnerung verband den gelegentlich flüchtig zu mir hinblickenden jungen Mann mit den jungen Männern und Frauen, die ihm, auf verstreuten Küchenstühlen postiert und an Kühlschrank und Fensterbank gelehnt, größtenteils schweigend zuhörten. Sie verband sie wie die Enden eines beweglichen Gestänges, wie man sie an den Rädern alter Dampflokomotiven sehen kann. Jeder Zug und Druck, der am einen Ende ausgeübt wurde, kam als Druck und Zug am anderen Ende an. Gleichzeitig erlebten beide Seiten den Alltag der anderen als hinreichend vielgestaltig und verwirrend, um sich durch diesen Kolbenbetrieb in ihren gegenwärtigen Beziehungen nicht wirklich beirren zu lassen – oberflächlich betrachtet, denn wie es in den Tiefenschicksalen aussah, ließ sich nur schwer oder gar nicht ergründen. Es reichte aus, dass die Linie existierte, um die Dinge bei Bedarf zu stellen. Dieser allerdings hatte im Lauf der Jahrzehnte mancherlei Gestalt angenommen. Es gab sogar Leute, die glaubten, er sei ununtergebrochen gewachsen und beginne langsam die Gegenwart zu erdrücken. Das war ein Irrtum. Wie oft dieser junge Israeli dem Wunsch, sein Herz auszuschütten, auch bereits nachgekommen sein mochte: an diesem Ort, in diesem Land, vor dieser Zuhörerschaft verwandelte er sich in etwas anderes, in eine Versuchung und den Versuch, eine Reaktion herauszukitzeln, die so vielleicht nirgendwo sonst zu erwarten war, eine Nähe vielleicht, jedenfalls etwas, das beide Seiten berührte.
Der Bedarf war einfach polymorph geworden. Während im terroristischen Untergrund des Landes der Kampf gegen das ›faschistische System‹ auf eigentümlich irreale Weise weiter brodelte, hatte das Bedürfnis, der harten und gedankenlosen Gegenwart eine Art Medusenschild vorzuhalten, sich in den Kindern der Sekurität ein fein gesponnenes Netz aus Anspielungen erschaffen. Die Älteren, die man damit überrumpelte, empfanden es zumeist als ausgesprochen unfein. Dass sie gemeint waren, verstanden sie wohl, viele von ihnen hätten in manches gern eingestimmt, hätte nicht der erdrückende Vorwurf, ›es‹ nicht verhindert zu haben, den Positionswechsel verhindert – jedenfalls bei denen, die vergeblich in ihrem mehr oder weniger schlichten Leben nach dem Punkt forschten, an dem sie etwas hätten verhindern können. Das unbeirrbare Gefühl der Jüngeren, auf der besseren Seite zu stehen, nahm in der Regel auf lebensgeschichtliche Details keine Rücksicht oder ging einfach durch sie hindurch. Die Älteren wiederum, die sich unbeschadet ihrer Herkunft bei lebendigem Leibe zu hässlichen Überbleibseln einer anrüchigen Vergangenheit herabgewürdigt sahen, konnten oder wollten nicht das kollektive Selbstgespräch erkennen, mittels dessen die jungen Leute ein Unbehagen ausloteten, das sie ein Leben lang begleiten sollte. Es war dieses Unbehagen, das sie in früh gealtertem Manichäertum nach außen trugen, bis einige von ihnen in gereifteren Jahren geradezu erlöst nach den durchgeknallten Thesen eines in seinem Heimatland eher als suspekt gehandelten Historikers griffen, die ihnen, kulturgeschichtlich verbürgt, ein genozidales Gen attestierten und damit ihre Herkunft endgültig zur geschlossenen Anstalt erklärten.
Sie alle waren Gezeichnete eines Entsetzens, das sie in ihrer Kindheit getroffen hatte. Sie hatten, wie sie sagten, ›gelernt‹, sich als Angehörige eines Tätervolkes zu begreifen. Eben noch hatte Hiero, der als Widerstandsspross für sich den ›richtigen‹ Stammbaum in Anspruch nahm und keinen Wehrdienst geleistet hatte, vehement die Normalität der Republik gegen die falsche Herkunft ihrer Bewohner verteidigt. Dieser junge Mann hier appellierte an die verdrehte Psyche von Täterkindern, als erwarte er sich davon irgendeine Art von moralischem Aufschluss. Wer weiß, vielleicht lag darin sogar der Grund, aus dem er sich um ein Gaststipendium bemüht hatte. Schmeichelhaft für die Anwesenden war das nicht. Man konnte es sogar komisch finden, da die meisten den Dienst mit der Waffe ebenso erfolgreich wie guten Gewissens verweigert hatten. Dieser halbwegs verzwickten Lage entsprang eine diffuse Rührung und das Bedürfnis, den Gast aus der allzu nahen Ferne für ein weiteres Opfer des allgegenwärtigen ›Systems‹ zu halten. Was sie ihm bieten konnten, war wissende Solidarität. Man tat, als kenne man seine Lage schon länger, sozusagen von Haus aus. Dabei kannte man nichts davon. Die Kommunikation zwischen dem Redner und seinen wortkargen Lauschern bestand aus einer Folge von Missverständnissen, die bei jemandem, der ihr unbeteiligt gefolgt wäre, Heiterkeit hätte auslösen können. So glitt oder trudelte ich unerwartet rasch in die Position des Fragestellers hinein. Währenddessen kam Bewegung in die Erstarrten, sie gruppierten sich neu und verließen allmählich den Raum. Andere schauten auf der Suche nach einem Korkenzieher oder einem verlorengegangenen Gast herein und gingen, nachdem sie einen Blick auf meinen Gesprächspartner und mich geworfen hatten, wieder hinaus.
Er saß rittlings auf seinem Stuhl und sah mir durchdringend in die Augen. Sein Blick konnte als panisch und routiniert wie als hochmütig und innerlich abgewandt durchgehen. Der Mix war mir neu. Er bewog mich, die Grenzen der üblichen Anteilnahme zu überschreiten und dem jungen Mann nach der zweiten gemeinsam geleerten Flasche Rotwein das Du anzubieten, mit dem ich in diesem Hause, von Elisabeth abgesehen, noch immer kargte. Von der Gefährdung der Seelenruhe durch staatlich verfügten Waffenbesitz kamen wir rasch auf anders gestrickte Gefährdungen. Das Haus schien ihn überaus gastlich aufgenommen zu haben. Ich brauchte, vielleicht allzu verständlich, eine Weile, bis ich begriff, wen er meinte.
- ―Fuck you, sprudelte er – eine Form der Anrede, der gegenüber ich mich bis dahin eher reserviert verhalten hatte –, was treibt sie da draußen mit diesem Kerl, während ich hier herumsitze und meine Zeit in den Kamin schieße – heißt das so?
Durch derlei Wendungen erfuhr ich also aus dem Munde von Elisabeths neuem Liebhaber – gleichsam aus erster Quelle –, dass man auch auf einen Tronka eifersüchtig sein konnte, über dessen sexuelle Orientierung wir uns bald einig wurden, ohne dass es den Groll meines Gegenübers im mindesten sänftigte. Im Gegenteil: er steigerte sich in eine Reihe seltsamer Verdächtigungen hinein. Für Leckebuschs Noch-Assistenten besaß die Wissenschaft offenbar nicht nur einen Vorder-, sondern auch einen Hintereingang, den er genauso oft oder häufiger noch passierte. Stets, wie ich unterstellte, auf der Suche nach einem neuen Argument, einer neuen Denkfigur oder auch nur einem Lektüretipp, aber offenbar auch nach le temps perdu, der verlorenen Zeit, die sich im aufgeschobenen Dasein des Gelehrten ungleich intensiver zu Wort meldet als in dem eines Schornsteinfegers.
War es nicht Tronka gewesen, der energisch auf einem gegen die Gestörtheiten des Wissenschaftszirkus abgeschotteten Privatleben bestanden hatte? War es nicht Tronka, der zwanghaft allem auswich, was auch nur entfernt als ›akademisches Leben‹ durchgehen konnte, von den Leckebusch-Abenden einmal abgesehen, auf denen er sich aus naheliegenden Gründen hin und wieder blicken ließ? War es nicht Tronka, der pünktlich zu Beginn der Semesterferien in immer neue Fernen aufbrach, in denen die großen Museen und Inszenierungen lockten, abgeschiedene Inselwelten und die realen Genüsse einer weltumspannenden Gemeinschaft von Leuten, die Bescheid wussten? War es nicht Tronka, der, vom Dämon des nächsten Buches geritten, seine Nächte mit dem Entwerfen kostbarer, Seiten übergreifender Bandwurmsätze verbrachte, in denen der Drache des Absoluten ein ums andere Mal ein teures Haupt oder eine minder teure Klaue einbüßte und eine subtile Rekonstruktion nach der anderen das Spektrum des philosophisch Vertretbaren unaufhaltsam verschob? War es nicht Tronka, der noch vor wenigen Tagen von den Trauben der Philosophie geredet hatte, die höher hingen, als es sich der Verfasser einer Standardeinführung in die Kritik der reinen Vernunft träumen ließ? Wie stand es um die Trauben, die erst kürzlich durch den Einsatz meiner Lebenszeit veredelt und in eine andere Dimension verschoben worden waren? Gab es hier keinen Ehrenkodex, der die Wissenden und Integeren vom Plebs trennte? Keine höhnische Abfertigung des Durchschnitts und seiner Weisen, sich durchzuwursteln?
Andererseits, da ich nun einmal dabei war: Was ritt Elisabeth, sich des Austausch- und Nachwuchsprogramms ihres Mannes neuerdings in dieser Weise zu bedienen? Hatte sie das nötig? War das noch dieselbe Elisabeth, die ich kannte? Mühelos imstande, all diese Fragen in Windeseile hervorzulocken, verhinderte der Alkohol, dass ich mich auch nur mit einer von ihnen gründlicher befasste oder sie – welche Zumutung! – einer Lösung zuführte. Nur dass es langsam spät wurde, dämmerte diesem umwölkten Gehirn, das ich nur mehr eingeschränkt als das meine betrachten wollte.

Mechtels Versuch
Niemals war Hiero mehr Held als in diesen Tagen. Er hatte den Kampfplatz aufrechten Hauptes verlassen. Das Gerücht, er habe nicht nur Kärich Paroli geboten, sondern die gesamte bei Leckebusch versammelte Professorenschaft aufgemischt, umgab ihn, wo immer er auftauchte, mit einer wilden Aura. Einzig Pw wagte es, zweideutige Bemerkungen zu machen, wobei er den Finger in die Bierflasche steckte und mit einem Plopp wieder daraus befreite. Mechtel hingegen, die wenig redete, aber fraulicher wirkte als sonst, stand eines Abends vor Hieros Wohnungstür und begehrte, ohne den Grund ihres Kommens zu erläutern, Einlass. Sie sprachen über mancherlei, jeder fand den anderen verständiger als sonst, gleichsam gewachsen, mit einem Schuss Weltverstehen, den man bis dahin immer ein wenig vermisst hatte. Das war ein schwieriges, zu mancherlei Verhakungen führendes Thema, das sie sorgfältig aussparten, ein mitwandernder blinder Fleck, der ebendeshalb unauffällig seine Nahrung aus allem zu saugen vermochte, was gesprochen wurde, bis sie gegen Mitternacht, schweigend nebeneinander sitzend, im Ohr ein von Hiero erst vor wenigen Tagen erstandenes Gitarrensolo, zwischen Tisch, Gestühl und Bücherregal seiner ansichtig wurden – ein wabernder Nebel, zart, durchscheinend, rauchartig, keineswegs ohne Reiz, aber seltsam unbeteiligt, tentakelnd, tentativ –
Und sahen einander an: Sie kannten den Satz und hüteten sich, ihm Folge zu leisten. Hiero jedenfalls fand, dass ihre Plauderei fade zu werden begann und sehnte sich nach einer den Tag bündig abschließenden Lektüre. Lange wählte er zwischen Spinoza und Kant, obwohl er bereits beschlossen hatte, mit Blick auf gewisse anstehende Entscheidungen sich noch einmal gründlich mit Russell zu befassen, aber Mechtel, in der ein kleiner aufmerksamer Geist tickte, durchkreuzte diese Pläne. Sie stand auf, legte sich aufs Bett und fragte ihn mit zur Decke gerichtetem Blick, ob sie über Nacht da bleiben könne. Zweifellos hatte er so etwas geahnt, er hatte es ›im Gespür‹ gehabt, fühlte sich aber im Stich gelassen, wenn er sich fragte, wie es dazu kommen konnte und welche Rolle Hans-Hajo dabei spielte. Mit ihm hatte er sich gerade gestern ausnahmsweise blendend unterhalten und er erschien ihm zwar nicht als der hellste, aber als ein durch und durch integerer Zeitgenosse. Die zarten Keimlinge einer beginnenden Freundschaft verbanden wohl tiefer als gedacht. Mechtel, der schwante, dass etwas schief lief, versuchte instinktiv gegenzusteuern. Anders als ihr für diese Nacht erkorener, ein wenig schweigsamer Held konnte sie sich kein anderes Hemmnis vorstellen als mangelnde eigene Attraktivität – ein Fehler, aber kein besonders tiefgehender. Es war die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, und sie galt immer. Hätte die Anziehungskraft die Bedenken, die im Raum standen, überwogen, dann wäre kein Halten gewesen: ein analytischer Satz, der tief zwischen Mechtels etwas dünnen, aber eindrucksvoll konturierten Augenbrauen stand, als stummes, gefährliches Fragezeichen, das sich dem männlichen Blick darbot und sein Urteil erwartete.
Warum? Die Situation schien eindeutig. Es lag an Hiero, sich ihr zu stellen. Mechtel durfte sich attraktiv genug fühlen, um erwarten zu können, dass die Lösungen, die er vorschlagen würde, auf der von ihr angedachten Linie lagen. Es war ihr gutes, durch Spiegel- und Männerblicke tausendfach beglaubigtes Recht. Das stumme Fragezeichen durchkreuzte das Spiel. In Hieros nach Auswegen strebender Psyche wurde es zum Messer, das jede Berührung verbot. Immerhin handelte es sich bei der vis attractiva, der metaphysisch gedeuteten Anziehungskraft, um eine zweideutige Größe. Theoretisch gesprochen, gehörte sie ins siebzehnte, allenfalls ins achtzehnte Jahrhundert, wo sie kurzfristig den Zusammenhalt der Schöpfung im Liebesbund regeln durfte – eine belächelte Theorie, mit der man gewiss nicht im Pfau aufkreuzen konnte, es sei denn, man war auf einen faden humoristischen Effekt aus, wie er eigentlich nur Hans-Hajos Gehirn entspringen konnte. Apropos Liebesbund: wenn überhaupt von so etwas hier die Rede war, dann galt es, allein schon der Inszenierung wegen, für die Beziehung, in der Hans-Hajo und Mechtel lebten. Zu offensichtlich waren sie einander auf Kosten ihrer Umgebung zugetan, als dass man diesen Punkt hätte verkennen können. Im Gegenteil, so, wie sie ihn immerfort in den Vordergrund schoben, wäre es wohl einem Affront gleich gekommen, ihn zu übersehen. Mechtels Illoyalität strafte diese Inszenierung Lügen. Das wäre noch zu verkraften gewesen, aber es enthielt die Aufforderung zur Respektlosigkeit gegenüber einem Modell einer Zweierbeziehung, das zwar als störend empfunden werden konnte, weil es Mechtels Selbstbestimmtheit in Zweifel zog – die sie andererseits durch die Wahl dieser Art von Beziehung bestätigte –, aber, im Gegensatz zu anderen, nicht als beliebig relativierbar, so dass man darüber in der Praxis zur Tagesordnung hätte übergehen können. Das Anstößige lag ja darin, dass es Respekt forderte, nein, dass diejenigen, die es praktizierten, für ihr Tun und damit für sich selbst diesen Respekt forderten, der ihnen leise zähneknirschend von den weniger Glücklichen auch gewährt wurde. Mechtel, Mechtel, sprach eine leise Stimme in ihm, du führst uns alle vor, mich, Hans-Hajo, die anderen, dich selbst vor allen anderen, wie hast du dir das gedacht? Ja wie? Gute Frage, nächste Frage. Wenn es das ›daimonion‹ war, das so in ihm sprach, dann sprach es jedenfalls aus gekränkter Eitelkeit. Die Aufforderung zur Respektlosigkeit gegenüber ihrer Verbindung enthielt auch eine Respektlosigkeit gegenüber denen, die durch sie in Schach gehalten wurden, jedenfalls auf Distanz, um das Schlüsselwort ihrer Gespräche zu benützen, eine Rücksichtslosigkeit, soweit es ihn betraf, dessen Bett sie blockierte. Was tun? Mit Phrasen Leninscher Provenienz war die Situation nicht zu meistern, sie war überhaupt nicht zu meistern, ein ›Meister der Situation‹ hätte sie zu diesem Zeitpunkt bereits geklärt gehabt – in dieser wie in jener Richtung, auf diese oder jene, jedenfalls eine der bekannten Weisen, die für einen ernsthaft denkenden und empfindenden Menschen wie ihn eher Hürden darstellten, die zu nehmen mit der Lächerlichkeit eines Luftsprungs einherging, der er sich nicht auszusetzen wünschte. ›Nimm mich‹, sagte die junge Frau auf seinem Bett. Sie sagte es, wenngleich nicht mit Worten, laut und vernehmlich, aber nicht ihr Körper war es, der so sprach, es war dieses sperrige Wesen, das sich etwas darunter vorstellte, von dem er nicht wusste, ob es ihm schmeicheln oder ihn kränken sollte.
Mechtel, die ihren Helden recht gut zu taxieren wusste, beunruhigte das nicht, sie war sich relativ sicher, den Denkprozess steuern zu können, dessen Aufkommen und Fortgang sie an Hieros Händen ablas, kernigen Fernfahrerhänden, die fortwährend zitterten, als warteten sie darauf, in die Hand genommen und beruhigt zu werden. Sie war bereit, es zu tun, vielleicht war sie nur deshalb vorbeigekommen, weil diese Hände in ihr fortzuzittern begonnen und ein physisches Bedürfnis ausgelöst hatten, sie durch einen Satz geeigneter Maßnahmen in hart und geschmeidig ihren Dienst verrichtende Männerfäuste zu verwandeln. Sicher war das nicht die ganze Wahrheit. Aber wenn es an der neueren Philosophie einen Punkt gab, der sie aufhorchen ließ, dann diese von den verschiedenen Richtungen unisoso vorgetragene Bereitschaft, den Wahrheitsbegriff einfach fallen zu lassen und durch geeignetere, handlichere und der Erkenntnislage angemessenere Termini zu ersetzen. ›Wahrheit, was ist das?‹ murmelte ein halb aufgebrachtes, halb seiner Sache sicheres Es, während Mechtels Blick zwischen Kopf und Hand hin und her glitt. Es ärgerte sie bereits, dass sie die Attraktivitätsfrage überhaupt zugelassen hatte, und sie beschloss, sie ganz nach hinten zu schieben, was recht gut gelang, aber nicht verhindern konnte, dass sie untergründig im Spiel blieb. Es ist leichter, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen als den Selbstzweifel. Sie ist die innere Stimme, die jeden falschen oder zweideutigen Vermittlungsversuch ausschlägt, während der Selbstzweifel überall dort nistet, wo jemand seine Haut zu Markte trägt, und die Zweideutigkeit nährt, die ihn hervorbringt. Eine vielleicht nicht schöne, aber hinreichend attraktive Frau kann auf ihn nicht verzichten; der für die geschmeidige Fortbewegung im sozialen Raum so unendlich wichtige Beobachtungsposten zwischen Innen und Außen bliebe ohne ihn unbesetzt. Umso wichtiger erschien es, sich durch die innere Stimme nicht irritieren zu lassen, die darauf bestand, dass das, was sie gegenwärtig trieb, nicht ›recht‹ sei, nicht vereinbar mit einer ganzen Textur aus Vorstellungen und Empfindungen, die sie augenblicklich nicht zulassen wollte – wobei dieses ›augenblicklich‹ sich von Augenblick zu Augenblick fortschrieb, in eine weiße, unbeschriebene Zukunft hinein, in der jene hergebrachte Textur verblasste und sich nach und nach ganz verlor. Wenn es nicht recht war, so musste es jedenfalls sein. Mit Hans-Hajo hatte das wenig, eigentlich nichts zu tun, es war besser, ihn aus dem hier herauszuhalten, obwohl es andererseits die Quintessenz vieler Gespräche bildete, die sie mit ihm geführt hatte. Ob er das so sehen würde, war, jedenfalls solange die Situation anhielt, schwer zu ergründen, es war besser, es gegen seinen Blick abzuschirmen, der an so mancherlei vorbeisah, ohne dass es, wie man hätte annehmen mögen, ihm ganz entging. Die absolut lächerliche Idee des Seitensprungs erinnerte sie, wie sie da lag, an das Bild von Klee mit dem ironischen Titel Hauptweg und Nebenwege. Vielerlei Wege liefen darauf nebeneinander her auf etwas zu, das aus der Ferne wie eine Wand aussah, etwas Undurchdringliches jedenfalls, mit dem die Wege auf eine unklare Weise verschmolzen, so dass sie zugleich endeten und nicht endeten, ineinander aufgingen und einfach verschwanden. Der Hauptweg war einfach der, auf den man gerade hinblickte und von dem man den Blick sofort wieder abwandte, da er in seiner Geradheit keinerlei Anreiz für weitere Nachforschungen bot.
Überhaupt die Kunst. Die Kunst, etwas als etwas erscheinen zu lassen, keine Kunst eigentlich, eher ein Spiel, aber eines, das sie mit Macht ergriff und fortzog zu etwas, was wohl die Philosophie war, aber anders, als Hiero sie interpretierte, falls dieses Wort auf seine Situation bezogen werden durfte, denn es war ein Unwort in diesem Kreis, in dem alle an irgendeiner ›Interpretation‹ saßen, sei es die Examensarbeit, sei es die Dissertation, nachdem sie ein ganzes Studium nichts anderes gelernt hatten als zu interpretieren. Aber Interpretieren hieß das eigene Urteil ausschalten, den Weg zu den Sachen zu überblenden, ihn zwischen den vielen Nebenwegen zu verstecken, so dass er, obwohl er an sich klar zutage lag, kaum von ihnen zu unterscheiden war, eigentlich gar nicht, da seine Sichtbarkeit daran hing, einer von vielen zu sein und damit einer von ihnen. ›Zu den Sachen‹ – eine sehr männliche Phrase, die sie sich da zu eigen machten, die Herren Philosophen, ob zu Recht, daran konnte man, wie an manch anderem, zweifeln, andere machten da weniger Umstände, sehr viel weniger. Umstände machen, auf Nebenwege geraten und sie mit derselben Langsamkeit und Umständlichkeit ausmessen wie den Hauptweg, der mittlerweile leer und verlassen dalag, ausgedörrt von der Mittagssonne, von Regen aufgeweicht und geflutet, wer mochte da hinschauen? Das war doch eine berechtigte Frage, sie hatte sie sich so nie gestellt, aber in gewisser Weise war sie unumgänglich und man musste sich ihr stellen. Besser jetzt als nie. Oder: besser irgendwann als nirgendwann? ›Nirgendwann‹? Was für ein Wort. Sie spürte den verderblichen Einfluss dieser Art des Sprechens und fragte sich, was ein Sprachanalytiker dazu sagen würde, sie fragte nicht wirklich, eher schob sie damit einen Bremsklotz in den Fluss der Gedanken, unbrauchbar, wenn es darum ging, ihn aufzuhalten, aber überaus brauchbar, wenn es darum ging, ihn an dieser Stelle abzulenken und einen kleinen Wirbel zu verursachen. Mach doch keinen Wirbel! Das hatte sie oft gehört, meist von Leuten, die selbst darauf aus waren. Die einfachste Art, einen Wirbel zu machen, bestand darin, sich einem Mann aufs Bett zu legen und zuzusehen, wie die Maschine in Gang kam, zu einfach normalerweise, doch... Hiero war ein zäher Brocken, der langsam in Fahrt kam, das wusste sie. Andererseits... Pw lachte, wenn die Rede auf Hieros Sexualverhalten kam. Er besaß keinen privilegierten Zugang zu Informationen, aber er wusste Bescheid, dort, wo die Kerle anscheinend gleich tickten, sie lebten es nur anders aus, in Maßen anders, sehr einfallsreich wirkten sie nicht, eher stromlinienförmig, aber was war das für ein Strom, der sie mit sich fortführte? Andererseits war das ein Vorwurf, den sie schon von ihrer Mutter her kannte, leisetreterisch, tückisch, inakzeptabel, wer weiß, was diese Frauen erlebt hatten, der sichtbare Teil ihrer Existenz gab es nicht her.
- ―Mechtel, ich kann nicht –
Was sagte der Bursche da?
- ―Ich kann nicht.
Si tacuisses. Das war deutlich. Es gab der Sache eine andere Richtung.
- ―Dann werde ich wohl mal gehen.
- ―Du kannst ruhig bleiben. Ich meine, ich lege mich dann aufs Sofa.
Fast hätte sie ›Ach so‹ gesagt, aber sie schluckte es hastig hinunter.
- ―Du verstehst mich nicht. Ich kann wirklich nicht. Ich meine, Hans-Hajo ist mein Freund, er ist unser Freund, ich meine, er gehört einfach dazu...
- ―Was kannst du nicht?
- ―Bitte... wenn du meinst.... Soll ich es dir erklären?
Alles, nur nicht das. ›O Gott‹ sagte man in ihren Kreisen dazu, es war eine läppische Phrase, abgerissen geradezu, aber immerhin einer der letzten Verbindungsstege zur Religion, also irgendwie kostbar, jedenfalls rituell. Seltsamerweise hatte sie bisher keine Sekunde daran gedacht, dass die Situation peinlich werden könnte. Die Woge, die sie hergetragen hatte, ließ diese Vorstellung nicht zu, was irgendwie seltsam war, denn, ehrlich gesagt, wäre ihr der Gedanke an eine solche Szene noch vor einer Woche lächerlich, geradezu bizarr vorgekommen. Hieros Selbstermannung – es musste irgendeine Art von Selbst sein, das sich ermannt hatte, den versammelten Professoren seine Wahrheit ins Gesicht zu schleudern, eine andere Instanz war nicht denkbar – hatte die Parameter kurzfristig verändert, gleichsam ein Fenster der Empfänglichkeit geschaffen, das sich langsam zu schließen begann.
Mochte er Skrupel haben oder nicht, Tatsache war, dass Hiero sich unbehaglich und zunehmend ›verarscht‹ fühlte. Das lag weniger an Mechtels wirklichem Verhalten als daran, dass er es nicht zu deuten wusste. Sie hatte sich ihm aufs Bett gelegt, was, immerhin, einer Einladung gleichkam. Er wäre auch bereit gewesen, diese Einladung anzunehmen, aber da begannen die Fragen. Durfte er sie annehmen? Aber gewiss doch, was sprach dagegen? Hans-Hajo war eine Luftnummer, nicht der Rede wert, jedenfalls mit dem Finger wegzuschnipsen, wenn es darauf ankam, kein wirklicher Grund zur Besorgnis. Was lag ihm am Umgang mit einem Mann, der die Kritik der reinen Vernunft vornehmlich als Unterlage für sein Frühstücksbrötchen benützte – jedenfalls hatte er ihn einmal dabei beobachtet, wie er es heimlich im Seminar über seinem aufgeschlagenen Exemplar auswickelte –, mit einem Mann, der sein Verhältnis mit Mechtel offenbar so wenig im Griff hatte, dass sie jetzt aufgeschlagen und bereit zur Lektüre vor ihm lag? Nein, nicht Hans-Hajo war es, der ihn beschäftigte, nachdem der Liebespakt zwischen den beiden sich als krasser Betrug an der Gruppe enthüllt hatte, es war Mechtel selbst, die ihm Rätsel aufgab, so, wie sie sich gab, spottbereit und willig, sich zu bedienen, aber genausogut fähig, aufzustehen und das Lokal zu verlassen, falls etwas am Mahl ihr nicht behagte. Im Prinzip hatte er nichts gegen diese Art Promptheit, aber bei Mechtel paarte sie sich mit dieser Tendenz, sich zurückzunehmen, die ihr den Spitznamen ›Fräulein Portiönchen‹ eingetragen hatte: Es war nicht gut, sich vor ihr zu entblößen oder entblößt zu geben, da man jederzeit gewärtig sein musste, einen Stich zu erhalten, gerade dann, wenn man sich auf der sicheren Seite wähnte. Im Umgang mit Mechtel gab es keine sichere Seite. Schon der Gedanke daran verbot sich – hätte einer aus der Gruppe erraten, dass es so um ihn stand, so wäre das einer Selbstauslieferung gleich gekommen, von deren Folgen man sich nicht so leicht wieder erholte.
Er wusste nicht, was geschehen würde, wenn er sich jetzt neben sie setzte und sie bei der Hand nähme oder den Arm um sie legte. Er wusste es wirklich nicht und das war, alles in allem, ein bisschen viel Wirklichkeit für so einen Anlass, ein klein bisschen zuviel für seinen Geschmack, wenn der hier in Betracht kam. Sie erinnerte ihn an eins dieser Spielzeuge, die die Kinder in Nicaragua von den Feldern auflasen und die ihnen dann ins Gesicht explodierten oder den Arm abrissen. Sollte er ein solches Risiko eingehen? Offenkundig nicht. Besser war es, sich ruhig zu verhalten und das Objekt nicht aus den Augen zu lassen, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickelten.
Aber so einfach lagen sie nicht. Hätte Mechtel ihn vorhin sachte berührt oder mit einer unverfänglichen Geste ein Mehr eingefordert, so wäre er, verwundert vielleicht, jedenfalls gerührt, darauf eingegangen und alles weitere hätte sich ergeben. Stattdessen hatte sie es vorgezogen, dem Mann in ihm zu schmeicheln und ihn im Regen stehen zu lassen. Suchte er Unterschlupf, so lief er Gefahr, sich zu verletzen, blieb er standhaft im Freien, so klang ihm jetzt schon der Hohn in den Ohren, versagt zu haben. Worin? Wozu? Musste er sich dem aussetzen? In ihm brauste es, sobald er nur daran dachte. Er konnte sie jederzeit hinauswerfen und so, wie die Situation sich ihm darstellte, erschien ihm das als das Gegebene. Es war eine Option, die genau überlegt sein wollte, so eindeutig sie sich als Handlung darstellte, so viele Missverständnisse konnte sie provozieren. Nein, entschied er, hinauswerfen war keine Lösung, er merkte, wie die Empörung angesichts dieser Wendung zurückglitt und eine Woge bitteren Einverständnisses mit seiner Herausforderin ihn durchflutete. Sie hatte ja recht, wenn sie ihn in seiner Behausung stellte, der Biedersinn um ihn her fing bereits an, auf ihn abzufärben, so gesehen waren sie Verbündete, zwischen denen der Funkkontakt im Moment nicht recht klappte, das ließ sich beheben. Lotta continua. Und er erhob sich, unhörbar ächzend – jedenfalls hoffte er, dass sie nichts gehört hatte –, von seinem Stuhl, blinzelte ihr wohlwollend ins Gesicht. Niemals war er ihr so dämlich vorgekommen wie jetzt, sie musste sich zusammennehmen und merkte, dass es an ihr lag, ob ihr übel wurde oder sie die Kontrolle über sich und die Situation behielt. Beides hatte Vorzüge, die gegeneinander abgewogen werden wollten. Im Parlament der Lüste herrscht immer Betrieb. Die kleine haarige Abgeordnete vorne links schien ihr am besten geeignet, den Konflikt zu lösen, sie wartete gespannt auf ihren Redebeitrag, doch vor der Hand bewegte sich auf der Tribüne nichts, fast schien es, als strebten alle einer Pause zu. Nein, dieses Plenum war augenblicklich nicht gut besetzt. Wichtige Abgeordnete fehlten, die Regierungsbank blickte verwaist, der monotone Redefluss der Haushaltsexpertin produzierte allenfalls Subtext, alle Eckdaten waren bekannt. Sie hatte einen Helden erwartet und bekam nun den Abwasch. Er hatte eine Schwelle überschritten und sie war ihm nachgegangen. Vielleicht hatte er etwas getan, was sein Leben änderte, so etwas schien gut möglich, ihr sechster Sinn sagte ihr, dass es passiert war, zum Guten oder Bösen, sie war bereit gewesen, ihm, Johnny oder nicht, zu folgen, aber er war, wie es schien, bereits angekommen. Wenn er je an Aufbruch gedacht hatte, dann endete er hier, unter dem trüben Blick dieser Lampe, die nicht eigentlich schwach, aber unendlich fad seinen Alltag oder besser: seine Allnacht beleuchtete. Im Schein dieser Lampe oder einer aus der endlichen Reihe ihrer Nachfolgerin würde er auch in zehn, zwanzig Jahren seinen Kant aus dem Regal fischen oder seinen Spinoza befragen. Die Zeit stand still, in Raum verwandelt, wallte sie ihr von den Wänden entgegen, aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war sie selbst, durchdrungen von diesem Fluidum, in einem Zustand der Halbauflösung, fadenscheinig bis in die Haarwurzeln, ganz und gar durchdrungen von einer Aussicht, die nicht die ihre war, von der sie sich aber erfasst und bei lebendigem Leibe verschlungen fühlte – mon Dieu. Ein, zwei Zeilen von Valéry geisterten durch den hohlen Raum und verbrannten zischend zwischen den Zweigen eines Ölbaums:
...
ist wie ein Glas, das man durch Wasser schwang
und
setzt das reine Denken nicht in Gang.
Hiero, der mich tags darauf, aus welchem Impuls auch immer, haarklein über die Geschehnisse dieser Nacht ins Bild setzte, wusste von solchen Regungen nichts, er ahnte sie nicht einmal. Seine Rede blieb detailliert und verworren, um nicht zu sagen konfus, sie eröffnete weite Spielräume für Interpolation und Interpretation, die ich umgehend nutzte, als ich mich auf den Heimweg begab und den Bericht Punkt für Punkt rekapitulierte. Die Fahrt dauerte lang, Lastwagenkolonnen ohne Ende, umhüllt von Regenfahnen, gaben das Tempo vor. Das Gespräch der beiden klang mir im Ohr, sein Übergang in den anderen Zustand, den sie zwar herzustellen wünschten, aber nicht zu gestalten wussten, entlockte mir ein Lächeln, das nicht sehr weit reichte, eine melancholische Tour de force, denn ich konnte mich gut an ähnliche Sequenzen erinnern. Nein, ich brauchte mich nicht an sie zu erinnern, sie waren eins mit dem Stoff, den Hieros in diesem Punkt eher unbedarfte Rede aus mir hervorwühlte – mit einer gewissen verhaltenen Gewalt, die tat, als könne man ihr Wirken an jeder Stelle unterbrechen oder als hafte ihr eine gewisse Unschlüssigkeit an, sich zu materialisieren, was aber keineswegs der Fall war. Ein steter Strom von Pseudoerinnerungen gestaltete diesen Abend, als sei es mein eigener gewesen, wechselhaft und detailreich, angefüllt bis zum Rande und eher zu vielgestaltig, als dass dies alles in einem wirklichen, dem steten Fortschreiten der Zeit anvertrauten Geschehen hätte Platz finden können. Hier die etwas verloren wirkende Diva, von einer Weiblichkeitsrolle bewegt, die sie keinem Drehbuch in ähnlicher Dichte hätte entnehmen können, von der sie sich aber ›bestimmen‹ ließ bis in die Bewegungen ihrer Brauen hinein und die Art, wie sie ihre Fersen auf die Bettkante legte – alles unspektakuläre Gesten, jedoch von großer Reichweite, durchdrungen von dem Wunsch, zu einer Entscheidung zu kommen, sie sich notfalls zu erfinden, auf jeden Fall aber zu holen, so wie man sich eine Influenza holt, nur ohne den dringenden Wunsch, es möge sich hier und jetzt so ergeben, dort der eher armselig wirkende, sich in eine kindliche, vermutlich von Mutter herrührende Trotzhaltung hineinsteigernde oder eher hinabbegebende Kandidat, der jedoch bis in jede Faser seines Nichtstuns hinein der Held blieb, als den Mechtel ihn konzipiert hatte und den sie jetzt vor sich hertrieb – mit einer gewissen Gnadenlosigkeit, im übrigen ›voll der Gnade‹, die umzusetzen sich wohl oder übel eine Gelegenheit bieten musste. Das alles hatte sehr wenig mit der Philosophie zu tun, der sie sich beide verschrieben hatten – er mehr, sie weniger, aber so etwas konnte sich an bestimmten Punkten der Entwicklung leicht umkehren –, weniger als nichts, es war ihr negatives Abbild in einem Material, in dem zu arbeiten sie sich scheute, seit Psychologen und Romanschreiber dieses Feld beherrschten. Der Durchbruch, an dem Mechtel arbeitete, war zweifellos von langer Hand geplant gewesen, nicht von ihr, schon eher von Leuten, denen zu begegnen sie niemals Gelegenheit hatte, was sie meist gleichgültig ließ, aber in gewissen Momenten in eine nervöse Spannung versetzte: Leuten wie Proust oder Döblin, lauter Männern, die zwar wenig von Frauen, aber viel vom Maskenspiel des Begehrens verstanden und bereit waren, ihm weibliche Namen zu geben, auch wenn es gegen ihre eigene Natur ging. Seit den Tagen jener Heroen existierte eine Philosophie des Begehrens, die am hiesigen Seminar, von Außenseiter Ruffmann abgesehen, den niemand ernst nahm, nicht gelehrt wurde und nur geeignet schien, Kärichs Verachtung auf den Plan zu rufen. Vermutlich war es auch keine Philosophie, sondern schrieb nur eine Syntax fort, die von den Literaten aufgebracht worden war, eine Weise, die Regungen zu ordnen und die Gesten in bestimmte Folgeverhältnisse zu setzen, die sich, ohne dass man lange darüber nachdenken musste, dialogisch nennen ließ und geeignet erschien, die primitive freudianische Matrix, von der keiner unter den Lebenden loskam, in etwas zu überführen, das den menschlichen Gedanken- und Erfindungsreichtum weniger beleidigte. Mechtel kannte die drei Kränkungen des Ich, die der Meister des Hokuspokus den Einwirkungen der Kultur zuschrieb. Sie kannte sie ausnehmend gut, denn sie hatte erst kürzlich eine Hausarbeit über sie geschrieben und aus diesem Anlass lange Gespräche mit Hans-Hajo geführt. Angetan hatte es beiden vor allem die vom Darwinismus ausgehende biologische Kränkung. Genau genommen hatten sie einfach nicht begriffen, worin sie bestand. Auch wenn man die Herausforderung zugab, die für ein religiöses Gemüt in der Vorstellung eines Menschentiers liegen musste, das genetisch aus anderen hervorgegangen war und vielleicht nur ein Glied in einer nach ›oben‹ offenen Reihe darstellte, so lag doch die Herausforderung eher andersherum und war offenbar auch in den Zeiten eines starken Glaubensbedürfnisses ganz entsprechend aufgefasst worden. Dass man ›den‹ Menschen ›durchaus‹ wie Vieh ansehen und behandeln konnte, entsprach der Natur der Dinge und der Profanität seiner Bedürfnisse, darin lag nichts Besonderes, verglichen mit den phantastischen Möglichkeiten der Erlösung und des Fortlebens nach dem Tode, ganz zu schweigen von der lebenslangen Betreuung durch einen unsichtbaren und außerordentlich schweigsamen göttlichen Begleiter. Man kann sich von den Zumutungen der Religion bequem in naturalistischen Vorstellungen entspannen, es dient offenkundig der Erholung und kommt der Gesundheit des Geistes zugute, der sich unter einer jenseitigen Abkunft ebenso wenig vorstellen kann wie unter den Zahlenspielen der Trinitätslehre und ähnlichen Ärgernissen eines willkürlichen Vernunftgebrauchs. Man muss schon ein naiver Geisteswissenschaftler sein und nicht durchschauen, dass der Glaube an die Geschichte nichts weiter darstellt als ein Derivat des Erlösungsglaubens, um das Märchen von der plötzlichen Entdeckung der Vernunft durch die sogenannten Aufklärer zu... ja was denn? Zu glauben? Gutzuheißen? Fortzuschreiben durch Entdeckungen, die man selber zu tätigen beabsichtigt? Woher dann der Überdruss an der Vernunft, die Kette der Versuche, sie mittels magischer Begriffsverwischungen wieder in die Körper hineinzupraktizieren, deren genetische Entwicklung sie so natürlich aus allen möglichen Funktionshäppchen hat hervorgehen lassen? Ob man das Ding, das denkt, Gen oder Ich nannte, kam am Ende auf dasselbe heraus, vielleicht nicht ganz, da man dem Gen damit den Sprung aufbürdete, der im Ich stets bereits vollzogen war, den Sprung ins Bewusstsein, dessen Realität zu leugnen einige Möchtegern-Wortführer nicht müde wurden, obwohl ihre Ausführungen alle an demselben Punkt lahmten und außerordentlich ermüdend aufs studierende Gemüt wirken konnten.
Seltsamerweise tat sich an dieser Stelle zwischen ihr und Hans-Hajo ein Spalt auf, über den zu lachen sie niemals versäumten, ein Spältchen nur, das aber den Blick in jenen veritablen Abgrund preisgab, dessen Empfindung in mir so stark gewesen war, als Elisabeth sich vor Rennertz und mir dem Rausch der Entblößung hingegeben hatte. Die Frauenforschung hatte noch nicht jene absonderlichen Blüten getrieben, die wenig später dem grammatischen Geschlecht von Mülleimern und Gießkannen einen schicksalhaften Einfluss auf das Los der Weiber hinieden zuschrieb, sie steckte noch in den Kinderschuhen, auch wenn von Kindern dabei selten die Rede war. Es herrschte der symbolische Phallus. Er war aus der gesellschaftspolitischen Überforderung des realen hervorgegangen und hatte sich zum Antreiber aller menschlichen Dinge – fast stünde jetzt hier: gemausert, aber etwas an dem Ausdruck gebietet mir Einhalt. Der symbolische Phallus hatte den durch die zurückliegenden Bemühungen der hermeneutischen Schule kräftig angeschwollenen Ödipuskomplex in eine handlichere Form überführt und sich als feste Größe eingeführt, als ungefragter Begleiter in allen Lebensfragen, angefangen vom Schuhkauf bis hin zu den gehobenen Formen der Kleptomanie und des sexuellen Gewaltkonsums. Ein warmes Plätzchen, das war es, was sich eine Riege von wohlsortierten Frauen in seinem akademischen Windschatten ergattert hatte, aus dem heraus sie die Männerszene mit schneidendem Hohn kommentierte. Irgendwie unangenehm. Mechtel zuckte leicht zusammen, wohl wissend, dass die Männer sie selbst als scharfzüngig empfanden. Darin bestand vielleicht das Los der intellektuellen Frau. Umso merkwürdiger, dass Hans-Hajo solchen durchsichtigen Aktivitäten mit dieser Ehrerbietung begegnete, die manchmal die Ehrfurcht vor dem Heiligen streifte. Es beeinträchtigte ihr Gespräch zwar nicht, fügte ihm aber Unter- und Nebentöne hinzu, vor denen sie sich beinahe fürchtete, da es ihr allmählich so vorkam, als müsse sie an diesen Stellen für ihn mitdenken und werde dafür mit Nichtglauben, ja sogar einer leise feindseligen Gegenwehr bestraft. Das gab ihr, in seltsamer Anwendung einer auf der anderen Seite im Schwange befindlichen Denkfigur, die starke Empfindung ein, mit einem durchgestrichenen Mann zusammen zu leben. Sicher hatte das seine Annehmlichkeiten, die Beziehung erhielt dadurch geschwisterliche Züge, aber dass etwas daran nicht stimmte, wurde ihr schmerzlich bewusst, wenn sie den magnetischen Sprüchen Pws lauschte, dem sie seit langem ein Türchen offenhielt. Von Haus aus feige, hütete er sich, hindurchzugehen.
Sie sah es mit leiser Enttäuschung und mildem Spott. Hiero hingegen war in ihren Augen ein Terrier. Sein Sexualverhalten mutete völlig archaisch an. Bislang war er ihr nur mit freundlicher Indifferenz begegnet, vielleicht lag darin der Reiz. Das unterschwellige Komplizentum, das die anderen Männer fortwährend ausstrahlten, von dessen Apriori-Berechtigung sie irgendwie auszugehen schienen, ohne dass die weibliche Einschätzung dabei weiter in Betracht kam, befremdete sie, auch wenn sie es sich gefallen ließ. Nichts davon besaß Hiero. Vor ein paar Monaten war er mehrere Tage lang von der Bildfläche verschwunden. Es hieß, dass er sich mit einer Frau in seiner winzigen Wohnung verschanzte, die er nur verließ, um für die notwendigen Lebensmittel zu sorgen. Keiner hat die Frau zu Gesicht bekommen, weder vorher noch nachher. Allein Anton war einem Einkaufstüten schleppenden Hiero auf der Straße begegnet und wusste von besorgniserregender Hohlwangigkeit zu berichten. Sie schien aber bereits deutlich abgeklungen, als Hiero, abgekämpft und dankbar, wieder am Gemeinschaftsleben teilnahm und wie zuvor in ihrem gewohnten Pulk der Mensa zustrebte. Übrigens blieb er verschwiegen. Kein Wort kam über seine Lippen, er entblößte nur das Gebiss, wenn einer der anderen die Rede auf seine Abwesenheit brachte.
War das schlimm? War das gut? Es war, wie es war. Andere mochten dem Phantom des neuen Mannes hinterherlaufen, der ihr, ehrlich gesagt, außer am Tresen noch nicht begegnet war. Gerade dort behagte er ihr am wenigsten. Was Hiero ausstrahlte, war Kraft, rohe vielleicht, jedenfalls ungezügelte, der man ebenso zutraute, dass sie sich augenblicklich entlud, wie dass sich in der Zukunft etwas aus ihr ergab, etwas Ungewöhnliches, das den Lebenshorizont der anderen ›Herren‹ deutlich überstieg.
Es war ein bisschen wie in der Dreigroschenoper, auch wenn man nicht damit rechnen durfte, dass Hiero die Karriere eines Zuhälters und Bandenchefs verfolgen würde. Und das war gut so. Der Lehrstuhl, auf dem er am Ende Platz nehmen würde, bot andere Möglichkeiten. Wenn Brecht sich in einem getäuscht hatte, dann darin, dass er die bürgerlichen Möglichkeiten so großzügig vom Tisch gewischt hatte, unter denen die Wissenschaft, wie nicht bloß die DDR bewies, Qualitäten besaß, die vor keiner Systemgrenze Halt machten. Kinder, lernt denken. Das kann euch keiner wegnehmen, egal, was kommt. Ein Spießerspruch, hinter dem sich Lebensabstürze verbargen, von denen sie gar nichts wissen wollte. Und: ein in wenigen Jahren, inzwischen bereits Jahrzehnten, aufgeschossenes gesellschaftliches Gehäuse, das sie und ihresgleichen, egal welchen Geschlechts und Charakters, mit Mauern aus Beton und Glas umschloss und gegen etwas abschottete, was aus der Ferne dem Schlamm und Elend ähnelte, durch das sich ein Heer vorgestrig gekleideter Flüchtlinge aus den ländlichen Gebieten des nunmehr inexistenten Ostens wälzte – dem Westen zu, der Stadt auf dem Berg, den holden Hainen von Ingolstadt und weiter nach Louisiana. Ohne Zweifel war ihnen dieser Zug eingeschrieben, den jungen Frauen mehr als den Männern, jedenfalls wenn man die abgeschnittenen Wege zurück betrachtete. ›Vorwärts immer, rückwärts nimmer.‹ So tönte der stalinistische Filzpantoffel, der es nicht in den Westen geschafft hatte, es klang dämlich, aber es war was dran.
Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Den Druck der Parole spürte auch Hiero. An diesem Abend sollte er die Selbstentblößung auf einen Punkt treiben, der ihn mir endgültig zur weiteren Beobachtung empfahl. Bis dahin hatte ich ihn gemocht, von nun an sah ich das Drama, nach dem sich dieses Leben unerbittlich ausrichtete, auch wenn man nicht sagen konnte, dass es von ihm gewollt war: dazu hätte es entschiedener Anstrengungen bedurft, es anzunehmen oder ihm zu entgehen. Die einzige Anstrengung, zu der Hiero sich aufraffen konnte, bestand darin, sich, komme, was da wolle, unter Spannung zu halten. Damit rückte er alles, was ihm geschah, in eine Lebensperspektive, die außer ihm keiner zu sehen vermochte. Das weitere verstand sich von selbst. Gerade das sollte sich, will man es kitschig ausdrücken, als verhängnisvoller Irrtum erweisen. Armer Hiero. Ein wenig hatte er sich sein Heldentum selbst zugute gehalten, seit er durch die weit geöffnete Tür des Leckebuschschen Hauses in eine kühl gesprenkelte Nachtluft hinausgerudert war, voll gemischter Empfindungen, gewärmt von tiefer Befriedigung, unter der die Unruhe keimte, ein vielleicht entscheidendes Argument übersehen und sich blamiert zu haben. Nein, er konnte keines entdecken. Bis heute nicht, bis vor wenigen Stunden nicht. Jetzt spielte dieser Fehler auf seiner Bettkante mit den eigenen Füßen eine Art Jo-jo-Spiel, zu dem die nachdenklichen Gesichtszüge nicht recht passen wollten, die er so gut kannte. Zu gut vielleicht, sie hätten seiner Schwester gehören können, so wenig aufregend kamen sie ihm vor. Vielleicht lag darin der Tabubruch, zu dem das Spiel der Füße ihn aufforderte, während er sich gern weiter unterhalten hätte. Im schwesterlichen Appell lag eine weitere Überschreitung, eine Übergriffigkeit ohnegleichen, die er sich nicht bieten lassen musste. Sie lag in seinem Bett. Dieser Irrtum musste korrigiert werden, auf der Stelle. Worin die Korrektur bestehen konnte, entzog sich vorderhand seiner Kenntnis. Eigentlich hatte er das Spiel schon versiebt, er hatte es versäumt, sich mit einem sprechenden Blick aus dem Augenwinkel oder einem großkotzigen Verpiss dich, Puppe oder Rausraus, jedenfalls mit einem entschiedenen Ruck, aus seiner Lage zu befreien. Jetzt, da sie sich auf andere Lösungen zu bewegte, fehlte das Drehbuch.
Woher nehmen, sprach der Rabe. Armer Hiero. Es wäre relativ einfach gewesen, jetzt, gerade jetzt, sich neben sie auf die Bettkante zu setzen und im Rahmen einer leichten Liebkosung mit einem ›Hör mal‹ einen jener Sätze zu beginnen, die unter vielfältig abwandelbarer Verwendung der Phrase ›Lass uns nochmal nachdenken‹ ihrem unverrückbaren Ziel entgegenziehen, mit denen die Stimme der Vernunft, neben einer leichten oder mittleren Verstimmung der anderen Seite, ihre Ziele erreicht. Aber das wäre zu einfach gewesen, es kam nicht in Betracht, ergab auch keinerlei Sinn, es kam ihm gar nicht in den Sinn. Denn so ambivalent seine Empfindungen Mechtel gegenüber auch waren, er hätte sie gern ›gehabt‹ und sei es nur, um damit vor sich selbst zu paradieren. Der fragmentarische, dabei beständige Widerstand, den sie seinen auf genauer Kenntnis der Texte fußenden Auffassungen allenthalben entgegensetzte, hatte einen Überzeugungsimpetus erzeugt, der seine Überschüsse loswerden wollte, gleich, ›auf welcher Ebene‹, um es in der Seminarsprache zu sagen, mittels derer sie sich verständigten. Außerdem... konnte er sie nicht gehen lassen, es ging nicht. Der Schritt, den sie getan hatte, war unkorrigierbar, er verlangte zwingend den nächsten. Und so bemühte sich Hiero, das abgerissene Gespräch wieder in Gang zu bekommen, was wider Erwarten einfach vonstatten ging, so dass sie binnen kurzem nebeneinander auf dem Bett saßen und er ihr relativ dünnes Haar zu seltsamen Knoten flocht, die sie anschließend mit leichter Hand wieder löste.

Klimmzüge
Diesmal kam der bremsende Impuls von ihr. Am Ende einer nicht rekonstruierbaren Gedankenkette hatte sie festgestellt: Nein, es ging nicht. Solange sie seinen Widerstand gespürt hatte, war sie sich ihrer Sache sicher gewesen. Jetzt, nachdem er ihn aufgegeben hatte, um die Dinge voranzutreiben, legte sich die Unentschlossenheit, die sie aus seinem Wollen herausspürte, um ihre Kehle: sie merkte, dass sich irgendwo in ihr ein Schluchzen formte und hasste ihren Körper, hasste ihren Entschluss herzukommen, hasste die entstandene Situation mit einer Inbrunst, die Hiero sich als besondere Form des Engagiertseins zurechtlegte, als einen neuen Widerstand, den es zu überwinden galt, als gebieterische Aufforderung, sich zu beweisen. Und er bestand darauf, diesem Ruf Folge zu leisten. (Er kannte die Stelle, die mich seinerzeit beschäftigt hatte und die ›das Weibliche‹ als Ruf interpretierte, ebenso gut wie ich, dachte aber nicht entfernt daran, ihre Komik zu würdigen.) ›Leg doch endlich ab‹ hätte er ihr gern ins Ohr geraunt, hätte er es nicht als albern empfunden. Er war sich sicher, dass sie Schwierigkeiten hatte, aus den Klamotten zu kommen. Die Deckung verlassen, sich präsentieren, das war nicht ihr Ding: keinesfalls wünschte sie sich als Gabe zu sehen, schon gar nicht in seinen Augen, schon gar nicht als Dreingabe. Zum Teufel mit den Frauen und ihren Widerständen. Ein schweres Stück Arbeit versprach das zu werden, das war kein rapider Sex, es war langweilig. Als Mann sah er sich doppelt gefordert: er musste diesen Widerstand überwinden und das Gefühl der Unlust in sich bekämpfen, das ihm klipp und klar kundtat, dass diese Form der Befriedigung, die mit der Versagung operierte und sie immer in der Hinterhand behielt, zutiefst reaktionär war und sich nicht mit seinen Überzeugungen in Übereinstimmung bringen ließ, die in der Sexualität das freie Spiel der Potenzen zu sehen wünschten und sonst gar nichts. Natürlich nicht – was sollte man von einer, die schon im Gespräch notorisch dagegen hielt, anderes erwarten, als dass sie auch an dieser Stelle Schwierigkeiten bekam. Der Logos spermatikos, verrücktes Weltzeichen einer abseitigen Philosophie, hatte es ihm stärker angetan, als er es jemals zugeben würde, warum sollte er es sich selbst gegenüber leugnen, warum sollte er es jetzt leugnen? Dazu bestand kein Grund, keinerlei Grund, es war eine Idee, so gut wie jede andere, sie konnte sich durchsetzen wie jede andere, sie hatte das Recht dazu, ohne Zweifel hatte sie ein Recht darauf, erprobt zu werden. Bisher war er gut damit gefahren, es gab keinen Grund, sie abrupt vom Programm abzusetzen und etwas anderes zu versuchen. Wenn Mechtel ihn nicht verstand, dann war das dumm, aber dumm für sie, nicht für ihn, es stand auch im Widerspruch zu ihrer sonstigen Intelligenz, eigentlich müsste sie sich das selbst sagen. Was sie sich aber sagte, war etwas völlig anderes. Sie hatte beschlossen, das Schluchzen in Schach zu halten, koste es, was es wolle. Kehrte er jetzt den Macho heraus, der nur noch vögeln wollte, ohne sich um ihre Befindlichkeit zu kümmern, dann war das sein Problem und nicht ihres. Vielleicht glaubte er ja, es seiner Männlichkeit schuldig zu sein, vielleicht glaubte er, es ihr schuldig zu sein, von diesem Wahn sollte sie ihn so rasch wie möglich heilen, sonst ging sie hier am Ende weg mit dem billigen Gefühl, abgefüllt worden zu sein, schon der Gedanke daran machte sie krank.
Krank, das war das Wort, das ihm durch den Kopf geisterte, während er sie mit nachlassend wachsendem Eifer weiter befingerte, das ist doch krank. Krank war es, dieser Verkrüppelung eines gesunden Vorgangs weiter beizuwohnen, sie aktiv mit zu betreiben, während man zur Passivität verdammt wurde. Vielleicht war die Verdammung auch nur ein Kind des Anstands, vielleicht wollte sie, dass er ihren Widerstand mit ein wenig Brutalität brach, vielleicht wartete sie darauf, dass er über die Grenze ging: zutiefst reaktionär wäre auch das, er verachtete die Perversen und konnte nur den Kopf schütteln, wenn er sah, wie sich gewisse Editionsphilosophen dieser Klientel andienten. Gewalt gegen Frauen, ein kurioses Thema unter Leuten, die sich, in der Phantasie oder sonstwie, von schwarzen Dominas mit der Peitsche traktieren ließen und in den Auslagen das Lederzeug anstarrten, mit feucht werdenden Händen und einem Blick, in dem die Besorgnis, beobachtet zu werden, langsam zerschmolz. Ohne ihn. Wenn sie das wollte, dann konnte er jetzt gleich ihre Jacke vom Haken holen und sie mit einem ›Tschüss‹ zur Tür hinausbugsieren, auch das vermutlich ein gewaltsamer Akt, aber ein befreiender. Dass sie so etwas wollte, konnte er sich eigentlich nicht vorstellen, er traute es ihr nicht zu, und wenn doch, dann sollte sie hinreichend intelligent sein, um zu begreifen, dass das nicht lief, nicht mit ihm, schon gar nicht hier, auf seinem Bett, in seiner Wohnung, mit dem aufgeschlagenen Husserl auf dem Schreibtisch und dem Blatt Papier daneben, auf dem er vorsorglich schon einmal seine Gedanken sortierte, für den Fall, dass ihn der Richtige endlich fragte, ob er ihm nicht folgen wolle, nach Passau oder Hamburg, gleichviel. Dieses Blatt... gleich beim Eintreten hatte sie einen Blick darauf geworfen, aber keine Fragen gestellt, es hatte einen sonderbar hilflosen Eindruck auf sie gemacht, wie eine Art praeparatio ad nihilum. Die simple Frage ›Und wenn er dich nun nicht nimmt?‹ lag ihr die ganze Zeit auf den Lippen, sie mochte sie aber nicht aussprechen. Warum auch? Nur wenige Zentimeter entfernt stand, grün ummantelt, Maimonides’ Führer der Verwirrten, in der neueren Ausgabe hieß er ›Führer der Unschlüssigen‹, was theologisch vermutlich Sinn machte, im Alltag allerdings Bedenken provozierte. Provoziert fühlen konnte sich auch Hiero, den jene Frage seit Wochen verfolgte. Er fing sie aus der Luft ein, vielleicht, weil sie immer in ihm gelegen hatte, aber mit der Bitte, keinerlei Gewese um ihre Anwesenheit zu machen, sie einfach zu ignorieren, die Zeit zu überbrücken versuchte, in der die Entscheidung nicht anlag, obwohl sie, wie zu vermuten stand, auf der anderen Seite, in Tronkas Vorstellungswelt, bereits gefallen war. In gewisser Weise hatte er, Hiero, sich sogar am heutigen Abend, seit ihm Mechtels weitergehende Absichten aufgegangen waren, Aufschluss in dieser Kernfrage erwartet, ein mitlaufendes Ego starrte voll Begierde auf den Punkt, an dem inmitten einer grasgrünen Leere das Schilfbündel aufragte, das sie barg, er hätte sich gut vorstellen können, wie Mechtels frauliche Hände es geschickt auseinander bogen, wie sie beide das zarte, kaum sinnesfähige Wesen ausgiebig und von allen Seiten betrachteten und liebkosten, um es nach einer Weile vorsichtig wieder zurück an seinen Platz zu legen –.
Was war das für ein Platz? Gab es ihn überhaupt noch, nachdem die Frage einmal aufgenommen und antwortfähig gemacht worden war? Nie und nimmer war sie dieselbe, sobald sie einmal zwischen ihnen hin und her gedreht und gewendet worden war. Das stand auch für Mechtel fest. Sie sah eine Aufgabe darin, von der sie jedoch nicht wusste, ob sie sie angehen sollte. Jedenfalls schien sie ihr keine erste Dringlichkeit zu besitzen, sondern irgendwie später zu kommen, wenn die Dinge begonnen hatten, ihren natürlichen Gang zu gehen. Wie dieser natürliche Gang beschaffen sein würde, entzog sich allerdings nicht nur der Vorstellung, sondern auch dem begrifflichen Zugang, der irgendwo zwischen den rhetorischen Barbarismen der Elterngeneration und der betont flachen Beziehungssprache, die sie mit Hans-Hajo pflegte, zu finden sein musste. Handelte es sich um einen Stollen, der sie mit schlafwandlerischer Sicherheit aus dem aufgenötigten Schattendasein hinausführte, wie es Platons etwas abgestandenes Höhlengleichnis nahelegte, oder um den famosen ›aufrechten Gang‹, von dem alle sprachen, ohne dass sie jemals gesehen hätte, wie ihn jemand realisierte? Die Überlegung beschäftigte auch Hiero, für den ›natürlich‹ nur die zweite Variante in Betracht kam, wobei er im Falle Platons ein gewisses Vorverständnis gelten ließ, das erst in der kantischen Theorie zu sich selbst fand, die wiederum erst im Neukantianismus, ein bisschen vielleicht in Husserls Ideen, obwohl, so wie ›wir‹ erst langsam begriffen, worin deren grundlegende Gedanken... Das war es natürlich. Eher fand eine Theorie zu sich selbst als die Sache, die darin verhandelt wurde. Diese Sache, die Sache der Theorie, verlangte gebieterisch, zu einem Abschluss zu kommen, Handeln hieß förmlich nichts anderes als: Abschlüsse tätigen, ein Ausdruck, der zwar der Vertretersprache entstammte, jedoch einen weithin ungeborgenen menschlichen Sinn enthielt. Wie ein Abschluss aussehen konnte, trat zurück gegen die menschliche Notwendigkeit, ihn zu erreichen – seltsames, seltsam unbefriedigendes Exempel eines Persönlichkeitstransfers, den Mechtel, wie man so sagt, aus dem Zugfenster beobachtete, äußerlich unbeteiligt, doch mit brennender Anteilnahme, als werde da draußen eine Angelegenheit verhandelt, die weit in ihre Kindheit zurückreichte und Schatten voraus in die Zukunft warf – ach was verhandelt, bestritten, in beiderlei Bedeutung des Wortes, was denn sonst.
Unendlich
ist das Getöse,
Unendlich
die Nacht auch.
Nein, so taff war sie nicht, unsere Mechtel, so taff nicht, dass sie jetzt nicht langsam geschmolzen wäre, sie hatte ja nichts anderes vorgehabt, wie sollte es da auf etwas anderes hinauslaufen? Sie hatte nicht vorgehabt, sich absurd zu gebärden, wie sollte sie sich da plötzlich verweigern, es sei denn...
Nein Mechtel, so läuft die Sache nicht. Warum? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, Ehrenwort, großes Ehrenwort, das endet zwar in der Wanne, aber – seis drum. Ein Würfelwurf und Hiero geht in die Sklaverei, aufrecht, gelassen, vor allem gelassen, andere hat es vor ihm getroffen, er ist nicht der letzte in dieser Kette, ein Arbeiter in den Steinbrüchen, namenlos, aber: nicht ohne Stolz.
Nicht ohne Stolz.
Diese plötzliche Erschlaffung, von keiner Seite vorausgesehen, ist keine Erfindung von mir, keine Zugabe. Sie stand zwischen den akribisch gewählten Worten, in denen mir Hiero, von einem seltsamen Bedürfnis getrieben, den Abend beschrieb, sie stand zwischen den Zeilen seines Berichts, der darauf hinauslief, dass, zu seinem noch immer unruhig nachzitternden Erstaunen, das Unfassbare eingetreten und es zu nichts gekommen war. Er war ein Kämpfer, der gute Hiero, es schmerzte ihn, seinem Auftrag untreu geworden zu sein, er hätte, fürchtete ich, die Scharte lieber heute als morgen ausgewetzt. Er ging nicht so weit, sich dafür die Kugel zu geben oder sich in Selbstvorwürfen zu ergehen. Aber etwas würde geschehen, etwas Monströses, wenn es sein musste, dessen war ich mir sicher. Ich, der ein paar Jahre Ältere, hätte ihm erklären können, was ihm widerfahren war. Ich hätte detailliert die Zirkelschlüsse beschreiben können, auf Grund derer sie beide vor- oder rechtzeitig in ihre Haut zurückgekehrt waren, die sie in Wahrheit an keiner Stelle verlassen hatten, getrieben von einem Wunsch, der vielleicht mehr war als ein Wunsch, wie das Modewort ›Begehren‹ zaghaft andeutete, ein über-die-Ränder-Drängen, das schreckhaft zusammenzuckte, sobald ein finsterer Kobold das Wort ›Hingabe‹ in den Raum warf, nur so, zum Vergnügen, aber tödlich genau ins Herz der Veranstaltung treffend. Aber es hätte keinen Zweck gehabt, er wäre nur ein weiteres Mal zusammengezuckt und hätte das Gespräch abrupt beendet, als hätte ich etwas Geschmackloses gesagt oder soeben eine zutiefst reaktionäre Seele entblößt. Natürlich hätte ich ihm so klar, wie es mir selbst vor der Seele stand, erläutern können, dass dem Verrat an Hans-Hajo, der ihn angeblich so verunsichert hatte, ein anderer Verrat vorausgegangen war, den jeder der beiden an sich wie am anderen begangen hatte, dass seine eigene Verunsicherung, weit davon entfernt, aus Loyalitätsgründen gespeist zu werden, denselben Verrat bereits im voraus entwarf und zwischen Mechtel und ihm deponierte, dass schließlich ihr Auftauchen an jenem Abend, wer weiß, den einzigen Versuch in ihrem Leben bedeuten mochte, dem Zirkel dieses wechselseitigen Verrats zu entrinnen und den ›festen Grund‹, um die kantische Phrase zu gebrauchen, einer Loyalität jenseits der Zuverlässigkeit von Partnern zu erreichen, zwischen denen allerlei Alltagsprojekte abgesprochen waren, darunter auch der wechselseitige Gebrauch der Geschlechtsorgane: dazu war sie ins Wasser gesprungen und hatte sich, nachdem sie keinen Grund unter die Füße bekommen hatte, rasch wieder ans Ufer gerettet – rechtzeitig, wie ihr schien, so rechtzeitig, dass sie ihm gar nicht kenntlich hatte werden können. Denn auch sie hatte alles gestellt, sie war unterwegs gewesen, ohne unterwegs zu sein, was sicher klug von ihr war, wie der Ausgang des Experiments ihr zeigen musste, doch gerade nicht klug genug, um diesen Ausgang zu verhindern, falls er zu verhindern gewesen wäre, was vermutlich nicht der Fall war, denn Hiero wäre an dieser Stelle sehr heftig zusammengezuckt und hätte sich nachträglich beglückwünscht, nicht in die Falle einer bestellten Hörigkeit gegangen zu sein.
Und doch war es gerade der Ausdruck ›Hörigkeit‹, der ihn umflog und umwisperte, wo immer er in diesen Wochen ging und stand. Allerdings nicht bezogen auf irgendwelche erotischen Kapricen, sondern auf jenes andere Stockwerk, in dem Tronka bei ihm ein und aus ging, derselbe Tronka, der mit hochfahrender Geste alle Nachfragen vom Tisch wischte, ein Tronka, der aus seinem Herzen nicht eine, sondern, jedenfalls was sein akademisches Fortkommen anging, das in ein kritisches Stadium eingetreten war, wenigstens drei Mördergruben gemacht hatte. Es ist schon ein seltsames Los, in einem Alter, in dem der eine oder andere in gelegentlichen Gesprächen bereits deutliche Vertrautheit mit Pensionstabellen oder erworbenen Rentenansprüchen aufblitzen lässt, der bangen Frage ausgeliefert zu sein, ob der vor langen Jahren gewählte Beruf einen annehmen oder definitiv zurückweisen werde. Vor allem, wenn dieser Beruf zweimal vorhanden ist – im Stellenapparat einer Universität und oben in den Wolken, wo die Geisterheere aufeinander prallen wie in der Rabenschlacht über dem Odfeld, das kaum einer kennt und auf dem vielleicht, wie dem Erzähler schwant, das Schicksal dieser Welt verhandelt wird. Die Frage dürfte sich, da persönlich längst beantwortet, eigentlich gar nicht stellen. Allein dass sie aus einem lange erwarteten Nichts auftaucht, enthält neben der Bedrohung eine vernichtende Kritik an der seinerzeit getroffenen Wahl, die einen doch ereilt hatte, ›wie ein Blitz‹ den einen, langsam und beinahe unmerklich den anderen, in jedem Fall durch frühe Erwählung seitens des Professors besiegelt, der eine Mitarbeiterstelle besetzt. Nicht jedem ist es gegeben, in dieser rituell und unvermutet anfallenden Rolle zu glänzen, obwohl gerade hier die Blender die Nase vorn haben – scheinbar vorn haben, da auch in diesem Fall Loyalität vor Schönheit geht und sie am Ende ungefähr genauso viel oder wenig Nutzen abwirft wie wirkliche Brillanz.
Hiero, den bis dato niemand gefragt hatte, ob er sich vorstellen könne, während der kommenden Jahre die an einem Lehrstuhl anfallenden Seminararbeiten zu korrigieren und Einführungsseminare zu Leibniz’ Monadenlehre und Wittgensteins Theorie des Sprachspiels abzuhalten, wäre dankbar gewesen, hätte ihn Tronka in den Stand der Habilitationsverhandlungen eingeweiht und ihm einen Wink gegeben, wie es danach weitergehen könnte. Wirklich trafen die beiden sich in dieser Zeit abseits der Seminarrunden zu einem gelegentlichen Bier in einer Bar nahe dem Hauptbahnhof und tauschten unter den wachsam-abschätzigen Blicken der studentischen Animierdame die bereits eingeübten Floskeln über den ›verheerenden‹ Stand des zeitgenössischen Philosophierens aus. Was daran stimmte, was bloße Schelte einer gleichgültig in sich selbst verharrenden Welt war, die beide aus der Angel zu heben gedachten, weil der Ehrgeiz es ihnen eingab, kann ich bis heute nicht richtig beurteilen. Einmal erscheint mir ihr Blickwinkel völlig einleuchtend, dann wieder presst er mir nichts weiter ab als ein verlorenes Lächeln.
Damals
neigte ich dazu, ihnen recht zu geben – zum einen, weil ich sie
mochte, zum anderen, weil auch ich nach Integrität strebte und sie
bei ihnen gefunden zu haben glaubte. Die Motive, die einen Leckebusch
oder Einhart bewegten, erschienen mir dagegen allzu durchsichtig.
Doch fehlte meiner Beschreibung etwas, wenn ich nicht zugäbe, dass
ihre Argumente mir einfach richtig vorkamen und mir nicht ganz in den
Kopf wollte, dass es möglich sein konnte, eine philosophische
Richtung, die auf eine breite Tradition zurückblickte, vor annähernd
hundert Jahren mit geradezu herrscherlichen Attributen ausgestattet
und seither, wie man hier und da las, von einigen Nachzüglern zu
einem schwierigen Zweig des zeitgenössischen Philosophierens
fortentwickelt worden war, mit einem einfachen Schieflegen des Kopfes
oder einer ungeduldigen Schulterbewegung aus dem eigenen Gesichtsfeld
fernzuhalten. Genau das hatte ich gesehen und ich fand es
einleuchtend, wenn der Kreis mutmaßte, dass hier der Grund für die
langsam unziemlich gewordene Verzögerung von Tronkas Habilitation
lag, die nun aber offenbar doch bevorstand. In diesen Verwicklungen
wiederum konnte, wer sich eingeweiht vorkam, eines der treibenden
Motive hinter Hieros heldenhaftem Auftritt bei Leckebusch erkennen.
Er war weder so selbstlos noch so irrläuferhaft gewesen, wie es für
die meisten Anwesenden den Anschein gehabt haben musste.
Darin
konnte ich mich täuschen. Die akademischen Buschtrommeln arbeiten
außerordentlich wirkungsvoll, wenn auch nicht immer präzise. Selbst
Tronka wusste inzwischen Bescheid. Insgeheim schätzte er sich
glücklich, den Galan gegeben zu haben, während sich sein einziger
wirklicher Schüler und möglicher künftiger Assistent auf seine
eigene unnachahmliche Weise für ihn geschlagen hatte, ohne dass der
Name Tronka dabei gefallen war. An diesem Umstand war ihm sehr
gelegen, er hätte sich keineswegs den Schuh anziehen mögen, den der
gestresste Königssohn dort herumgereicht hatte. Ruckedieguh, Blut
ist im Schuh. Einen schönen
Ärger hätte er sich da eingefangen, wäre er mit in der Runde
gestanden. Unausdenkbar, Hiero hätte ihn angesprochen, etwa mit
einem ›So sagen Sie doch etwas!‹ oder ›Sie verstehen ganz gut,
was ich meine, geben Sie es zu!‹, vielleicht sogar mit der
Bemerkung, in seinen, Tronkas, Seminaren höre man es schließlich
anders. Ihm juckte die Kopfhaut, während er Hieros vor gedämpfter
Erregung und unter dem Einfluss der bereits genossenen Biere
schwerfällig gewordene Bewegungen musterte: die staksige Art, wie er
die Zigarette ausdrückte und die Jacke zurechtrüttelte, so dass
sich eine leichte Wolke aus Staub und Asche daraus erhob, die leichte
Hebung des Kinns, mit der er ihm sein Gesicht wieder zuwandte, in dem
ein unangenehmer Ausdruck von Wichtigkeit stand, aber auch von
törichtem Vertrauen, mit dem er nichts anzufangen wusste, das
plötzliche Strecken des Oberkörpers, das den Barhocker ins
Schwanken brachte, den Krampf der Finger, der die leere
Zigarettenschachtel zerknüllte und auf den Aschenbecher fallen ließ.
Das alles war ihm nicht unsympathisch, so wie der junge Mann
insgesamt ihm nicht unsympathisch war. Im Gegenteil, das Wohlwollen,
das er ihm gegenüber an den Tag legte, pflanzte sich tief in sein
Inneres fort, es hatte sich zu einer festen Größe entwickelt und
wollte ebenso gepflegt und bedacht sein wie der Umstand, dass er in
ihm einen Schüler gefunden hatte – einen wirklichen Schüler, der
seine Gedanken aufnahm und offenbar fest entschlossen war, sie weiter
zu verbreiten... vorausgesetzt, er hielt ihm die ersten Sprossen
einer noch gänzlich im Imaginären verschwebenden Leiter hin, die
ihn einmal nach oben tragen würde.
Dieses Oben, was war das? Tronka, dem das Bier stärker zusetzte, als er vor sich selber zugab, hatte die Empfindung, sie drückten sich an einer Wand herum und der andere verlangte, dass er ihm mit Hilfe einer Räuberleiter hinüberhalf, so als stünde von vornherein fest, dass er selbst keine Chance hatte, auf die andere Seite zu gelangen. Wer oben ankam, der war drüben, so lief das Spiel, ein Scheißspiel, wie es Einhart in einem seiner nicht so seltenen Anfälle von sozialer Einsicht genannt hatte. Andererseits ist so eine Mauer auch eine mentale Realität: wer noch diesseits weilt, also nicht zu den Zeitgenossen gehört, die rituell in jeder Literaturliste auftauchen und deren Theorien genannt werden, damit man sich von ihnen absetzen kann, kann sich schwer vorstellen, wie es drüben ist und welche Verkehrsregeln dort gelten. Wirklich fühlte sich Tronka diesseits der Mauer sicherer. Gewiss würde es gut tun, den anderen irgendwann auf der anderen Seite zu wissen und darauf vertrauen zu können, dass er angesichts einer aufnahmebereiten Mitwelt die richtigen Sätze gebrauchte. Auf diese Situation bereiteten sich beide vor, Hiero ohnehin, daran konnte kein Zweifel bestehen, er, Tronka, indem er seine knapp bemessene Zeit für Gespräche wie dieses opferte und jede Gelegenheit zur Instruktion wahrnahm. Aber war das hier der richtige biologische Träger? Kein Kommentar. Nein, kein Sieger kam da auf ihn zu, kein Siegertyp jedenfalls, keiner, vor dem er selbst die Waffen gestreckt hätte. Ihm imponierte der Ernst, mit dem der junge Mann dem Ruf ›zu den Sachen‹ folgte, die unerschütterliche Loyalität, die er einem System von Sätzen gegenüber aufbringen konnte, das zufällig das seine war. Die geschmeidigen jugendlichen, obzwar nicht mehr jungen Hoffnungsgesichter, in denen der akademische Aufstieg seine Bühne aufgeschlagen hatte und gleichsam nackt paradierte, besaßen einen gravierenden Nachteil. Niemals würde er in ihnen auch nur einen entfernten Widerschein seiner Überzeugungen aufschimmern sehen, ganz zu schweigen von der Bedeutung seiner logischen Entdeckungen, die zwar das Wissen des Wissens revolutionierten, aber vor der Hand keinen Hund hinter dem Ofen hervorlockten. Lange Zeit hatte er darauf gewartet, diesen Widerschein in den Augen der Gutachter wahrzunehmen, doch das Blitzen, dem er dort begegnete, redete von anderen Dingen.
Nun, da die Gutachten auf dem Tisch lagen, war die Zeit der Illusionen vorbei. Der Gedanke an einen glatten, leichten Gang durch die Institutionen, die Diskussion seiner Überlegungen durch eine differenziert denkende, vermutlich im Urteil gespaltene Kollegenschaft, die schöpferische Fortentwicklung des einmal konzipierten Modells, seine zügige Anwendung auf die verschiedensten Wissensgebiete durch kluge und ehrgeizige Wissenschaftler, die begriffen, welches Potential in ihm lag – an alles, was selbstverständlich sein sollte in diesem Beruf, der keinen Beruf darstellte, auch keine Berufung, sondern den Gang des Denkens selbst, war an diesem Institut nicht zu denken und er war gut beraten, wenn er sich gegen weitere Unbill wappnete, sobald das Buch erst erschien. Der vollständige Mangel an philosophischer Gegenwartskultur bei gleichzeitiger exzellenter Kennerschaft machte vor den traditionellen Stätten nicht halt. In gewisser Weise kam er dort, wo jede naturwüchsige, zwangsläufig dumpfe Achtung vor der zur Leistung geronnenen Anstrengung des Anderen abgeschliffen wurde und nur die Brillanz zählte, erst richtig zum Vorschein.
Die Philosophie war eine sehr alte Disziplin, selbst wenn man davon absah, dass sich einmal in ihr die Disziplinierung des Wissens ›überhaupt‹ vollzogen hatte. Da brachen die neuen Gedanken nicht an jeder Straßenecke hervor. Zumindest sahen sie sich ernsten Zweifeln gegenüber, ob ihre entsicherten Waffen auch geladen waren und ob sich hinter den wilden Maskeraden nicht einfach die altvertrauten, von Generation zu Generation hervorgekramten und wieder in die Rumpelkammer des Denkens zurückverwiesenen Einfälle verbargen. ›Schoten‹ nannten die alten Seminarhasen das, sie amüsierten sich herzhaft, wenn dergleichen ihnen aus einem im Dekor des neuesten Welt-Denkens daherkommenden Werklein entgegenquoll. Diese technische Elite, die alle Argumente ›am Schnürchen hat‹, fürchtete Tronka nicht, lange genug hatte er in ihr verkehrt und sich ihren Habitus bis zu einem gewissen Grad auch angeeignet. Eher gierte er nach ihrem Urteil, schließlich musste sie am besten beurteilen können, wie seriös die Vorschläge waren, die er auf den Tisch legte.
Da lag bereits der Fehler. Der äußerst verträgliche Assistent Einhart zum Beispiel hätte ein vorzüglicher Gesprächspartner sein können, wäre er imstande gewesen, sich Tronkas Gedankengängen auch nur einen Spaltbreit zu öffnen. Aber daran war nicht zu denken. Die Übersicht über die verwickelte und in Wahrheit unauflösliche Problemlage der prima philosophia hatte ihn, da er irgendetwas lehren musste, an einer Biegung des Wegs zum Parteigänger gemacht, der sich für seine Schule nach sorgfältiger Abwägung der sozialen Gründe entschieden hatte. So trug gerade er in ihren ansonsten fruchtbaren Gesprächen ein überlegenes Lächeln zur Schau, das Tronka nervös machte und ihm die je nach Tageslaune heftige oder leise Empfindung eingab, seine Zeit zu verschwenden. Niemals hätte Einhart auf einen seiner Aufsätze verwiesen. Wenn er einen Aufhänger benötigte, um irgendeine falsche Tendenz zu geißeln, der er die kämpferischen Wahrheiten des eigenen Lagers entgegenstellen konnte, dann gab es dafür eingeführtere Autoren. Schließlich stand auch Tronka für eine Schule, aber eine untergegangene: seine Rettungsversuche am erkalteten Leichnam waren brillant, doch sie beeindruckten niemanden, die Leiche eingeschlossen.
Hier also: der Schüler. Er hatte Grips, das stand außer Zweifel, er hatte ihn in hundert Seminarveranstaltungen unter Beweis gestellt, das musste man ihm lassen. Er besaß Elan, auch das musste man ihm lassen, vielleicht sogar ein bisschen viel. Manchmal fürchtete sich Tronka vor den stürmischen Vereinfachungen, mit denen er ihm zur Seite trat, als gelte es, Seit’ an Seit’ mit dem Kapitän eines gekaperten Schiffs, die blanke Waffe in der Hand, zu siegen oder unterzugehen. Die Planken des Seglers dröhnten von seinem Schritt, er hätte auf seinen, Tronkas, Befehl hin den Großmast gekappt, um den Feind zu verwirren und die eigenen Linien zu ordnen, gleichgültig gegen die Überlegung, wie sie anschließend der sie umgebenden Salzwüste entkommen sollten. Da lächelten die Auguren, sie hatten dergleichen öfter gesehen, sie winkten mit leichtem Fingerspiel ein paar Hilfskräfte herbei, die so etwas unauffällig erledigten. Zitterten ihm nicht bereits die Hände? Trug er nicht bereits die Zeichen des künftigen Außenseiters im Gesicht? Eine hintergründige Instanz sorgte dafür, dass er unter Druck stand. Über kurz oder lang würde sie ihn erledigen, das sah man, ohne lange darüber zu grübeln.
War er der Richtige? Es wäre pervers, ihm einfach so das Vertrauen zu entziehen, fast wie eine Polizeibehörde, die dem angehenden Berufsfahrer die Erlaubnis entzieht, einen Kraftwagen zu bewegen. Dass es außerhalb der Universität für Hiero keine Zukunft gab, daran ließ sich kaum vernünftig zweifeln. Selbst die Barmieze konnte das sehen, es ließ sich an der Art ablesen, wie sie ihre Finger bewegte, sobald sie zu ihm hinsah – sie äugte nicht, sie sah ihn klar an, wie man einen Menschen ansieht, der einem jetzt auffällt und den man vielleicht nie wieder sehen wird. Er hingegen bemerkte sie nicht, sein Blick ging über sie hinweg und durch sie hindurch. Gerade dort, wo sie sich ihm so unverfänglich darbot, fuchtelte dieser Mensch herum, als sei das Getümmel besonders heftig und die Gefahr eines feindlichen Durchbruchs am größten. Tronka registrierte es kalt. Einen solchen Mitarbeiter – falls er je einen benötigte – konnte er sich eigentlich nicht leisten.
Hiero spürte, dass etwas nicht stimmte. Er wusste es schon seit längerem oder seit einiger Zeit oder seit ein paar Tagen – er hätte nicht angeben können, seit wann er es wusste, die Empfindung, einmal freigesetzt, entrollte sich in die Vergangenheit wie ein Wollknäuel, das je nach Fadenlage die Richtung änderte und, fast schon zur Ruhe gekommen, sich nochmals und nochmals überwälzte, solange irgendein Restimpuls in ihm wirksam blieb. Eine Empfindung, mit der man nichts anfangen kann, ist wie eine Person, deren eigenständiges Wirken zur Kenntnis zu nehmen man sich weigert, weil es das eigene Handeln ins Unbeherrschbare komplizieren würde. Die Leute sagen dann, die Sache sei ihnen nicht bewusst gewesen. Aber wer sich ein wenig mit dem Bewusstsein auskennt, weiß, dass diese Verschiebung in die Tiefen eines angeblich mechanisch wirkenden Unterbewusstseins eine bildungstechnische Heuchelei ist, die selbst dem Arsenal der zudeckenden Griffe zugeschlagen werden muss. Das zweifellos immer vorhandene Bewusstsein überall dort, wo es uns passt, in seinen muffigen, unaufgeräumten und verschwiegenen Ecken als unbewusst zu bezeichnen, das ist genauso, wie wenn einer sich beharrlich weigert, außer Wohnzimmer und Küche auch Bad, Toilette und Bügelkammer zur Wohnung zu rechnen, vom Schlafzimmer ganz zu schweigen. Bewusstsein ist alles, nur die Weisen des Gebrauchs differieren. Wenn Hiero, darin seinem Lehrer folgend, allein dem wissenschaftlich tätigen Bewusstsein zubilligte, als ›voll entfaltetes‹ Bewusstsein zu agieren, dann war das einfach bequem, weil es dem Einzelnen erlaubte, sich nach getaner Arbeit in eine mindere und gleichsam archaische Ich-Umgebung zurückzuziehen. Dieses geminderte Ich, das zwischen sich und dem wissenschaftlichen Gedanken einen Strich zog, der natürlich imaginär blieb, aber den Stress abbauen half, hatte das Zögern in den Reden und Gesten des Meisters wohl bemerkt. Da es nur begrenzte Kompetenz beanspruchte und sich zu einer Art bescheidener Vorhof-Existenz verurteilt hatte, durfte es sich erlauben, lautlos unentwegt ›Mach dir nichts draus‹ zu murmeln, obwohl es sich sehr wohl etwas aus alledem machte.
Wer hinsah, wusste Bescheid. Hiero wirkte deprimiert. Während des augenblicklichen Gesprächs zum Beispiel hätte er die ganze Zeit über fragen mögen, ob er nun eigentlich mit einer Anstellung rechnen konnte, sobald, was nur eine Frage der Zeit war, Tronka dem Ruf einer anderen Fakultät Folge leistete. Mit der Aussicht auf eine schwierige Übergangszeit hatte er sich seit längerem abgefunden, sie schien ihm nur gerecht, wenn sie der Preis war, den er dafür zahlte, dass er einem seltenen Menschen folgte, dessen Arbeiten unsichtbar, wie es sich gehörte, das platonische Epitheton ›umstürzend‹ auf der Front trugen. Einem Tronka zu folgen war eine andere Sache, als sich von Kärich anstellen zu lassen, um in seinen Seminaren Referate zu betreuen und ihm die Korrekturen abzunehmen. Einem Tronka folgen, das war der Aufbruch in eine neue Welt der Gedanken. Er war bereit zu warten.
Gerade für diese Frage ließ das Gespräch keine Lücke. So locker und pausenreich es von beiden Seiten geführt wurde, so glatt gefugt und gänzlich ohne ›Einstiegsmöglichkeit‹ blieb es gegenüber der doch berechtigten Frage, wie es zwischen ihnen jetzt weiter ging. Weitgehend außer Frage schien zu sein, dass Hiero sich, sobald die Statusfragen geklärt waren, als Doktorand angenommen betrachten konnte. Auch das schien so, es konnte sich jederzeit in Luft auflösen, da offenkundig Tronka den Bund verweigerte, den sie förmlich hätten eingehen müssen, wenn beide Seiten allen Widrigkeiten des akademischen Fortkommens trotzen wollten. Tronka benahm sich wie ein Geliebter, der erst abwarten muss, bis er die Anstellung bei der städtischen Finanzverwaltung in der Tasche hat, um sich zu erklären. Insofern war die kühle Bemerkung Machen Sie sich keine Arbeit. Wir sind schwul, mit der er bei ihrem ersten Treffen hier die Annäherung des Mädchens unterbunden hatte, nicht ohne Witz gewesen, nicht ohne Witz... So ein Schutz- und Trutzbündnis hätte zwischen ihnen beiden einen Innenraum geschaffen, dem Raum einer auf die wenigen großen Grundlinien eines wahrhaft menschlichen Miteinanders zurückgeführten Sozialität, nach der es Hiero dürstete. Allein in einem solchen Raum, soviel verstand er von der Sache, war die gesetzgebende Instanz zum Sprechen zu bringen, die zwar in aller Wissenschaft anwesend ist, aber der philosophischen Rede bedarf, um auseinandergelegt zu werden. Andere mochten diese Instanz ›Gott‹ nennen, das blieb ihnen unbenommen. Aber es war nicht dasselbe, ob man sich bloß im Denken verband oder im Namen eines Dritten, der unablässig störte, weil er neue, nicht lösbare Probleme aufwarf, die keiner brauchen konnte.
Auch das hätte Hiero nicht gesagt. Er hätte es schamhaft verschwiegen und vehement protestiert, wäre jemand auf den Einfall gekommen, ihm gegenüber diese Worte zu gebrauchen. So zu reden, war durch die Autoritäten nicht gedeckt. Es war eine Weise, sich über die Grundlinien des Denkens zu verständigen, die man am besten durchstrich, die bereits durchgestrichen war, sobald Seminarluft die Lungen durchströmte und die akademische Rede anhob. Andere Zeiten hatten das anders gehalten. Sie hatten ihre Rede gepflegt, doch Hiero war sich nicht sicher, dass hier der Vergleichspunkt lag. Wer immer diese und andere Reden durchgestrichen haben mochte – erlaubt war allenfalls, wie Kärich zu sagen pflegte, sich ihnen mit der Lampe der Rekonstruktion zu nähern. Es gab da eine feine Trennlinie, die man nicht übertreten durfte. Ging man weiter, dann ging man Vorstellungen auf den Leim, die durch den Gang des Denkens selbst außer Kraft gesetzt worden waren. Nicht immer ließ sich das auf den ersten Blick erkennen. Gelegentlich bedurfte es schon gewisser technischer Vorkehrungen, um nicht den Gimpel zu geben. Aus einem lieben und gelegentlich schlichten Einhart, das wusste er von Leuten, die seine Seminare besuchten, konnte, wenn es mit der Terminologie einmal haperte, schnell ein Terminator werden. Im Grunde redete Kärich um den gleichen Punkt herum, wenn er sein gefürchtetes ›Alles Doxa!‹ in den Raum setzte. Aber es ging nicht um Terminologie, es ging darum, an jeder Stelle zu wissen, ›was nicht mehr ging‹, obgleich gerade darin ein Typus von Wissen gefordert wurde, der verzweifelt dem durchgestrichenen glich, so als hätten sich alle eigensinnig in den Kopf gesetzt, die spöttische Alltagsweisheit, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, in reine Lehre umzusetzen.
Diese asymptotische Verweigerungshaltung war der Kern von Hieros philosophischer Sozialisation. Sie zeichnete verantwortlich für das Ungenügen, das er am Seminarbetrieb empfand, seit er ihn kannte. Oft schien ihm die dort betriebene Rekonstruktion nicht weit genug getrieben zu sein, dann wieder saß ihr die zweite und dritte Rekonstruktionswelle bereits sichtbar im Nacken und ließ die glänzendsten Effekte im Aussprechen dahinwelken. Am meisten machte ihm zu schaffen, dass im Gedanken der asymptotischen Annäherung selbst die Differenz fest verankert war. Der Anspruch, ›anders‹ zu denken, zog zwangläufig immer wieder den autoritativen Gestus der Texte fest, die nachzusprechen verboten war. Das degradierte das eigene Sprechen zu einer Art von nachtragendem Vollzug der Differenz, jedenfalls zu einem Anhängsel.
Auch Tronka bediente sich der Sprache der Rekonstruktion. Von den Konkurrenten setzte er sich dadurch ab, dass er, wann immer es ging, die Namen wegließ und gleich zu den Argumenten kam. Damit brachte er eine andere Art Gliederung in Problemlagen hinein, an denen sich alle abmühten. Tronka ›führte‹ nicht ›ein‹, wie dies die anderen mit Vorliebe taten. Er war immer bereits mittendrin und blickte allenfalls gelegentlich sichernd auf wie der Hase im Klee, dem ein fernes Grollen den näherkommenden Pflug ankündigt. Es war dieser sich an ältere Formen des Philosophierens anschließende Habitus, der Hiero die Zuversicht einflößte, im Kielwasser des Philosophen, der seinen Aufstieg noch vor sich hatte, den ruinösen Wirkungen des asymptotischen Spiels zu entkommen. Geflissentlich übersah er dabei, dass sein Held zwar extravagant, aber nicht ohne Blick auf die Möglichkeiten agierte.
Man musste schon einen Blick für die Feinheiten des Betriebs erworben haben, um zu erkennen, wie sehr das Spiel auch Tronka bereits gezeichnet hatte. Mag sein, dass er gelegentlich von seiner Überwindung träumte, vor allem nach, verkehrstechnisch ausgedrückt, vermehrtem Alkoholgenuss im vertrauten Kreis. Auf der Strecke pflegte er eine Variante, die es ihm erlaubte, sich vom Gros der Mitbewerber zu unterscheiden und eine größere Nähe zu den Grundtexten für sich in Anspruch zu nehmen. Man hätte ihn einem Rennfahrer vergleichen können, der einen irreparablen Rückstand ausnützt, um die hinter ihm herfahrende, in Wahrheit eine Runde vor ihm dem Ziel entgegenstürmende Konkurrenz auszubremsen und zu Fahrfehlern zu verleiten. Ganz so trachtete Tronka danach, den Vorteil einzuheimsen, den er sich gegenüber dem ›Feld‹ durch ein längeres und intensiveres Verweilen bei den Lösungsangeboten einer vergangenen Epoche einhandelte. Er hatte ihn entdeckt – so wie ein Kind eine Möglichkeit entdeckt, auf dem Schulweg zu trödeln, ohne dass es ihm selbst sofort auffällt, weniger, weil es ihm nicht in den Sinn kommt, das scharfe Erwachsenenwort darauf überhaupt anzuwenden, vielmehr, weil es, einmal auf Abwege geraten, den Umweg für den Weg nimmt und einen gewissen Stolz darein setzt, auf ihm zügig voranzukommen.
Beide Vergleiche hinken jedoch in einem Punkt. Der Rennfahrer und das säumige Kind wissen ganz gut, was sie tun. Aber sie ziehen es vor, situationsversunken zu agieren und jedem, der sie darauf ansprechen sollte, mit dem blanken Blick der Unschuld zu begegnen. Dagegen brillierte Tronka, sobald ihm jemand wie ich die Gelegenheit einräumte, übergangslos mit einer ebenso scharfsichtigen wie scharfzüngigen Analyse der Situation.
- ―Und wie stehen Sie dazu?
- ―Das verstehe ich jetzt nicht ganz...
- ―Ich meine, wie beschreiben Sie Ihre eigene Position?
- ―Sie wollen wissen, wo ich in diesem Spiel stehe? Wie ich Ihnen schon sagte, es handelt sich um ein Scheißspiel, das muss Ihnen klar sein. Aber wenn Sie wissen wollen, wie ich dazu stehe, dann schlage ich Ihnen vor, dass wir uns zu einem Privatissime in einem ordentlichen Restaurant treffen. Sie übernehmen die Rechnung und ich erkläre Ihnen die Philosophie. Janein, das halte ich jetzt für fair. Wissen Sie schon wo? Halt, lassen Sie mich nachdenken, eigentlich muss man gar nicht nachdenken, es gibt nur einen Koch in der Gegend, der gegenwärtig in Frage kommt, jedenfalls behaupten das die Auguren. Nein, ich habe ihn selbst nie getestet, aber die Fama ist großartig. Diese Leute haben ja noch eine Fama, unsereiner ist da ganz baff. Man könnte richtig neidisch werden... Aber es ist ja für eine gute Sache. Kochen, schmecken, bon. So geht das. Also lassen Sie uns eine Verabredung treffen...
Auch er wollte also bezahlt werden, um das zu tun, wofür Philosophen seit der Antike bekannt sind. Auch sein Denken, weit davon entfernt, zu den natürlichen Lebensvorgängen zu zählen, bedurfte, um in Gang zu kommen, der Apparatur aus Seminarveranstaltungen, Qualifikationsriten, Berufungsaussichten und einer am Lebenshorizont aufscheinenden umfassenden Rezeption durch die Zeitgenossen, von der er die Vokabel ›Ruhm‹ wie eine lästige Fliege fortgewedelt hätte – eine durchgestrichene Parole aus einer anderen Zeit, die ebenfalls unter das auf keinen Fall Gemeinte fiel.
Die Vorräte an keinesfalls Gemeintem waren unerschöpflich. Niemand bemühte sich um eine Bestandsaufnahme. Aus unsichtbaren Quellen erneuerten sie sich bei jedem Vorstoß und jedem Zusammenspiel der mit- und untereinander zerstrittenen Parteien. Spätestens wenn es galt, einen Projektantrag zu schreiben, für den Reise- und Publikationsgelder winkten, wenn man es nur richtig anstellte, war das nächste nicht Gemeinte zur Stelle und beantragte mit. So meinte auch Hiero keinesfalls dasselbe wie Tronka, wenn er sich im Hinterstübchen seiner akademischen Zukunftsplanung gute Chancen ausrechnete, Tronka zu beerben. Auch in seinem Kopf, dem des Schülers und kommenden Parteigängers, war das noch ungeschriebene, unpropagierte und unausgelegte philosophische Œuvre Tronkas bereits fix und fertig durchgestrichen und Tronka, der davon, biographisch gesprochen, nun wirklich nichts wissen konnte, reagierte darauf, indem er sich aller Verpflichtungen gegenüber dem Jüngeren ledig sprach und im Grunde schon im Vorfeld ihrer Zusammenarbeit auf der Suche nach einem Vorwand war, sich seiner auf halbwegs anständige Weise zu entledigen.

Bürger Hiero
Zum Teufel: Wer ist Hiero? Fragen wie diese datieren von den Anfängen schriftlicher Überlieferung. Als Versuche, sie zu beantworten, lese man die sumerisch-babylonischen Königslisten, die zugleich königliche Listen darstellen, den Lauf der Dinge auf irgendeine dunkle Weise zu beeinflussen, indem sie ihn der Regentschaft von Personen unterstellen, deren persönliches Gewesensein dabei in keiner Weise in Betracht kommt. In ihre Herrschaftszeiten fallen Überschwemmungen und Hungersnöte ebenso wie Feldzüge und blutige Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Gebietsherren, Besonderheiten der Ernte genauso wie Kometenerscheinungen und Palastrevolten, Epidemien und Feuersbrünste, der Untergang vage überlieferter Völkerschaften und die Geburt eines Knäbleins, in dessen Namen erstaunliche Dinge geschehen – die Erfindung eines Musikinstruments oder einer besonders grausamen Tötungsart. Hölzchen, der in seinen Vorlesungen das Kerbholz als eine noch frühere Weise herausstrich, das Wiederkehrende festzuhalten, vor allem aber als Aufzeichnungssystem, das eine ›effektive‹ Verwaltung und Kontrolle von Menschen ermöglichte, mochte dabei nicht unerwähnt lassen, dass auch die späteren Königsviten darüber Aufschluss geben sollten, was ein Herrscher auf dem Kerbholz hatte, insofern sie ihm gnadenlos alles zurechneten, was zu seiner Zeit geschehen war. Doch eigentlich verhielt es sich umgekehrt, da seine Allzuständigkeit die Welt, die sie umfasste, auch wieder aller scharf gezogenen Grenzen – darunter solchen des Besitzes – enthob und mit der kosmischen Perspektive die Perspektivlosigkeit eines solchen Herrscherdaseins unterstrich.
Dem eigenen, der Gegenwart näher liegenden Erzählen verschwimmen die Jahreszahlen und mit ihnen die Verantwortlichkeiten. Könige mutieren zu Erzählfiguren, die eine halbverborgene Hand auf dem Schachbrett der Erinnerung hin- und herschiebt, Helden zu Leuten, die mit einer Bewegung des Daumens oder einem Zittern der rechten Hand die Richtung angeben, in die sich augenblicks ganze Gesellschaftsformationen bewegen, ohne dass jemand sie nach Befehlen oder bloß Ratschlägen gefragt hätte. Es ist richtig, auch Denker gehen zur Wahl wie andere Bürger, jedenfalls in einer Vielzahl von Ländern; zumindest steht es ihnen frei. Ihr Wahlverhalten fließt in die Erzählung nicht ein, es lässt sich nur ausnahmsweise und nicht zu ihrem Vorteil dort nachlesen und ist daher besser als nicht vorhanden zu werten. Dennoch sind dies die Momente, in denen sie tatsächlich mit der Geschichte kommunizieren. Es sind Momente, in denen sie sich einem akademischen Euphemismus zufolge, der in Hieros Frühzeit noch zu den Zauberformeln einer bestimmten Schule gehörte, später in den allgemeinen Gebrauch überging und jede ›distinkte‹ Bedeutung verlor, in die Geschichte ›einschreiben‹, nur leider nicht nach Art von Monarchen, deren Tun und Lassen in jedem Aspekt bedeutsam und an seinen Folgen kenntlich ist. Wenn Hiero wählen ging, dann deshalb, weil er irgendwann verstanden hatte, dass die anderen sich auf keinen Fall davon abbringen ließen und er nicht hinter ihnen zurückstehen wollte. Seit er sich ›mit Verfassungsfragen beschäftigt‹ hatte, wiegte er sich in der blasphemischen Überzeugung, dass diesem kleinen, aber unverzichtbaren Baustein des demokratischen Prozesses angesichts der Aufgaben, die in einer Gesellschaft gelöst werden mussten, praktisch keinerlei Bedeutung zukam. Ein Problem der ›operativen Politik‹, zur Wahlzeit aufgeworfen, mutierte umstandslos zum Faustkeil in den Händen einer primitiven Horde, die sich nach erfolgtem Urnengang mehr oder minder mühsam wieder in eine politische, das heißt mit Vernunft und Augenmaß operierende Körperschaft zurückverwandelte.
Wahlen waren Vertrauensbeweise. Sie sorgten dafür, dass immer die gleichen Gesichter im Fernsehen erschienen und über die anstehenden Entscheidungen plauderten. Es war richtig, wenn Politiker, die sich auf Marktplätzen erhitzten und Überzeugung in Gesichtsröte verwandelten, in den Wahlkabinen abgestraft wurden. Vage konnte er sich noch an die Schreihälse der frühen Studentenbewegung erinnern, an merkwürdig verquollene Megaphonstimmen, an das Zucken im Gesicht seines Vaters, an die halbwegs unterdrückte Erregung der Mutter, die stumm das Wohnzimmer verließ. Er war ihr in die Küche nachgegangen und hatte eine Hand auf ihre gelegt. Gern hätte er ihr gesagt, dass es diesmal anders war, dass es diesmal anders gemeint war – aber angesichts der vorgefundenen Wand aus Bedrückung hatte er es vorgezogen, gar nichts zu sagen und sich nach draußen zu verziehen. Er überlegte, ob ihre Hand gezittert hatte, fand aber keinen Anhaltspunkt dafür im Gedächtnis.
Damals trug er die Haare lang. Die Bäckersfrau, mit der er sich gern unterhielt – sie glühte immer ein wenig, als käme sie frisch aus dem Backofen –, nannte das eine Jesusfrisur und lächelte vielsagend dazu. Von Kreuzigung schien dabei nicht die Rede zu sein. Eher durchgeisterte ihn die Empfindung einer unendlichen Sanftheit, die sich an den Mauern der umgebenden Borniertheit brach, übrigens auch der megaphonbewaffneten Interessenvertreter eines derweil ruhig den nächsten Urlaub planenden Proletariats, deren Auftritte er im Fernsehen mit einer seltsamen Erregung verfolgte. Das waren seine Leute da draußen, er würde sich, sobald die Zeit da war, zu ihnen gesellen und sie würden ihn als einen der ihren in ihre Reihen aufnehmen. Doch konnte er sich nicht verhehlen, dass sie ihm ähnlich fremd und unwirklich vorkamen wie die überschminkten Schauspieler, die im Rampenlicht der städtischen Bühne einer Tätigkeit nachgingen, die er verachtete oder zumindest lächerlich fand. Ja, es gab sie noch, neben der Avantgarde der Arbeiterklasse: die bürgerliche Avantgarde, deren Spiel begann, sobald die Lichter im Zuschauerraum erloschen. Man hatte ihm zwar erlaubt, den Religionsunterricht zu quittieren, aber eine Theateraufführung blieb für die geistige Entwicklung des Gymnasiasten unabdingbar und konnte keineswegs abgewählt werden.

Bühnendienst
Als er im Kreise seiner Mitschüler eintraf, lag der Theaterraum völlig im Dunkeln. Die Regie hatte eine Vielzahl einzelner Podeste geschaffen, die nach und nach als im Zuschauerraum verstreute Lichtinseln sichtbar wurden. Bei Szenenwechseln sprangen die Schauspieler, nackt bis auf die Geschlechtsteile, die in fleischfarbenen Hüllen steckten, über die verstreut sitzenden Zuschauer hinweg von Podest zu Podest, verfolgt von Scheinwerfern, die keine ihrer Bewegungen ausließen. Ein Luftzug traf Hiero, als eine Schauspielerin über ihn hinwegsprang. Er hatte die vage Assoziation von Gummi und wäre nicht weiter erstaunt gewesen, hätte sich aus dieser scheinbar so lebendigen Gestalt eine quäkende Lautsprecherstimme vernehmen lassen oder auch nur ein verdächtiges Knacken, Knistern oder Prasseln. Gern hätte er in dem Moment die Gesichter seiner Mitschüler betrachtet. Aber die Dunkelheit hatte sie ausgelöscht. So starrte er, allein in seiner Haut, zu einem Paar trainierter Schenkel empor, zwischen denen sich eine ungewisse Maskerade auftat. Sie erregte ihn mehr als das Stück.
Es war ein Akt der Anbetung, er wusste es wohl. Ein Strahl des Heiligen hatte ihn getroffen und hätte er ein wenig intensiver in der Rilke-Ausgabe geblättert, die seine Mutter absichtsvoll in der Wohnung herumliegen ließ, dann wäre ihm vielleicht der Vers Masken, Masken! Dass man Eros blende! in den Sinn gekommen, vorausgesetzt, seine aufgedrehte Gemütsverfassung hätte dergleichen zugelassen.
Sicher ist das nicht. Denn eigentlich war dies hier sein Stück. Widerwillig musste er es einräumen, während er auf seinem Theaterstühlchen herumrutschte und sich intensiv am Hinterkopf kratzte, so dass die Nachbarin zischend protestierte. Es spielte in den Folterkellern des spanischen Generalissimus. Mehr als das: Es spielte in den gequälten Herzen einer Zuschauerschaft, die den antifaschistischen Kampf auf ihre Fahnen geschrieben hatte und zähneknirschend mit ansehen musste, was alles an Orten geschah, zu denen sie keinen Zutritt besaß. Wenn die Schauspieler von einer Plattform zur nächsten sprangen, verflüchtigten sie damit zugleich ihre Rollen – waren sie gerade noch Verhörer, Peiniger, Folterer, so verwandelten sie sich im Fluge in tränenselige Angehörige, sogar in die Opfer selbst, bevor sie wieder zurückflohen oder an neue Orte, an denen neue Maskeraden gefragt waren. Sogar eine täuschend echte Garotte hatte man aufgebaut, falls sie nicht vom Himmel herab mitten auf die städtische Bühne gefallen war. Der Garottierte blieb dieser Möglichkeit gegenüber merkwürdig kühl, er schien entschlossen, sich durch keine Folter vom einstudierten Text abbringen zu lassen. Je furchtbarer der Dorn auf sein Genick drückte, desto widersinniger erschien Hiero dieser Text. Er wäre gern dazwischen gegangen und hätte ein paar klärende Worte gesprochen, doch ein dumpfes Gefühl der Unangemessenheit hielt ihn auf seinem Sitz.
Dieses Stück, das in einer seltsam kalten Vergangenheit spielte und Worte machte, wo Taten erforderlich waren, verschwieg die Gegenwart. Das schien sogar seine hauptsächliche Aufgabe zu sein, bezog man den Szenenapplaus der unsichtbaren oder nur als dunkle Kulisse ahn- und fühlbaren Theaterbesucher in die Darbietung ein. Es schien ein fast beruhigender Gedanke, wenigstens einen Ort auf diesem Planeten zu wissen, an dem der echte, alte Faschismus noch immer Gewalt übte. Wie schwer fiel es dagegen angesichts der Phalanx der guten Leute, die über soviel Unverstand nur den Kopf schütteln konnten, den heutigen Faschismus erfolgreich zu denunzieren, der so sichtbar auf Welteroberungskurs ging und dabei von einem heldenhaften kleinen Volk gestoppt wurde, das, ebenfalls nahezu unsichtbar, in seinen Erdlöchern hockte.
Auch hier war Hysterie im Spiel, er fühlte es mit Befremden. Aber genausogut wusste er: es war seine Aufführung.
Das hier war die Welt seiner Empfindungen und Emotionen, angefacht und in Gang gehalten von Wesen, die seinesgleichen waren und mit ihm über ein System unsichtbarer Ganglien kommunizierten. Es war nicht die Welt der Eltern, die ihn damals noch wie ein komfortabler Käfig umschloss, mit Stäben, zwischen denen er sich frei hindurchbewegen konnte, die aber dennoch, weil vorhanden, die Grenzen seiner Welt markierten. Halt, das war so nicht richtig. Sie zerstückelten diese Welt, denn sie hinderten ihn an ihrer systematischen Erforschung und schufen Dunkelzonen wie hier, wo die Inseln, auf denen gelitten und qualvoll gestorben wurde, sich ebenso wenig durch die Sprünge der Schauspieler zu einer großen Bühne zusammenfügten. Rätselhaft, diese Schauspieler. Angestarrt von überall her aus dem voyeuristischen Dunkel des alles überflutenden Zuschauerraumes, zusammengedrängt an scharf voneinander getrennten Orten, die das Maß der anderen trugen, geriet ihnen alles, was sie sagten und taten, zu seltsam unfertigen Kunststücken, wie Hunden, denen man das Apportieren beigebracht hatte, die aber für diese Art von Einsatz zu intelligent wirkten. Was sie sagten und taten, besaß einen unangebrachten Anstrich von Wirklichkeit, der auffiel, weil zwischen ihnen auch immer ein, zwei Schauspieler der alten Schule agierten, die sichtlich Schwierigkeiten mit der Inszenierung hatten, vielleicht auch mit dem Stück, da kannte er sich nicht so aus, die aber ihre Rolle spielten – vielleicht, wer weiß, die überzeugendste ihres Lebens.
Aber, aber... wenn das so war, warum mied er danach das Theater? Warum behandelte er es nachgerade wie einen Ort, an dem er Unbill erlitten hatte? Und dazu hatte es nicht einmal eines Beschlusses bedurft. Jedenfalls konnte er sich an keinen erinnern. Stattdessen zog ihn Abend für Abend der schwarze Kasten des Fernsehers in den Bann, aus dem jene frühen Bilder und Schreie gequollen waren.
Auch dafür ließen sich Gründe finden. Dass an den Orten, an denen damals die wirkliche Bühne aufgeschlagen schien, ihn nur die Spinnweben einer abgeräumten Inszenierung erwartet hatten, sah schon gewaltig nach Kränkung aus, vielleicht nach mehr. Das Theater des Wirklichen hatte beschlossen, ihm keinen Zutritt zu gewähren. Wo immer er nach seiner Bartosz-Zeit hinkam, die prominenten Schauspieler waren bereits weiter gezogen, teils ins Gefängnis, teils in den Untergrund oder in die Psychiatrie, teils in die Parteiarbeit oder ins Feuilleton. Die Leute, die jetzt ihre Rollen mimten, kamen nicht in Betracht. Niemand kümmerte sich um sie. Allenfalls eine mürrische Polizei musste sich, da sie einen Unruheherd darstellten, mehr als angebracht mit ihnen befassen, während der weitgehend unsichtbare Staatsschutz ein waches Auge auf das hatte, was ein neueres Präventionsbedürfnis als ›Sympathisantenszene‹ beschrieb.
Hiero, seinen ins Badewasser hineingleitenden Körper betrachtend, fragt sich, was das sei: Resignation. Er weiß, dass er abnehmen muss, um wieder in Form zu kommen, nicht viel, verglichen mit anderen, aber merklich. Die Gewichte zwischen seinem Körper und ihm haben sich zu seinen Ungunsten verschoben und das Possessivpronomen macht die Sache nicht besser.
Zweifellos trägt er Verantwortung für diese Mitgift, die ihm zugewachsen ist, ohne dass er sich irgendwann wirklich für sie entschieden hätte. Das Paralleluniversum der Physiker, hier ist es Wirklichkeit und will gepflegt werden. Seine Funktionen, soweit die Wissenschaft bisher in sie eingedrungen ist, liegen offen zutage, seine Chemie ist weitgehend bekannt. Dennoch: Auch wenn die Forschung zügig weiter vorstößt, bleibt es eine abgedunkelte Realität, ein non-esse, verglichen mit den Intimbereichen des Bewusstseins, in denen, was ›Ich‹ sagt, auch Ich meint und mühelos auf alle Bestände zugreift, die darunter fallen, es sei denn, es hält sie versteckt – vor sich selbst, was hin und wieder vorkommen soll.
Versteckst du etwas, mein Guter?
Ich? Das wäre ja absurd.
Der Körper, gelegentlich Leib genannt, verhält sich, streng genommen, wie die Gesellschaft. Auch er ist das Ich noch einmal, nach außen getragen, ohne Bewusstsein. Seine wunderbaren Funktionen sind wirklich, sie sind vorhanden und einsehbar und nicht nur das: sie sind zur Hand, gelegentlich jedenfalls, wenn man sie braucht, ›im Großen und Ganzen schon‹, wie man dort zu sagen pflegte, wo er zu Hause war. Aber nur für ein Bewusstsein, das sich sagen muss, dass von ihm selbst nichts bliebe, käme es auf die glorreiche Idee, sich von dem, was da so handlich zugegen ist, abziehen zu wollen. Ein Ichts könnte man den aus dem Bewusstsein herausragenden Körper nennen, um das lästige Nicht-Ich zu vermeiden, das andere Assoziationen weckte. Ein sich ins Nichts erstreckendes, vielleicht sich ergießendes, vielleicht stetig entweichendes Ich, oberflächlich vergleichbar der verschwundenen, in die Gesellschaft diffundierten Avantgarde, die einmal auszog, die Welt zu verändern.
Was ist eigentlich aus dem avantgardistischen Theater geworden? Ein Geklapper von Bühnenschneidern mit Kriegsherren-Allüren. Sobald ein Blättchen ihnen die Spalten öffnet, ziehen sie gegen einander vom Leder. Ist wirklich die Großsprecherei die Kehrseite jener ungeheuren Sensibilität, die ihrer Arbeit von den Theaterkritikern bescheinigt wird? Wer das wüsste. Ehrlich gesagt, nichts reizt ihn, den Preis an Zeit und Umständen zu entrichten, der nötig wäre, es heraus zu finden.
Außerdem ist so ein Theaterabend nicht billig. Er ist sogar absurd teuer, wenn man in Rechnung stellt, dass alles, was dort gesprochen wird, bereits zwischen zwei Buchdeckeln geschrieben steht, die er mitsamt Inhalt im Antiquariat für ein paar Pfennige erwerben kann. Diese entsetzliche Wiederholungssucht schlägt aufs Gemüt. Letztlich hat sie ihn auch der Politik entfremdet. Im Fernsehen schmerzt sie nicht, seltsamerweise. Das Medium ist der große Gleichmacher. Man schaltet ein, man schaltet aus. Nie siehst du, was du offenbar sehen sollst, und nie erfährst du, was es neben dem gezeigten Ausschnitt zu sehen gibt, dort, wo es spannend würde. Das Fernsehen ist die technische Realisierung des Immergleichen. Im Grunde funktioniert es wie die Kacheln an der Wand, auf deren serielle Schönheit du keinen Wert legst. Sie sind aber vorhanden und das ist ›irgendwie‹ richtig und will, schließlich bist du ein folgsamer Mieter, bezahlt werden. Alles, was im Leben Mühe macht, ohne das Ich zu mehren, tropft an ihnen ab. ›Abtropfen lassen‹ – eine väterliche, vielleicht altväterliche Ermahnung. Als du ein Knabe warst, hat sie dich zur Weißglut getrieben. Eingelagerte Erinnerung, merkwürdig: ein Pudel-Ich, verschattet, gekränkt, dampfend vor Ungeduld und Revanchelust, stürmt das Wohnzimmer mit dem silbrigen Licht auf Sideboard und abgrundtiefen Sesseln, über die man sich beugte, als habe ein tragisches Schicksal die Erwachsenen zu einem Unterdasein verurteilt, was ja auch stimmte.
Die Pyramide schimmert durch den Sprühregen, in dem sie höher erscheint. Ein weiches, aus unbestimmten Fernen eingefangenes Licht spielt auf ihrer Oberfläche. Hiero, der so oft unter ihr hindurchspaziert ist, kann sich noch immer nicht entscheiden, ob er die gläsernen Elemente, aus denen sie zusammenfügt ist, wirklich Waben nennen soll. Diese scheinbar spontanen Rückgriffe auf Biologisches sind ihm zuwider. Auffallend viele Modernismen bedienen sich solcher Analogien. Im Grunde wollen sie sagen: Stell dich nicht so an! Sieh dich um – funktionierst du anders? Funktionierst du denn anders? Sieh an dir herunter, am besten in dich hinein, beobachte dich und deinesgleichen, dann wird die Differenz schon schwinden. Vielleicht lehnt er sie gerade deshalb ab. Wenn er damals gelitten hatte, dann nicht ›wie ein Tier‹, sondern wie ein Mensch. Diese Pyramide war neben seinen Sorgen und Ängsten in die Höhe gewachsen, unbemerkt von ihm und seinesgleichen, unverbunden mit seiner Lebenswelt. Aber das stimmte nicht wirklich. Während er Seminare besuchte und sich die dort erbrachten Leistungen quittieren ließ, hatte die ›Modernisierung der Hochschullandschaft‹, wie die Gebetsmühlen der Politik sie nannten, von protestierenden Studenten wenige Jahre vorher stürmisch gefordert, Bauten wie diesen hervorgetrieben. Wie konnte ihm das entgehen? War es ihm überhaupt entgangen? Wenn nicht, dann hatte er ein Problem mit seiner Wahrnehmung. Hatte er es verdrängt? Mein Gott, was für eine Allerweltsvokabel. Welche Volumina musste einer aufbieten, um so etwas zu verdrängen? Wozu? Was lag an diesem Bau? An diesem Bau wohlgemerkt, der sich vielleicht durch seine ›ästhetisch anspruchsvolle‹ Gestalt von den anderen, die er nach und nach kennenlernte, unterschied? War das wichtig?
Die Pyramide war anders: sie enthielt keine Studenten. Bemerkbar machte sich das in der transparenten Ruhe hinter den sich gelassen jedem einzelnen Besucher widmenden Eingangstüren, der schwebenden, durch keinerlei Kritzeleien verdorbenen Eleganz der Aufzüge, überhaupt in der Abwesenheit von Parolen, mit denen schnellfingrige Aktivisten in den anderen Universitäten die Wände besprühten, vor allem aber im Katalogsaal der Bibliothek, der Hiero, als er ihn zum ersten Mal betrat, vor allem dazu bestimmt schien, den galaktischen Ort des menschlichen Wissens zu repräsentieren. Noch waren die mechanischen Systeme intakt, während die Großrechner in den klinischen Eingeweiden der Institution bereits ihre Arbeit aufgenommen hatten. Die Karteischränke, glänzend schwarz und luftig auf grazilen Metallsäulen ruhend, liefen als dunkles Band vor der gläsernen Außenwand auf einen Fixpunkt zu, an dem sich der Raum zu den verschiedenen Aufgabenbereichen hin auffächerte.
Hiero, einigermaßen verdutzt ob der ungeheuren Verkürzung aller Funktionswege, ertappte sich nach dem Ausfüllen der Leihzettel bei dem Wunsch, an der ebenso langen wie – fast – menschenleeren Theke auf- und abzutigern, um nicht zu verpassen, wie die Bestellung eintraf. Der zeitliche Aufwand erschien ihm gering, nein, beliebig angesichts der ihm auf Förderbändern, die an die Gepäckbeförderung auf Flughäfen erinnerten, aus dem Inneren einer den Blicken Unbefugter entzogenen, dennoch transparenten Magazinwelt entgegenschwebenden Bücherhaufen.
Nein, er machte sich nichts vor. Ein und derselbe Prozess hatte diese futuristische Wissensarchitektur und die individuell so unterschiedlich angelegten Wissenschaftlerpsychen eines Kärich oder Tronka geformt. Dieser Prozess ging durch alles hindurch, was sie dachten, berieten und taten. Er war größer als sie und er bedeutete mehr. Es war nur folgerichtig, dass Tronka, nachdem das System ihn bis aufs Blut gemartert hatte, einen Ruf an diese erst vor wenigen Jahren eröffnete Universität erhielt. Selbst die Karenzzeit erschien im Nachhinein maßvoll. Der Teppich, auf dem er wandeln sollte, musste erst verlegt werden. Selbst ein Umzug erübrigte sich – so sehr kam das System ihm entgegen. Umso seltsamer, dass die Pyramide in seinem akademischen Universum bis zum Zeitpunkt der eher mechanisch vorgenommenen Bewerbung nicht aufgetaucht war.
Hiero erfasste instinktiv, dass hier etwas nicht stimmte. Auch er weigerte sich, dem Gedanken an einen Umzug, der praktische Vorteile geboten hätte, näher zu treten.
- ―Warum? fragte er Pw, der ihn, den
Finger im Bierglas, nachdenklich ansah. Mechtel bestärkte ihn in
dieser Auffassung, ließ aber ihre Motive im Dunkeln. Sie hatte sich,
was er ihr hoch anrechnete, nach der missglückten Nacht nicht vom
Umgang mit ihm zurückgezogen. Eine ruhige, fast hatte er sagen
mögen, versonnene Vertrautheit herrschte neuerdings zwischen ihnen.
Ein schwieriger Fall, der offenbar der weiteren, von ihm hartnäckig
hinausgeschobenen Bearbeitung harrte.
Sein erster Bericht über die Pyramide stieß auf wenig Resonanz. Er hatte den Verdacht, dass die Gruppe den Casus absichtlich tiefer hängte. Man wollte die Verschiebung der Gewichte vermeiden, die nach Lage der Dinge eintreten musste. Er konnte das gut verstehen, aber lästig blieb es schon, sogar kränkend. Gern wäre er hin und wieder bereit gewesen, auf den Positionsvorteil zu verzichten, den seine ebenso erwartete wie überraschende Anstellung nun einmal mit sich brachte, wäre es nur möglich gewesen, die ungeheure Kluft zu bereden, die seine neue Umgebung von dem in langen Semestern eingeübten Universitätsalltag schied.
Aber er drang nicht durch. Abrupt wurde der Zug seiner Gedanken auf freier Strecke angehalten. Eine unsichtbare Hand verwehrte es ihm, mit seiner Fracht aus bedeutenden Neuigkeiten in den Bahnhof der gemeinsamen Neugier einzulaufen. Wie das? Er musste sich in die Kindheit zurückphantasieren, in Umstände, die er hinter einem Vorhang aus alter Scham und gewachsener Geringschätzung sicher verborgen gewähnt hatte, um auf Vergleichbares zu stoßen. Dabei lag Neugier im Raum, er spürte es. Sie wurde zurückgehalten von einer Kraft, gegen die er nicht ankam. Vielleicht befanden sich die anderen, die er instinktiv für die Seinen hielt, in einer vergleichbaren Lage, vielleicht kamen auch sie nicht gegen den Dämon an, der sie in solchen Momenten regierte. Vielleicht hämten sie hinter seinem Rücken, wer konnte das wissen? Die Wand existierte – unwirklich, unverrückbar. Zwar gewährte sie, gleich der Außenhaut der Pyramide, weiterhin Durchblick, aber der direkte Kontakt war verloren.
Einige Wochen später hatte sich die neue Erfahrung bereits insoweit den Umständen angepasst, als sie bereitwillig in den Hintergrund rückte, sobald sich der Kreis um ihn schloss. Nein, auch das stimmte nicht ganz. Ein Teil von ihm strebte oder floss, folgsam wie ein Hund, dem Hintergrund zu, der zwar die ganze Zeit über vorhanden blieb, aber von dem anwesenden Teil der Person keines Blickes gewürdigt wurde. Auch das war neu und es fühlte sich keineswegs gut an. An unvermuteter Stelle war Hiero auf das Tabu gestoßen, das die gesellschaftlichen Dinge regiert, und hatte es nach mehreren Versuchen, es einfach zu überrennen, stillschweigend akzeptiert. Nun, vielleicht nicht akzeptiert, das klang nach einem bewussten Vorgang, einer Art Abmachung, die er zwischen sich und sich getroffen hätte. So war es nicht. Er hatte es angenommen wie eine neue Gewohnheit und wunderte sich gelegentlich über sich selbst, wunderte sich über diese merkwürdige Schwäche, die er zugleich genoss und verachtete. Anfangs war er sicher, die Akzente jederzeit neu setzen und eben deshalb für diesmal darauf verzichten zu können. Dann vergaß er auch das.
Was ihm widerfuhr, besaß in Tronkas Benehmen sein Widerspiel. Schon bei der ersten Begegnung in der Pyramide fand er ihn verändert: seltsamerweise nicht größer, sondern kleiner geworden, gedrungener sozusagen im milde einströmenden Gegenlicht, als er aus dem Aufzug heraustrat und ihn absichtlich stehen ließ, um erst das Gespräch mit ein paar jungen Leuten zu beenden. Gleichmütig, mit einem leicht blasiert wirkenden Lächeln im Gesicht, hörten sie ihm zu und zerstreuten sich in unterschiedliche Richtungen. Was er Hiero anbot, während sie dem Professorenzimmerchen zuschlenderten, war erschreckend mager – eine ›Hilfskraftstelle‹. Altmodisch, wie er nun einmal sei, fand Tronka, dass einer ›schon promoviert‹ sein müsse, um Anspruch auf einen Assistentenposten zu erheben. Hiero, der die gängige Praxis kannte, schluckte trocken und griff zu. Sein Inneres tobte. Neinneinnein schlug es gegen die Rippen. Der simple Gedanke, Tronka habe zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar keine Assistentenstelle zu vergeben gehabt, kam ihm erst später, viel zu spät, um noch Einfluss auf das zu nehmen, was die Sprache der Zeit sein ›Verhältnis‹ zu Tronka nannte und das, nachdem sich die Dinge so entwickelt hatten, nur noch ein Unverhältnis sein konnte. Tronka hatte ihn zwar nicht abgehängt, aber auf die Plätze verwiesen. Eine Hilfskraft blieb eine Hilfskraft, jederzeit auswechselbar, ein gesichtsloses Wesen.

Hieronymus im Gehäus
So unerwartet und unverhältnismäßig Hiero die Distanz auch erscheinen musste, die durch die neue Rollenverteilung entstand, so beflissen ergab er sich in sie. Eisern hielt er sie auch in Situationen aufrecht, in denen Tronka nichts daran gelegen schien. Hiero, der immer neu davon überrascht wurde, hatte beschlossen, kein Jota der neu gefassten Distanz preiszugeben.
- ―Hm, brummte Tronka, wenn es ihm wieder nicht gelungen war, den Adepten, der seine Sache ansonsten gut machte, aus der Reserve zu locken. Den Blick auf die Schuhspitzen gerichtet, als sei dort die Lösung des Rätsels zu finden, sprach er die Silbe mehr in sich hinein. Fast hörte es sich so an, als stünde er darüber in einem Dauerdialog mit sich selbst, aber das konnte sich Hiero beim besten Willen nicht vorstellen. Er hätte es auch nicht gewollt.
Dafür war sein Mund jetzt ohne weiteres im Stande, Sätze zu bilden wie Ich bin nur eine einfache Hilfskraft, als habe das Schicksal selbst seinen Zögling auf dieser Sprosse der sozialen Leiter abgesetzt und ihm damit eine Existenzform gegeben, an der nicht mehr zu rütteln war. Was sich für die jungen Leute des Instituts wie Knechtseligkeit anhörte, wurde von Tronka umgehend als Trotz ausgelegt. Beides verfehlte den Kern der Sache. Anders als den Beschäftigten, Tronka inbegriffen, denen Hiero unter dem Dach der Pyramide begegnete, reichte ihm der mütterliche Scheck vollauf zum Leben. Keine materielle Notdurft trieb ihn zum Dienst. Die possierliche Stelle löste für ihn kein unabweisbares Daseinsproblem wie Mietzahlungen oder Benzinrechnungen, sie bescherte ihm höchstens eines. Durch sie wurde das Dasein selbst, jedenfalls in sozialer Hinsicht, zum Problem.
Hätte er sie nicht angenommen, wer weiß, er hätte womöglich den Einstieg in jenen langen Prozess verpasst, an dessen Ende das bewusste Schildchen an seiner Tür kleben würde. Doch so? Mit einer Stelle wie dieser, kaum Stelle zu nennen, war er ein Teil des Betriebes. Aber er war es nicht wirklich. Hilfskräfte fielen, so hatte er zufällig einem Wortwechsel zwischen Tronka und seiner Sekretärin entnommen, rein haushaltstechnisch unter die Rubrik ›Sachmittel‹. Er war also gewissermaßen gar nicht vorhanden, vergleichbar allenfalls den Aufzügen und Rollbändern in der Bibliothek, die immerhin den Vorteil hatten, fest eingebaut zu sein und nicht von Semester zu Semester um ihre Anstellung bangen zu müssen.
Beginnt man ein Professorendasein als Sache? Er wusste es nicht und hätte es gern gewusst. Fragen konnte er niemanden, nicht einmal sich selbst, da er die Antwort im voraus wusste. Auch kam es ihm nicht in den Sinn, sich zu beklagen. Also blieb nur die Stelle, eine leichte Verhärtung, subkutan, wie es sich gehörte. Er gewöhnte sich daran, sie mehrmals am Tag zu betasten, als habe er da einen Begleiter, nach dem er sehen müsse, weil die Verantwortung es so mit sich brachte.
Keine der anderen Hilfskräfte, das hatte er rasch erkannt, schlug sich mit seinem Problem herum. Er begegnete ihnen am Kopierer, in der Bibliothek, sie lachten und redeten ungeniert miteinander, ihr akademisches Fortkommen schien ihnen gleichgültig zu sein. Sie rechneten sich aus, ob sie ihre Miete bezahlen konnten und planten die nächste Ferienreise. Er lauschte ihren Stimmen, oft verwirbelten sie sich und er hörte ein Gezwitscher, das sich verlor, ohne dass er wusste, wie ihm geschah. Dann fand er sich an der langen Theke allein vor den aufgetürmten Bücherstapeln wieder; die anderen waren gegangen und er hatte nichts gemerkt. Wenn er sie das nächste Mal traf, bemühte er sich, es wieder gutzumachen, aber das erwies sich als schwierig. Denn auch sie hatten nichts gemerkt. Er war ihnen auf dieselbe unmerkliche Weise abhanden gekommen wie sie ihm.
Weißt du noch, wie schwierig es war, dir ihre Gesichter einzuprägen? Wie prägt man sich ein Gesicht ein, das einem entfällt? Hat man es denn im Moment des Entfallens? Ein Name, der einem gerade entfallen ist, wird einem wieder einfallen, spätestens dann, wenn man ihn nicht benötigt. Aber ein Gesicht? Wie sieht ein Gesicht aus, von dem man weiß, dass man es nie vergessen kann? Woher weiß man so etwas? Wie sieht ein Gesicht aus, das man im Anschauen schon wieder vergisst? Wie kann so ein Gesicht aussehen?
Auch das mit den Namen gestaltete sich schwierig. Immerhin, den einen oder anderen behielt er, so dass ihn über ein paar Eselsbrücken abrufen konnte. Besonders hilfreich war das nicht. Wollte er die betreffende Person ansprechen, so durfte er fast sicher sein, dass er ihn nicht parat hatte. Peinlich peinlich, mit solchen Ausfällen war keinem gedient. Also verlegte er sich darauf, Patzer wie diese in seiner Rede zu vermeiden. Leicht war das nicht. Doch mit der Zeit entwickelte er ein verzwicktes System direkter und indirekter Verweisungen, das es ihm erlaubte, dem Namenszwang zu entgehen, der in aller Rede steckte wie die Natur in der Regenhaut der sozialen Existenz.

Der Zungenschlag der Geschichte
Sei es, dass das System irgendwann aus dem Bereich der Sprache auf den der realen Personen übersprang, sei es, dass die durch wechselnde Umgebungen erzwungene Dissoziation ernstere Folgen nach sich zog – eine Zeitlang hatte er die Empfindung, ein und derselben Person an verschiedenen Orten zu begegnen: den einen Tag unter dem Dach der Pyramide, anderntags draußen in seinem alten, nicht eine Sekunde lang aufgegebenen Lebenskreis. Dort durchschritt er nach wie vor die wilhelminische Pforte zum Lesesaal der Bibliothek, wenn es galt, sich ein Buch anzueignen, das ihm für seine Arbeit essentiell zu sein schien. Als traue er Druckerzeugnissen nur eine verminderte Sachhaltigkeit zu, die, sobald er einen entsprechenden Wunsch geäußert hatte, wie von Zauberhand bewegt auf unsichtbaren Rollbändern auf ihn zuliefen, beruhigte er sich erst, wenn er ihr Gegenstück aus der vermeintlich wirklicheren, auf konventionelle Weise aseptischen Welt in Händen hielt.
Verdoppelten sich die Gegenstände unter den gegebenen Bedingungen, so legten die Menschen offensichtlich zusammen. Das galt nicht für Tronka, der erklärtermaßen derselbe war, auch wenn er als ein jeweils anderer agierte, aber es galt für diese Person, der er selbst in ruhigen Stunden keinen Namen mehr zuordnen konnte, obwohl er wusste, dass er ihm im Prinzip geläufig war. Er vergaß diese Person radikal, so radikal, wie er nie einen Menschen vergessen hatte, sobald er sich von ihr verabschiedet hatte, um das Gespräch, ohne Anrede wie in einem Film, wo alle gleich umstandslos zur Sache kommen, am jeweils anderen Ort weiterzuführen – ein Gespräch, das offenbar irgendwo begonnen hatte und sicher irgendwohin führte, ohne dass eins dieser Irgendwos jemals in ihn eingedrungen wäre. Schattenhaft umschwebte ihn der Gedanke, dass er es mit einem doppelt vorhandenen Gegenüber zu tun hatte. Auch das drang nicht in ihn ein. Es dauerte Jahre, bis die Erinnerung diesen überaus schematisch geschnittenen Streifen freigab und ein blasses, mit hellem, gekräuseltem Haar umwickeltes Männergesicht zum Vorschein brachte, das er überhaupt keinem Ort mehr zuordnen konnte.
Tronka selbst schien von derlei Anwandlungen frei zu sein. Was für seine Persönlichkeit hätte sprechen können, bezeugte seine wachsende Ignoranz. Doch gab es Tage, an denen er eine Fremdheit herauskehrte, die Hiero weniger verstimmte als seinerseits befremdete und sogar bestürzte. Wie konnte es passieren, dass die so gegründet erscheinende Erwartung, mit dem Dozenten seiner Wahl gemeinsam an die Ausarbeitung einer neuen Philosophie zu gehen, jetzt von Begegnung zu Begegnung in eine fernere Zukunft zurückwich, während doch ein Wort, ein Blick, ein bedeutsam verabreichter Händedruck genügen würden, sie in voller Kraft im Raum erstehen zu lassen? Immerhin handelte es sich um keine unangemessene Erwartung, da die Grundzüge der neuen Philosophie durch die Arbeit des Älteren bereits vorgegeben war. An tausend Ecken verlangte sie nach Begründung, Verteidigung und Anwendung, nach geduldigem Bohren all der harten Bretter, die wie ein dichter Verhau aus schmutzigen Hypothesen die eigene Position umgaben und nach und nach zu Stützen des Systems umgeschaffen werden mussten. Das war offensichtlich und ›nicht verhandelbar‹. Es kam aber im Alltag nicht zur Geltung. Schon das langwierig ausgehandelte und trotzdem, wie er sich eingestehen musste, ihm von Tronka ›aufgedrückte‹ Thema der Dissertation glich in dieser Hinsicht einem geschickt zwischen sie getriebenen Keil, der sie gewissermaßen auseinander- und zusammenhielt.
Das Thema... Hiero hatte, bevor er sich endgültig dazu entschloss, auch mit mir Gespräche darüber geführt. Diese Unterhaltungen hatten mich, wie man so sagt, etwas gelehrt. Im Grunde war es nichts, was ich nicht gewusst oder vermutet hätte. Aber sie versahen es mit einem Schuss Widersinn, der seinem Weltverhältnis in meinen Augen eine neue Tönung gab. Hiero benahm sich wie jemand, der nicht weiß, ob er die Frau seines Herzens heiraten soll, weil er die Ehe als Institution zwar befürwortet und es ihm schon recht wäre, sie mit dieser Frau einzugehen, er aber doch gewisse nicht auszuräumende Zweifel hegt, ob er für sie auch der Richtige ist – teils, weil er sich kennt, teils, weil er sich nicht kennt, was beides, hinreichend skrupulös bedacht, darauf hinausläuft, dass er nicht, jedenfalls nicht für alle Zukunft, für sich bürgen kann und er es als unzulässig empfindet, die Geliebte für ihn bürgen zu lassen. Brautvater Tronka, der seine Tochter kannte, konnte mit diesem Paket aus Zufassen und Zögern nichts anfangen, es bestärkte nur seine stillen Vorbehalte. Aber gleichzeitig drängte es sie auch weit in den Hintergrund. Offenbar lag ihm daran, gerade dieses Thema unter Dach und Fach zu bringen. Statt den Gedanken an eine abweichende Fragestellung auch nur zuzulassen, machte er es zur Conditio sine qua non ihrer Beziehung, immerhin so geschickt, dass Hiero die Nötigung stets bei sich selbst ortete. Dieses verfluchte Thema besaß zwei Seiten, eine dogmatische und eine ›hermeneutische‹. Die eine lief auf Gesinnung und Parteinahme hinaus, die andere auf die geschmeidige Vermeidung von beidem. Der Nachdruck, mit dem Tronka ihm die Arbeit aufnötigte, ließ die Theorie, um die es dabei ging, abwechselnd als den Fels aufscheinen, an dem abweichende Auffassungen notwendig zerschellten, oder als nützliches Material bei der Errichtung des eigenen, bislang nur in Umrissen sichtbaren Denkgebäudes. Was galt? In Minuten des Einverständnisses verschwand die Differenz spurlos – ein bleibendes, gleichwohl leicht aufzulösendes Rätsel angesichts der Tatsache, dass sie sich vor der Folie der kritisch nachprüfenden Überlegung, die jeden Satz, jede noch so leichte Bemerkung aus diesen Gesprächen um- und umwandte, bis sie in tieferen Zonen des Gedächtnisses versickerten, jedesmal deutlicher abzeichnete: ein Menetekel, das den Zweifel belebte und die ursprünglich vorhandene Unsicherheit erneuerte.
Wie weit Tronka mit dieser Zweideutigkeit spielte, war aus Hieros Stellung heraus nicht zu ergründen. Die Expedition, auf die ihn Tronka schickte, möglicherweise ohne sich allzuviel dabei zu denken, aber unter allerlei Vor- und Hintergedanken, mutete heikel, doch nicht hoffnungslos an. Nein, er hatte sich nicht an dem ebenso gering geschätzten wie gefürchteten Lambert abzuarbeiten, auch nicht am unvergleichlichen, aber anderweitig besetzten Spinoza. Beide Gegenstände hätten eine dogmatische Perspektive von vornherein ausgeschlossen. Tronka hatte ihm kein klassisches Thema aufgebürdet, sondern eines, das – strikt im Milieu systematischen Denkens – der Wiedergewinnung der Gegenwart aus einer verachteten und beiseite gestoßenen Vergangenheit galt.
Die Wiedergewinnung der Gegenwart: ein großes, leicht pathetisch anmutendes Genre, in dem sich unbehelligt nur arbeiten ließ, wenn man seine Motive sorgfältig nach außen verschleierte. Das erforderte einen eigenen Stil des Denkens und Schreibens. Hiero, dessen Draufgängertum es gern leichter gehabt hätte, verwandte viel Nachdenken auf diesen Punkt, doch kam es ihm so vor, als entziehe er sich beharrlich seinem Zugriff. Wie kann man denken, ohne zu denken? Wie kann man schreiben, ohne zu schreiben? Wie kann man denken und gleichzeitig einen Vorhang aus Nichtdenken um das Gedachte ziehen?
Vielleicht sollte er Mechtel zu Rate ziehen, die sich in einer besseren Position befand... Eher hätte er die Absicht fassen können, in ein Brennesselbüschel zu greifen, um ein wenig Natur zu fühlen. Außerdem hätte er ihr erklären müssen, worum es in seiner Arbeit wirklich ging, und das – nicht auszudenken! Selbst meine diesbezügliche Frage beschwor nur ein widerwilliges Brummen herauf und unter der Schicht aus aufgetragenem Gleichmut vibrierten alle Systeme. Nein, Tronka hatte ihm da keinen wirklichen Dienst erwiesen, falls doch, so erst in einer fernen, noch nicht absehbaren Zukunft. Hier und jetzt beeinträchtigte die offenkundig zu schwere Bürde den Gang der Dinge empfindlich.
Keein Zweifel: den beiden, Tronka ebenso wie Hiero, war es mit ihrer Aufgabe ernst. Mir, der ich anfangs nicht verstand, inwiefern die Gegenwart verloren sein sollte – denn das musste sie ja, wenn sie wiedergewonnen werden sollte – ging erst mit der Zeit die Tragweite der Motive auf, die in dieser Verschwörung in nuce zusammenkamen. Nach und nach ließ man mich in das unterirdische Aderwerk ein, in dem seit Jahrzehnten die Schürfarbeiten stockten, durch dessen Gänge aber immer noch Bergleute mit abgedunkelten Lampen patrouillierten, um Wasserstände zu kontrollieren und bei Einsturzgefahr die Deckenbalken zu erneuern. Manchmal stürzte ein Teil der Anlage einfach zusammen. Dann eilten Experten in Schutzanzügen herbei, stocherten in jedem ihnen zugänglichen Detail und veranstalteten anschließend Symposien, auf denen sie die entstandene Lage besprachen. Dass die Forschergemeinde ihr Anliegen aufgegeben hatte, bewies die Resonanz dieser Veranstaltungen aufs Pünktlichste. Hätten sie auf dem Sirius stattgefunden, die Ergebnisse hätten jenseits ihrer Zirkel nicht weniger Aufmerksamkeit erregt.
Nein, es war kein Staat zu machen mit den Sätzen, die bei solchen Gelegenheiten geäußert und anschließend, denn Geld floss immer irgendwoher, sorgfältig publiziert wurden. Zwischen den Papieren, die Hiero hin und wieder herausrückte, dämmerte mir, wie einst sich die Losung ›Noch ist Polen nicht verloren‹ zwischen den Zähnen exilierter polnischer Nationalisten ausgenommen haben musste. Die Sache selbst, da konnte ich Hiero recht geben, war auf befremdliche Weise ›unabgegolten‹. Wie – sinnigerweise ungefähr zur selben Zeit – unter den zwiespältigen Kommentaren einer hilflosen Öffentlichkeit die unbezahlbar gewordene ›heimische Kohle‹ von findigen Wirtschaftslenkern aus den Kreisläufen herausgezogen und als nationale Energiereserve unter Denkmalschutz gestellt wurde, so wurde hier ein Denken unter die Oberfläche der Betriebsamkeit verbannt – von wem auch immer. Nein, man konnte nicht behaupten, es sei verbraucht oder widerlegt oder auch nur vergangen gewesen in dem Sinn, in dem die mittelalterliche Scholastik vergangen war, selbst wenn sich da und dort auf dem Planeten noch ein paar Freaks fanden, die eine disputatio mit einem Kirchenvater jeder zeitgenössischen Auseinandersetzung vorzogen. Es war auch niemand da, der so etwas behauptet hätte. Wenn Hiero sich in Positur setzte und seine Attacken ritt, so blieb der Gegner ebenso unsichtbar wie jenes Ich, das er einst mit Fäusten traktiert hatte. Ob unsichtbar oder nicht vorhanden – unter den obwaltenden Umständen war die Differenz nicht zu ergründen und somit gleichgültig.
Es war einmal... so hätte seine Rede korrekterweise beginnen müssen. Es war einmal eine in den aktuellen Auseinandersetzungen verschwiegene und in den Geschichtswerken verächtlich gemachte philosophische Schule. Zu ihrer Zeit hatte sie als mächtig gegolten, sie hatte ›geherrscht‹. Das nimmt sich bereits seltsam aus, schließlich handelt es sich hier wie überall im Fach um Gedankenspiele, die immer auch anders ausfallen können. Um die Herrschaft einer Denkschule zu verstehen, ist es nötig, zwei Begriffe einzuführen, ohne die alles Weitere unbegreiflich bliebe – was es auch so bleibt –: den ›Einfluss‹ und die ›führenden Köpfe‹. Letztere, geborene Mittler zwischen denen, die einen Gedanken aus unerfindlichen Gründen ›in die Welt setzen‹ und denen, die aus nur zu begreiflichen Gründen ›nichts damit anfangen können‹, stehen in der Regel an der Spitze der Hierarchien, zumindest der Wahrnehmungsskalen. Sie sind tüchtige Arbeiter mit einem wachen Sinn fürs Vorankommen und ausgestattet mit jener Chuzpe, die einer benötigt, um sich im geeigneten Augenblick frei zu stellen, so dass aller Augen auf ihm ruhen und nicht auf dem Gesprächspartner von letzter Woche oder dem Stichwortgeber aus dem letzten Symposion. Die führenden Köpfe sind selten Originale. Sie ›stehen unter Einfluss‹ und ›machen ihn geltend‹, nicht ohne einen Sack voller praktischer Bedürfnisse an die von ihnen erkorene Theorie zu applizieren und sie dadurch alltags-, zumindest seminar- und forschungstauglich zu machen. Denn darin liegt ihre Stärke: sie wissen, was die Kundschaft braucht, um damit ›etwas anfangen‹ zu können.
Wenn ich den ›Einfluss‹ jener fast verschwundenen Schule auf das heranzog, was man die führenden Köpfe ihrer Zeit nennen mochte, dann füllte sich das Vakuum rasch und ich verstand recht genau, was Hiero meinte, wenn er von Geltung redete. Diese Philosophie war nicht mit Argumenten, sondern auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs zum Rückzug gezwungen worden. Jedenfalls scheint die ›Fronterfahrung‹, mit der eine neue Generation von Studenten in die Hörsäle drängte, nach anderer Kost verlangt zu haben. Die jungen oder nicht mehr so jungen Leute waren dem verordneten Massentod zu nahe gewesen, um in dem kunstvollen Gewebe aus hypothetischen Setzungen, die alles in allem dazu dienten, den ›sicheren Gang‹ der Wissenschaften als das einzige Gegebene herauszustellen und gegen die Zumutungen einer naiven Weltsicht zu verteidigen, den Geschmack der Wahrheit zu finden, nach der es sie verlangte. Das Wissen der Wissenschaften stellte vielleicht ein ›wirkliches‹, aber kein wahres Wissen dar, mit dem oder für das man leben und sterben konnte.
›Zufall oder Notwendigkeit?‹ Der Historiker musste hier passen, ebenso der Philosoph, dem die Fäden entglitten und der hilflos zusehen musste, wie sie von Neudenkern mit robusterer Konstitution, deren Geistesgaben vielleicht nicht über jeden Zweifel erhaben genannt werden konnten, auf andere Weise zusammengeknüpft wurden. Man tauschte Gedanken in Davos und trat sich öffentlich vors Schienbein. Man... tat so mancherlei, was sich im Nachhinein als ›fatal‹ erweisen sollte. So konnte schließlich ein Nachgeborener wie ich – wenn er sich kundig machte und nicht einfach den Sprachregelungen folgte – feststellen, dass die letzten Vertreter einer großen Schule gleichmütig außer Landes gejagt und dem dauerhaften Vergessen anheimgegeben worden waren. Selbst das wäre immerhin Schicksal gewesen, hätte man nicht zu Hieros großem Ärger Einzelne von ihnen – wundersam sind die Wege der historischen Ökonomie – posthum als herkunftslose Neudenker und ›bedeutende Vertreter‹ zeitgenössischer transatlantischer Strömungen reimportiert, nicht anders als der Markt für Filmsternchen und unverkäufliche Weinmarken es befahl. Der philosophische Weltmarkt florierte.
- ―Da hast du sie doch, deine Geltung.
- ―Wenn dir ein kastrierter Cassirer reicht, dann bist du auf der sicheren Seite.
- ―Besser ein kastrierter Cassirer als ein heckender Habermas.
- ―Da hast du auch wieder recht.
Einem wie Hiero konnte die Lage nur katastrophal erscheinen. Er wusste nichts oder wenig über das ostentative Wegsehen, seine Mechanik und seine Ziele. In gewisser Weise hatte er sich blind gemacht, als er es an einer sich rapide entfernenden Vergangenheit befestigte und darin nur dem Vorgehen vieler folgte. ›Weggesehen‹ zu haben war ihm und seinesgleichen zum Vorwurf gegen die ältere Bevölkerung geronnen und dadurch so ›unsäglich‹ geworden, dass sie sich weigerten, seine Allgegenwart auch nur entfernt ins Auge zu fassen. Dabei hätte die eigene Generation Anschauungsmaterial genug geboten, wenn sie mit den Konterfeis exotischer Massenmörder auf die Straße ging und nicht allzu intensiv nachfragte, aus welchen Geschäften die väterlichen Überweisungen stammten, aus denen man das Studium finanzierte und die man sich im Ernstfall zu Hause mit vorsichtig in der Tasche geballter Faust ›erkämpfte‹.
Unter die subtileren Formen des Wegsehens fiel die Konstruktion der Traditionen, zu denen man sich bekannte. So gehörte kraft eines moralischen Automatismus einer wie Hiero zu den Guten und war im Recht, wenn er auf Entdeckungsreise ging, um auf eigene Faust im Kampf gegen das in die Vergangenheit ausgelagerte Böse ein paar Meriten zu ernten. Man konnte zum Beispiel, ohne als besonders paradox zu gelten, die unbefriedigende Situation als einen Fall von fortwirkendem Antisemitismus auslegen – wissend, dass man sich damit mächtige Feinde schuf. Gelehrte jüdischer Herkunft hatten, neben anderen, jener untergegangenen Schule Glanz verliehen. Das traf zwar auch, wie es im Denken zu gehen pflegt, auf jene zu, die sie erbittert bekämpft hatten, aber immerhin ließ sich mit ausgestrecktem Finger darauf deuten. Tronka, der seine Haken mit Verve schlug, hatte den Verdacht in die Herzen der jungen Leute gesät, ohne sich seinerseits zu einer eindeutigen Formulierung zu verstehen.
- ―Nein, leider, ja wissen Sie, ich gehöre zum christlichen Zweig der Tronkas, konnte er am Telefon, wenn kein Dritter zuhörte, säuseln, Gott sei Dank, um es einmal so zu sagen, auch wenn Jahwe jetzt dabei zu kurz kommen sollte, aber an den haben die damals am wenigsten gedacht. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Nein, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen bei so ungeheuer subtilen Köpfen. Die waren so klar in ihren Prinzipien, dass sich die Heutigen davon eine gewaltige Scheibe abschneiden könnten. Wenn sie es nur könnten! Aber sie können es nicht, darin liegt die Crux. Womit wir wieder beim Anfang wären. Und der Anfang, das kennen Sie, ist in der Philosophie etwas Besonderes. Wissen Sie, das ist der Vorteil bei so einem Stammesgott: Er lässt die Anfänge frei. Sie können damit schalten und walten, er ist bei Ihnen – oder auch nicht –, aber er lässt Sie in Ruhe philosophieren, er mischt sich nicht ein. Ein großer Vorteil, wenn Sie mich fragen, ein großer Vorteil...
In Gedanken sah ich das Stirnrunzeln Kärichs vor mir, während ich über den Sinn der in weiter Ferne gesprochenen Worte grübelte. Obwohl... Dachte ich an Spinoza, dann schien mir die Differenz der Worte gering. Aber der Amsterdamer Optiker gehörte zum Kanon und Kärich, der die Doxa so sehr zu verachten vorgab, befand sich, rezeptionstechnisch gesehen, auf der sicheren Seite, wenn er – ein wenig exzessiv für meinen Geschmack – sich in seine Schriften versenkte. Dennoch ergriff mich an dieser Stelle der Verdacht, in Tronka und Kärich auf ein Paar ungleicher Zwillinge gestoßen zu sein, von denen der eine ungestüm und ohne jeden Widerhall ein Genie für sich reklamierte, das dem anderen kraft Geburt zustand, auch wenn es sich in seiner Entwicklung auf wundersame Weise gehemmt und verunstaltet sehen musste.
Wer war Esau, wer Jakob? Jeder hatte sich, jeweils auf seine Weise, aus dem ›jüdischen Rationalismus‹ einen Teil herausgeschnitten und balancierte ihn auf einem Tellerchen, das mich entfernt an Elisabeths Sèvres-Tässchen erinnerte, hoch über den Köpfen der Studenten, die im angestrengten Starren ihrer Dozenten den Widerschein einer auswärtigen Klarheit bewunderten, dem gegenüber sie selbst nur in einem Nebel aus Mutmaßungen und unausgegorenen Hypothesen stocherten. Wer also war Esau? Ein entfernter Verwandter in einem anderen Zweig der Familie?

Das wahre Leben
Wovon reden wir, wenn wir reden? Wovon schweigen wir, wenn wir reden? Analytikerfragen, die ihrerseits darüber schweigen, woher sie kommen, wie alle Fragen, wie alle Antworten. Der kleine Grund, mehr oder minder sorgfältig hergerichtet, auf dem die Philosophie ihre Gebäude errichtet, die häufig genug Schwimmbädern ähneln, in denen man die Masse der Besucher – sofern hier von Massen die Rede sein kann – stumm ihre Bahnen ziehen sieht, rhythmisch aus den Fluten auftauchend und wieder in ihnen versinkend, trägt nur zufällig diese Gedankenwelt. Man kann nicht einmal sagen, jemand habe ihn nach heute vergessenen Kriterien ausgewählt. Dazu blieb keine Zeit, keine Gelegenheit, keine Freiheit, keine Lücke: die berühmte Lücke. Erst sie erlaubt es, sich zu orientieren – jedenfalls dann, wenn es darum geht, den ganzen Horizont abzusuchen und sich nicht einfach dem Vorwärtsstampfen der Herde und dem Sicherungsstreben ihrer Treiber anzuvertrauen.
Reden wir also vom Schweigen, dieser menschlichen Grundtätigkeit, durch die so vieles Gestalt annimmt, was sich in Worten nicht erklären lässt. Jedenfalls nicht einfach. Hiero, der in Schweigen fällt, sobald ihm ein Gespräch zu ›persönlich‹ gerät, steht mit dieser Neigung nicht allein. Er gleicht darin, kurz gesagt, jenen urtümlichen Viehhütern, in denen die Sorge um die Herde jeden Gedanken, der mit ihr nicht innig verbunden ist, der von ihr nicht Geschmack und Farbe erhält, instinktiv als unnütz, ablenkend und gefährlich beiseite drängt. Sprechen wir also, denn darum geht es, von den Frauen. Allein ihre Anwesenheit splittert die eine große Sorge in wirkliche Sorgen auf, vor denen er auf der Hut sein muss. Sie lassen sich, aufs Ganze des Lebens gerechnet, nicht ganz vermeiden, vor allem, wenn einem, wie Hiero, der Ruf eines Stiers vorangeht. Immer wieder sieht er sich unvermutet zu Begattungstaten aufgerufen, auch wenn es ihm gerade nicht passt. Nicht dass er sich diesen Dingen gegenüber grundsätzlich ablehnend verhielte. Sie müssen nur geradeheraus geschehen, sonst besitzen sie keinen Reiz. Und das ist wenig gesagt: Da er seine Zeit nur einmal ausgeben kann, sieht er sich empfindlich, vielleicht sogar schmerzlich, jedenfalls trügerisch abgeschnitten von der Tätigkeit, die sein wahres Leben bedeutet, auch wenn er es aus sachlichen, das heißt theoretischen Gründen ablehnen würde, hier das Wort ›wahr‹ einzusetzen.
- ―Das wahre Leben? Was soll das sein? belehrte er Anton von oben herab, dem sein Religionsproblem an dieser Stelle Bauchschmerzen bescherte. Willst du mit einer Frau schlafen? Das kannst du natürlich machen. Du kannst es auch bleiben lassen, das wirst du doch hinkriegen. Wo ist dann das wahre Leben? Du kannst auch Schafe züchten – in Australien oder auf Borneo, wenn die da auch welche haben. Ich weiß nicht, was das wahre Leben ist. Ich weiß auch nicht, was das sein sollte. Ehrlich gesagt denke ich, wir müssen uns alle irgendwann entscheiden. Und das ist falsch, grundfalsch. Das wahre Leben wäre, wenn sich keiner entscheiden müsste. Aber wie soll das aussehen? Rein praktisch: Wie soll das aussehen? Das geht doch gar nicht.
Der letzte Satz hatte bei ihm eine Intonation, die ich sonst von niemandem kannte. Es klang, als poltere jemand eine Treppe herunter und setze dann mit einem weniger wuchtigen, aber umso erschreckenderen Geräusch auf dem Absatz auf. Ganz katholischer Dezisionist, hörte Eike Hieros flapsige Rede mit einem leichten Lächeln an, als handle es sich um das Stammeln eines Kindes, das zwar auf dem richtigen Weg ist, aber die Hauptsache noch nicht begriffen hat. Für ihn eröffnete die Entscheidung den Weg zum wahren Leben. Vielleicht drehte sich in den naiveren Schichten seines Bewusstseins an solchen Stellen eine Tür in den Angeln – leicht quietschend, sie hätte einmal wieder geölt werden müssen – und gab den Blick auf einen im Kerzenschimmer erstrahlenden Gabentisch frei, an dessen sinnreich verpackten Geschenken allenthalben Anhänger mit der Aufschrift ›Leben‹ hingen. Was Hiero anging, so entgrenzte das Wort ›wahr‹ seine ohnehin ozeanisch bestimmte Vorstellung vom Leben vollends und ließ sie in eine fade Halbwirklichkeit fallen, die er verachtete oder zu verachten vorgab.
Tronka in einer solchen Frage nach seiner Meinung zu fragen, verbot sich von selbst. Reden Sie doch, wie Sie wollen, pflegte zu antworten, sobald es sich um Sprachregelungen handelte, es klang wie ›Machen Sie doch, was Sie wollen, Sie werden schon sehen, was dabei herauskommt.‹
- ―Was wollen Sie denn damit sagen? Genügt Ihnen Ihr Leben nicht? Wollen Sie ein zweites dazu, das irgendwie bedeutender oder farbiger aussehen soll? Das können Sie natürlich haben. Kaufen Sie sich eine Karte für den Zirkus oder gehen Sie auf den Rummelplatz. Wenn Sie fein aussehen wollen, gehen Sie doch ins Theater. Auf der Bühne finden Sie sich wieder. Alles wahre Geschichten, ich verspreche es Ihnen, janein.
In Antons Augen war das sträfliches Gerede, er verachtete Tronka dafür. Er selbst kam, auch wenn er Kärich gegenüber den Abgeklärten gemimt hatte, über Kierkegaard nicht hinaus. Überhaupt war er der einzige aus dem Kreis, der Tronka die kalte Schulter zeigte. Er durfte das, jeder andere wäre damit durchgefallen. Mechtel, die in Tronka den Mann witterte, an den eine Frau ihre Zeit nur vergeudete, konnte sich ihre Kühle nur deshalb erlauben, weil der Schild, auf dem die ›Herren‹ sie trugen, verhinderte, dass ihre Füße überhaupt den Boden berührten, auf dem die eher männlich geführten Auseinandersetzungen um die wahre Lehre stattfanden. Tronka wäre nicht gut beraten gewesen, sich abfällig über sie zu äußern.
Doch in diesem Punkt bestand keine Gefahr. Seine unbestimmt schwelgerische Weise, auf jedes weibliche Wesen zuzugehen, verband sich zwanglos mit instinktiver Hochachtung vor einer Person, die sich gegen die Lockungen seiner Lehre und seiner berückenden Persönlichkeit als immun erwies. Eike, der, nachdem Hiero davongezogen war, die Suche nach einem Doktorvater unauffällig intensivierte, bemerkte als erster Tronkas Buhlen und reagierte mit Bitterkeit. In ihm nagte die Eifersucht dessen, der nicht in Betracht kam, obwohl er sich hätte sagen müssen, dass darin eine Aufforderung lag, sich ›in Freiheit‹ anders zu entscheiden. Aber seltsam, mit dieser Freiheit schien es in der Praxis nicht weit her zu sein. In meinen Augen machte er einen eher kläglichen Gebrauch von ihr. Neuerdings verpulverte er seine Zeit, indem er mit Tronka – demselben Tronka, der Hiero gegenüber den etwas angestrengten Jungprofessor herauskehrte – bei jeder sich bietenden Gelegenheit ›auf Schalke‹ ging. Das ließ die gemeinsamen Fußballabende im Hinterzimmer des Pfau deutlich hinter sich, von denen mir alle berichtet hatten und die mir bereits kaum glaubhaft erschienen.

Hiero holt sich Mut, Pw einen Korb
Auch Hieros Gewohnheiten wandelten sich. Man sah ihn jetzt öfter allein am Tresen des Pfau sitzen, wo an Lexas Seite eine Aushilfsschöne das Bier zapfte. Arglos hatte ich mich mehrmals dazugesellt. Es war zwecklos. Er erinnerte mich an ein aufgescheuchtes Wild ohne Sinn für die Umgebungen, die es in panischem Schrecken durchjagt. So sehr war er innerlich unterwegs, dass er mich mehrmals einfach vergaß, während ich noch auf ihn einredete. Die Cordjacke, die ihn sommers wie winters gegen die gerade herrschende Witterung schützte, baumelte zu beiden Seiten seines abgemagerten Körpers, als suche sie verstohlen, aber hartnäckig noch immer den anderen, volleren Leib, den sie bis vor kurzem eingehüllt hatte. So schnöde im Stich gelassen, roch sie nach einer autochthonen Vergangenheit, über die man gern mehr erfahren hätte. Sicher waren bittere Stunden darin verzeichnet.
Der Anblick des Bewohners, mit dem sie in dieser historischen Stunde vorlieb nehmen musste, erinnerte ein bisschen an Aufenthalte in der Wildnis, von denen man sich im städtischen Alltag nur ein ungefähres, durch mediale Auskünfte erzeugtes und verwirrtes Bild macht. Irgendwann kehrt die Wildnis über die Spuren eines dauerhaften und vielfältigen Gebrauchs in die von Menschen produzierten Dinge zurück. Dann beginnen sie den Tastsinn zu interessieren. Auch bekommen sie, was man bis dahin niemals vermutet hätte, Geruch und Geschmack des Lebens. Leicht eingesunken saß Hiero auf dem hohen Stühlchen, dessen totlackierte Spinnenbeine für jemanden, der hinsah, die Wahrheit über seinen noch vor kurzem so drahtig wirkenden Körper verkündeten. Man konnte ihn für einen unauffälligen Herumstreicher halten, einen von denen, die erst am Anfang ihrer Laufbahn stehen und von den Blicken der Mitmenschen noch nicht aussortiert, aber doch bereits prüfend umfasst werden. Sein jugendlich verwittertes Gesicht sprach von Wind und Weite, aber nicht länger von Aufbruch. Die Selbstherrlichkeit hatte diesen Körper verlassen, sie hatte es sich, angesichts eingetretener Komplikationen, vielleicht anders überlegt und war in ein paar zufällig anwesende Säue gefahren, ohne dass es darüber zu einem sonderlichen Eklat gekommen wäre.
Übrigens sah man, sofern man sich von dem selbstversunkenen Anblick nicht täuschen ließ: er war nicht allein. Das lag weniger an ihm als an der neuen Aushilfsbedienung, deren Kommen und Gehen, deren Blicke und Hantierung einen ungewohnten Raum um ihn schufen. Man konnte ihn den symbolischen Bezirken zivilisationsferner Urwaldbewohner vergleichen, in denen ein wie zufällig geknickter Zweig, ein paar Steine oder ein hohler Baum genügen, um jedem, den es angeht, zu signalisieren, dass, wer hier weiter vordringt, sein Leben riskiert oder seine Gesundheit, auf alle Fälle sein weiteres Wohlergehen vor Menschen und Göttern.
Gelegentlich sprach Hiero ein paar Worte:
- ―Ein Pils bitte! – Noch eins!
Er sprach sie nicht bedeutungsschwer, sondern beiläufig, voller Zuversicht, dass dem darin zum Ausdruck gebrachten Wunsch entsprochen werde, arglos fast und ohne weiter darüber nachzudenken. Und sie vernahm die Worte, sie flogen ihr zu, ohne dass sich ihre Bewegung darüber verlangsamte; es entstand nur eine kleine Pause in ihrem Wesen, so als habe sich ein Komma im Satz unversehens, ohne Angabe von Gründen, in ein Semikolon verwandelt. Der magische Baum hatte gesprochen, man durfte nicht allzu viel darauf geben, weil man sonst vielleicht Unheil heraufbeschwor. In diesem Punkt war man seit alters gewitzt, auch wenn die eigene Dienstzeit dafür kaum einen Anhaltspunkt lieferte. In einem anderen Leben hätte sie auf der Stelle innegehalten und den Spruch bebend in Empfang genommen, in diesem hier war es undenkbar, man musste ihn im Fluge auffassen, ohne sich von ihm beirren zu lassen. So kam es, dass sich vor Hiero kurz darauf ein frisch gefülltes Glas auftat, ohne dass der Schankbetrieb eine sichtbare Unterbrechung erlitten hätte. Auch litt er nicht an Erscheinungen, weder inneren noch äußeren, sondern beschränkte sein Tun darauf, minutiös, Tropfen für Tropfen, das volle Glas wie seine Vorgänger sukzessive in ein leeres zu verwandeln.
Wer den Baum sprechen wollte – eine seltsame Verzeichnung der Verhältnisse, denn offenbar wollte ihn kaum jemand sprechen, alle drängten zu einem Gott, der sich vor jedem Zugriff verbarg –, der musste vorher eine beträchtliche Strecke Weges zurückgelegt haben, er musste die rituellen Bewegungen vollführt und einen kleinen Obolus auf der blitzblanken Fläche vor ihm niedergelegt haben. Auch dann sprach niemand mit dem Baum, wie man mit einem Menschen spricht. Manche drängte es förmlich zur Rede, aber nach einigen Silben wurde ihnen das Unsinnige ihres Gebarens deutlich und sie pressten ihre Hände auf die vorgeschriebenen Flächen, tranken von den Flüssigkeiten, die man vor sie hinstellte, und verschwanden wieder in der Dunkelheit oder wandten sich anderen Gästen zu. Dann und wann bewegte auch der Baum sein verwittertes Haupt, als habe er doch einmal bekommen, wonach ihn verlangte – ein Vorgang von großer Intensität, über den sie gern mehr gewusst hätte.
Hätte jemand Hiero an einem anderen Ort, etwa in der Mensa, gefragt, wer Miriam sei, dann hätte er mit einem Schmunzeln geantwortet:
- ―Miriam? Das ist doch die Kleine am Ausschank im Pfau. Wie kommst du darauf?
Die Gegenfrage verlangte nach keiner Antwort.
Wirklich fragte so, wer sonst, Pw – nicht ohne Tücke, denn er hatte bereits ein Auge auf die zierliche Schwarzhaarige geworfen und sich, entgegen seiner üblichen Vorsicht, eine Abfuhr geholt, obschon er aus Gründen, die sich seiner bekannt starken Mutterbindung verdankten und von klaren Hollywood-Präferenzen genährt wurden, lieber hochgewachsenen Blondinen den Hof machte. Aber wenn es darum ging, die eine oder andere Nacht abzurunden, konnte er offenbar auch weniger pingelig werden. So jedenfalls scholl oder quoll es ihm, leicht ätzend, aus dem Munde Hieros entgegen, den eine verhängnisvolle Beredsamkeit vorwärts trieb. Pw wunderte sich darüber im Stillen, wenngleich nicht zu sehr. Er wusste sich frei von Eifersucht. Den Versuch gedachte er nicht zu wiederholen. Er hätte, auch vor sich selbst, den Gedanken nicht zugelassen, dass ihm da etwas missraten war. Ein Pw bekam keinen Korb. In seinem Universum, das demjenigen Hieros ähnelte, aber in entscheidenden Punkten eher gegenläufige Züge aufwies, besetzte der weibliche Bevölkerungsanteil die Ecke ›Vertrauliches‹. Ein zum Sarkasmus neigender Beobachter konnte meinen, es gehe dort zu wie auf einem ins Perverse entglittenen Postamt, auf dem einfache, in ihrem sonstigen Leben nicht weiter auffällige Angestellte routinemäßig alle eingehenden Briefe erbrechen, bevor sie sie weitergeben.
Gleichgültig, worum es ging, Pw war ›im Bilde‹, auf eine ruhige, teilnehmende, fast unauffällig zu nennende Weise, die hier verstärkte, dort vorausschauend dämpfte, ins Bedeutsame hob, was gerade noch flache Information zu sein vorgab, und wider besseres Wissen Besserwissen produzierte, wo es gefragt zu sein schien.
- ―Ich treffe keine Frauen,
informierte er zu vertraulicher Stunde Anton, der hier ein
Lebensproblem herumtrug und entgeistert zurückfragte: Und wie
kommst du dann an sie heran?
Pws Ehrgeiz – oder Manier – bestand darin, schon in sie eingedrungen und ein Stückweit mit ihnen verschmolzen zu sein, bevor sie ihn bemerkten. Sein viriles Gebaren entfaltete sich gewissermaßen bereits im Schoß der zu schließenden Bekanntschaft. Wie er das machte, blieb den anderen ein Rätsel – ein Buch mit sieben Siegeln, entfuhr es Anton, der den anderen über jenes Gespräch prompt Bericht erstattete. Sah man Pw unbeobachtet auf der Straße herumlaufen, konnte man sich fragen, ob diese fast belanglose Person identisch war mit der, die ihre Umgebung problem- und bedenkenlos in ihren menschlichen Regungen manipulierte.

An Tronkas Hof
Zu seinen männlichen Opfern gehörte Luxor, der hier und da hereinschneite und durch seine schiere Existenz daran erinnerte, dass Pw noch andere innerstädtische Zonen frequentierte. Hiero, der sich durch irgendetwas zu ihm hingezogen fühlte, reagierte ausgesprochen unwirsch, als ich ihn auf diese auffällige, aber im Kreis nicht wirklich vorhandene Erscheinung ansprach.
- ―Da musst du schon Pw fragen. Das ist ja hündisch. Ich weiß nicht, was die beiden verbindet, der hat ja gar keine eigene Meinung. Versteh mich nicht falsch, ich will damit nichts unterstellen. Ich weiß nicht, was die miteinander haben. Ob sie überhaupt etwas miteinander haben. Ich würde mal sagen, Pw hat damit gar nichts zu tun. Schau dir diesen Luxor doch an: abhängig bis über beide Ohren. Was soll denn das.
Angesichts eines Pw, der sich belustigt gab, war das wirklich nicht auszumachen. Warum auch? Das Muttersöhnchen, das in Pw steckte, mochte seine Gründe haben, sich dieses Opfer auf Vorrat zu halten, wenn es denn eines war und nicht bloß eine Sauna-Bekanntschaft, die hin und wieder die Bahnen des Kreises kreuzte, einfach weil sich ihrer aller Leben innerhalb weniger Straßenzüge abspielte und so die Frequenz der Zufallsbegegnungen in eine Höhe trieb, die Bedeutung suggerierte, wo keine vorhanden war.
Mir erschien Luxors Verhalten ohnehin nicht so auffällig. Wenn es darum ging, sich Pws Aufmerksamkeit zu vergewissern, war bei allen kein Halten. Aus jedem Gespräch heraus, mochte es noch so ernsthaft geführt sein, konnte es einem geschehen, dass sich die Aufmerksamkeit des anderen gleichsam verkrümelte und willfährig Anschluss an ein Stirnrunzeln oder ein Heben der Augenbrauen oder ein ordinäres Räuspern von seiner Seite suchte.
Auch Tronka war davon nicht frei. Manchmal konnte es scheinen, er sei die Quelle dieser ein wenig prekären Abhängigkeit, da er sie mit dem ganzen Gewicht seiner Autorität praktizierte und wenig Zweifel daran aufkommen ließ, wo sich der Brennpunkt des Geschehens befand, wenn man wie eh und je nach dem Seminar im Nebenzimmer des Pfau zusammensaß. Denn das war das Erstaunliche: Tronka dachte nicht im Traum daran, sein akademisches Dasein in jener geheimnisumwitterten Pyramide aufgehen zu lassen, in deren Bibliothek Hiero Woche für Woche das Schnurren der Förderbänder behorchte, um sich im rechten Moment zu erheben und die entliehenen Bücherstapel ins Zimmer des meist abwesenden Professors zu transportieren. Nach wie vor hielt Tronka Seminar in dem weiß gestrichenen, bei geöffneten Fenstern immer ein wenig ungelüftet wirkenden Raum, der ihm kraft Herkommen unverbrüchlich zuzustehen schien. Und nach wie vor lenkte die Gruppe anschließend ihre Schritte einträchtig dem grün-weiß im Abendhimmel schimmernden Schild zu, auf dem Wort und Bild in so einträchtiger Weise zusammenfanden, dass kein Zweifel aufkommen konnte, welchem Ort man sich näherte. Nur das Tempo war gemächlicher geworden. Tronka zog es neuerdings vor, bestimmte Vier-Augen-Gespräche im Schutz der Straße zu Ende zu bringen, bevor er sich den Freuden des geselligen Zusammenseins ergab. Er konnte geradezu zynisch abweisend werden, sobald ein Dritter, wie unschuldig auch immer, sich einzumischen versuchte. Auch der Letzte musste begreifen: hier ging es um gewichtige Dinge. Welche das waren, schien auch den Gesprächspartnern nicht immer klar zu sein oder sie hegten Hintergedanken dabei, die sie nicht preisgaben.
Ich greife einen Abend heraus – natürlich ihn, denn einerseits verliefen alle nach ein und demselben Muster, andererseits ist gerade er etwas Besonderes, da er wie nebenbei Eikes Geheimnis enthüllte. Wenn Luxor mit am Tisch saß, dann, um es ein wenig gespreizt zu sagen, ›in der Weise eines Fremdkörpers‹, als einer, der ›im Grunde‹ nicht dazugehörte, aber aus Ursachen, die im Dunkeln lagen, das Recht reklamierte, dabei zu sein. Tronka hatte ihn kurz gemustert und vermied es dann in seine Richtung zu blicken. Luxor schien das zu akzeptieren. Hiero, sichtlich verärgert über seine Anwesenheit, trommelte schubweise mit den Fingern auf die Tischplatte. Die Anwesenheit eines praktisch Fremden veränderte die Kulisse. Luxor, den zwar alle artig der Reihe nach ansprachen, mit dem aber niemand sich unterhielt, blieb nur ein Ausweg: er musste reden. So kam es, dass sie alle nach und nach unter den Bann seiner Stimme gerieten. Verwunderlich war das nicht, denn sie vibrierte in allen möglichen Tonlagen, die von der normalen Gesprächsstimme in der Regel nicht benützt werden. In seinem Fall beanspruchten sie eine Art Naturrecht auf Mitbestimmung, das ihnen ohne weiteres eingeräumt wurde.
Selbsstredend galt das nur für die Dauer des Auftritts, der ihm, aufs Ganze gesehen, wenig nützte. Die anderen nahmen ihn hin, so wie sie die Gesangseinlage eines zufällig anwesenden Künstlers hingenommen hätten, von dem man annehmen durfte, dass er sich anschließend knapp verbeugte und an seinen Platz am Nebentisch zurückkehrte. Denkbar wäre zum Beispiel gewesen, im Gegenzug den von Tisch zu Tisch streifenden Blumenverkäufer kommen zu lassen. Zu solchen Aufgaben verstand sich gerade Pw, der sich hier angesprochen fühlen musste, mit Leichtigkeit. Er war es, der gewöhnlich den Kopf oben behielt, sobald im Kreis etwas Täppisches zum Vorschein kommen drohte. Mit leichter Hand, wie man es von einer Frau erwartet hätte, tat er in solchen Fällen das Erforderliche oder etwas, das der Situation einen geselligen Anstrich verlieh. Er tat es mit einem winzigen Nachdruck, der gleichsam in den Augen schmerzte und den anderen vor Augen führte, dass er sie im Grunde für Tölpel hielt.
Wenn Tronka Hof hielt, dann nach dem Muster jener ungeselligen Geselligkeit, die sich seine Landsleute gern selbst nachsagen, am Schreibtisch vor allem oder in geselliger Runde, wenn das Bier ›in Strömen fließt‹ und sich alle einig sind. So konnte es geschehen, dass Pw, in philosophischer Rede ein Leichtgewicht, ganz allein das andere Ende der Waage besetzt hielt und als einziger unter den Anwesenden Tronka ebenbürtig entgegentrat. Mag sein, dass es Zeiten gegeben hatte, in denen das Tronka ganz und gar nicht schmeckte. Ganz gewiss hatte es solche Zeiten gegeben. Doch ebenso gewiss waren sie vergangen. Es war blanke Sucht, die Tronka dazu trieb, den philosophischen Zwerg zum Adressaten einer allwöchentlich erneuerten Kampagne zu machen, in deren Verlauf er zur festgesetzten Stunde zu funkeln begann und nach und nach die verborgenen Schönheiten seiner Theorie und seiner Überzeugungen im Allgemeinen hervorkramte. Der Alkohol spielte bei dem Vorgang eine nicht zu übersehende Rolle. Pw, dem das Wörtchen ›Selbstbeherrschung‹ auf den noch hageren, aber bereits die Formensprache des kommenden nordischen Quaders vorwegnehmenden Leib geschrieben stand, gab auch in diesem Fall den Versucher. Nahmen sich seine Einwürfe anfangs, im Zustand allgemeiner Nüchternheit, eher dilettantisch aus, so wuchsen sie bei fortschreitendem Konsum angesichts der jedesmal schäumender vorgetragenen und in der Sache immer kläglicheren Auslassungen des genialen Dozenten in fürchterliche Dimensionen hinein.
Ein angesäuselter Apoll im Kreise der stets heiteren Musen – das war der Anblick, den Tronka, sich in logischer Nacktheit tummelnd, bot, nachdem ihm die Felle davongeschwommen waren. Doch Trinkfestigkeit hin, Trinkfestigkeit her – in der gegebenen Situation sah Pw, der Urheber dieser wiederkehrenden Denudation, seine sozialen Qualitäten an die Kette gelegt. Luxor forderte unumschränkte Aufmerksamkeit, sei es auf das, was er sagte, sei es auf das, was fragezeichengroß im Raum stand, solange ihn niemand stoppte. Als braver Hüter der Gemeinschaft musste Pw der Gefahr entgegentreten, die von diesem Nebenmittelpunkt ausging, der sich zum Hauptmittelpunkt auszuwachsen drohte. Luxor, jedenfalls der Luxor, der sich den erstaunt-gelangweilten Blicken des Kreises darbot, war sein Werk. Insofern galt das Fragezeichen Pw. Dabei war niemand ernsthaft erstaunt oder gelangweilt, im Gegenteil: da man nicht wusste, wie weit Luxor sich treiben ließ, hörten alle mit klammheimlicher Neugier zu. Peinlich berührt waren sie trotzdem. Was Luxor trieb, ziemte sich nicht – nicht an diesem Ort, nicht in ihrer Runde.
Dieser, wie es aussah, bereits in andere gesellschaftliche Regionen abgedriftete Student gehörte zu einer Kategorie von Leuten, die ihren Mitmenschen mit einem einfachen, aber heiklen Mittel die Lachtränen in die Augen treiben. Er gab sich preis, jedenfalls ein Stück von sich, nicht zuviel, aber doch genug, um an die nebulöse Scheidewand zu rühren, die Menschen in Gesellschaft voneinander trennt. Die Geschichten, die er zum besten gab, waren belanglos – ›Geschichtchen‹ im Wortsinn, die niemanden ernsthaft interessierten, die sich auch keiner merken konnte. Sie gingen auch niemanden etwas an. Genau darin lag ihre Pointe. Mit jeder von ihnen plauderte er etwas aus, er ›gab es zum Besten‹ – ein eigenartiges Wort, mittels dessen die Sprache bekräftigt, dass zum Gelingen des Festes ein Opfer benötigt wird: die dem ›allgemeinen Besten‹ zugute kommende Gabe, die notwendig aus dem Vorrat der Individualgüter abgezweigt werden muss.
Luxor, soviel war sichtbar, gab sich zum Besten. Damit verwandelte er die Zusammenkunft, in deren Mittelpunkt er sich stellte, in ein Fest. Die Anwesenden, Tronka und vielleicht Pw ausgenommen, empfanden es nicht nur so, sondern arbeiteten nach Kräften daran mit, falls in einem solchen Fall von magischer Quadratur der Ausdruck ›Arbeit‹ am Platz ist.
Auf seine Weise beteiligte sich auch der trommelnde Hiero an dem Werk. Jedenfalls litt er stellvertretend für den zeitweise kaltgestellten Hauptdarsteller, nicht unähnlich den bleichen Gestalten, die den Golgathazug begleiten und dem Pulk der Johler und Gaffer bereitwillig Platz machen, aber unauffällig immer wieder die Nähe des Menschensohnes suchen. Nur Luxor merkte offenbar nichts. Er schien sich auch nicht zu verausgaben. Je mehr die Umgebung in seinen Bann geriet, desto feiner, leichter, unwirklicher wurden seine Gebärden. Es war, als hocke in diesem Puppenspieler, der selber nur eine Puppe war, ein kleiner Junge, der mit magischer Sicherheit die Knöpfe eines Flipperautomaten bedient und mit geschickten Fingern dafür sorgt, dass die Kugel so lange wie möglich im Spiel blieb. Anders als der Zwerg in Mälzels Schachautomaten bedurfte er keines Verstandes, der sich vielleicht nur störend ausgewirkt hätte. Ihm genügten gute Reflexe und die seinigen waren ausgezeichnet. Dennoch ließ sich absehen, dass irgendwann die Kugel in einem der zahlreichen Löcher, an denen sie im Moment so elegant vorbeigeleitet wurde, auf Nimmerwiedersehen verschwinden würde. Auf diesen Zeitpunkt wartete Tronka mit der ledernen Geduld des ewigen Zweiten. Auch er war begierig, die Knöpfe zu drücken. Doch ahnte er wohl verschwommen, dass in seinem Fall ein anderer an ihnen hantierte. Im Grunde war es ihm recht.
Hätte ich Tronka nicht bei Elisabeth kennen gelernt, so hätte ich vielleicht, ähnlich dem Germanisten Z., der möglicherweise in einem New Yorker Hotelzimmer Zeuge von Hölzchens Familienleben geworden war, aus den Gesprächen seiner Jünger eine ›grundlegend‹ andere Auffassung seiner Person erworben, die mir auf der Grundlage unseres sporadischen Zusammentreffens unerreichbar blieb. Die Studenten sehen in einem Assistenten ja nicht den jungen Mitarbeiter, den ein Zufall am Ende seines Studiums an diesen Platz geschleudert hat und der jetzt vollauf damit beschäftigt ist, aus diesem unwahrscheinlichen Faktum ein Leben – eine vita nova – abzuleiten. Alle Wörter, welche dieses Verhältnis bezeichnen und im Berufsleben eine nüchterne, Dauer, Aufgaben, Gehalt und Aufstiegschancen regelnde Bedeutung besitzen, verwandeln sich den klügeren, ehrgeizigeren, phantasievolleren Erwählten in Anzeigen einer mit magischen Zügen ausgestatteten Welt. Es ist diese zweifellos stattgefundene Erwählung, die hier die Beziehungen stiftet und reguliert und ihnen eine unalltägliche Dichte und Undurchdringlichkeit verleiht. Solche Phantasien müssen bedient werden. Wer seine Assistentenzeit als Orientierungsphase versteht und schon einmal ›Berufsleben‹ schnuppert, ist bereits durchgefallen – er kommt für die zentrale Erfahrung nicht in Betracht. Die Nase vorn haben Typen wie Tronka, die die Möglichkeit zur selbstgewählten Deformation wittern und keinen Tag zögern, sie zu ergreifen. Im Mittelpunkt der von ihnen erschlossenen Welt steht die Zukunft als Raum künftiger Erwählungen. Aus der Latenz gegenwärtiger Anhänglichkeiten und Treuebekundungen taucht irgendwann das unvermutete Ego hervor. Tronka, der es sich erlaubt hatte, diese Spannung in seinem Kreis über Jahre aufs Äußerste zu steigern, hatte schließlich gewählt und seine Wahl war auf Hiero gefallen. So sahen es alle. Doch was herausgekommen war, blieb diffus und enttäuschend. Das bekam Tronka jetzt zu spüren.
Unbeteiligt an diesem Spiel, wie ich mich wusste, fühlte ich mich unbehelligt von den emotionalen Unterströmen, die hier zu gewärtigen waren. Stattdessen beäugte ich gemäß dem Bild, dessen Bedeutung mir auf der Insel aufgegangen war, die Welle, die Tronka emporgehoben hatte und jetzt inmitten einer wässrigen Wüste ohne besondere Vorkommnisse zum chancenlosen Schwimmer degradierte, vom festen Land aus, ohne die Erregungen mitzuempfinden, die nur die gemeinsame Bewegung verschafft.
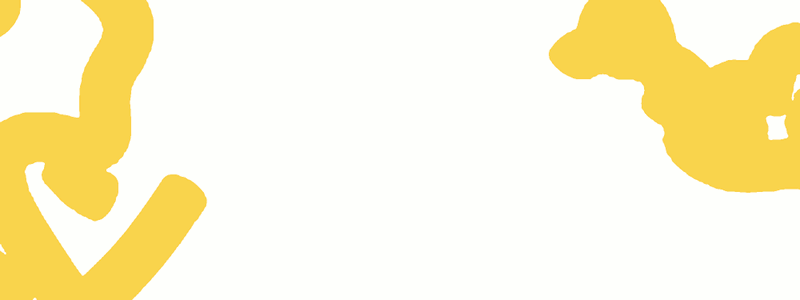
Weberknechte
Luxor... Wer hat diesen Namen überhaupt aufgebracht? Wann, bei welcher Gelegenheit ist das geschehen? Hiero in der Wanne, der ernüchternden Wirkung des langsam erkaltenden Badewassers ausgesetzt, stochert lustlos in der Vergangenheit, die dem gestandenen Philosophen mehr Schwierigkeiten bereitet, als er in seinem beruflichen Alltag zuzugeben bereit ist.
- ―Nichts ist vorbei, pflegte Kärich gelegentlich seinen entsetzten Studenten einzutrichtern, nichts ist un-ab-ge-golten. Wenn Sie meinen, Sie kommen aus dieser Chose raus, als seien Sie nicht in sie involviert, dann täuschen Sie sich. In-vol-viert – behalten Sie dieses Wort, es wird sie Ihr Leben lang begleiten. Zu Recht! Nennen Sie es den kulturellen Dreh, dann liegen Sie nicht falsch, aber auch nicht richtig. Kultur ist nichts. Das hier oben – er unterstrich mimisch – ist nicht Kultur, es ist Denken. Nennen Sie es Bewusstsein, das ist schön, es zeigt, dass irgendwie auch Wissen im Spiel ist, aber es ist Denken. Die Leute mögen das nicht, sie wollen sein, das kann man verstehen, das ist die Crux. Verstehe es, wer will. Legen Sie den Schalter doch um – langsam, mäßig! Versuchen Sie, ihn umzulegen... nein, nicht hier, seien Sie doch nicht so konkret. Schon dieser Gedanke ist nicht ›raumzeitlich verortet‹. Er ist derselbe in ihnen und in mir, im Prinzip wissen Sie genauso wie ich, an welcher Stelle im Koordinatensystem des Gedachten er steht. Sie können nach China reisen oder nach Pakistan oder einfach hintelefonieren: daran ändert sich gar nichts. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise!
Nach solchen Ausfällen hatten ein paar Studentinnen viele Fragen, sie bogen ihre Körper und wanden ihre Hände, um zu zeigen, dass bei ihnen Körperbewegung und Denken eins waren und Kärich nickte ihnen aufmunternd zu, versuchte, ›es‹ ein ums andere Mal ›anders‹ zu sagen, mit Beispielen und ohne, mit Ironie und ohne, es war ein webendes Geben und Nehmen, das sich da zwischen den Stuhlreihen abspielte und manchmal erst durch das Auftauchen von Teilnehmern der nächsten Veranstaltung unterbrochen wurde.
Das reflexartige ›Was solls? Es ist vorbei!‹, mit dem sich Leute aus der Affäre ziehen, die sich gerade noch die Köpfe darüber heiß geredet haben, ob Rudi Dutschke seinerzeit die wahre deutsche Linke oder nur einen Haufen studentischer Schreihälse anführte, ob die Romantik die deutsche Todessehnsucht oder einen historischen ›Modernisierungsschub‹ auf den Punkt brachte, ob es besser gewesen wäre, Wittgenstein zu ignorieren, statt ihn nach Oxford zu holen und mit dem Ruhm eines Querdenkers auszustatten, auf den sich heute jeder beziehen muss, der mitreden will – diese Formel von Kneipendiskutierern, die sich unvermittelt mit der Sperrstunde konfrontiert sehen, hat in der Politik und im philosophischen Denken viel Unheil angerichtet. Dennoch besitzt sie, aufs private Leben bezogen, einen guten Sinn.
Luxor ist vorbei – die Wahrscheinlichkeit, ihm eines Tages auf der Straße zu begegnen, liegt bei Null. Hiero weiß nicht, ob er das bedauern soll, dazu ist die Erinnerung zu verwischt. Es liegt etwas Unabgegoltenes in ihr, eine Erwartung, die vergangen ist, ohne aus sich herauszutreten – eigentlich eher keine Erwartung, ein Versteckspiel zwischen zwei Instanzen, die einander begegnet sind, ohne sich zu berühren, fast wie in dem Nestroy-Zitat, das Pw eine Zeitlang herumreichte: Ich möcht’ mich einmal mit mir selbst zusammenhetzen, nur um zu sehen, wer der Stärkere is, ich oder ich. Luxor hat sich als der Stärkere erwiesen, daran besteht kein Zweifel, er ist, Hieros magnetischen Blick im Rücken, verschwunden, ohne sich umzudrehen, die Hatz war abgeblasen, bevor sie beginnen konnte.
Tronka ist anders. Die junge Frau in der Bar hatte etwas davon abbekommen. ›Machen Sie sich keine Arbeit...‹ Das war ein Hetero-Witz der dümmlichsten Sorte, aber er wirkte nach. Hiero schluckt, wenn er daran denkt. Tronka, der keine Pointe vorbringen kann, ohne seiner Zufriedenheit mit sich selbst unmissverständlich Ausdruck zu geben, hatte den Effekt absolut souverän, mit großer Beiläufigkeit herausgearbeitet und kein zuckender Gesichtsmuskel, kein Schulterrollen verriet, was er dabei dachte. Unversehens fand sich Hiero auf der anderen Seite einer Demarkationslinie, die seine trotzige Männlichkeit bis dahin nicht einmal gestreift hatte. Wer schwul war oder nicht, das wusste man oder es ging einen nichts an. Sollte es ihn etwas angehen, wenn Tronka sie beide ab jetzt in der Öffentlichkeit – einer mickrigen Öffentlichkeit, aber immerhin – als Pärchen präsentierte, wann immer es ihm beliebte? Sollte es ihn etwa nichts angehen?
Wo endet der Scherz, wo beginnt das soziale Spiel, noch dazu eines, dem er sich auf keine Weise gewachsen fühlt? Er wusste es damals nicht, er weiß es noch heute nicht.
Von Tronka gibt es keine magnetischen Blicke. Aber an seinem magnetischen Wesen zu zweifeln ergibt keinen Sinn. Es äußert sich in der gewissermaßen hoheitlichen Art, die dafür verantwortlich ist, dass Hiero ihn von Anfang an ernst genommen hat, ernster als die anderen Dozenten, bei denen er das Gefühl nicht loswerden konnte, dass sie ihn als einen durch Stellung und Funktion erzeugten Adressaten für ihre mehr oder weniger mechanisch hervorgebrachten Belehrungen betrachteten. Nichts an Tronka ist mechanisch. Sogar die Art, seine Tasche zu packen, bevor er den Heimweg antritt, verrät einen menschlichen Sinn und nicht bloß die Überzeugung, für heute genug gearbeitet zu haben. Die Aktschlüsse, die er zelebriert, geben seiner schauspielerisch völlig unbrauchbaren Person Gelegenheit, sich im Zuschauer, pardon, im Mitspieler einzunisten. Tronka erreicht durch Abwesenheit, was die Gegenwart ihm versagt. Für den Adressaten hat das den Nachteil des Unverhofften: ehe er sich dessen versieht, hat ihm der andere ein Paket in die Hand gedrückt und ihn damit entlassen.
Hiero weiß, was das heißt. Er weiß zur Genüge, wie man sich fühlt, wenn man stundenlang durch den Regen streicht und sich vergeblich fragt, was in dem Paket wohl enthalten sein mag und was, um Himmels willen, man damit anfangen soll. Selbst das ginge noch hin ohne den perfiden, durch Anhänglichkeit erzeugten Verdacht, in ihm endlich die ersehnte Handreichung fürs akademische Überleben erhalten zu haben. Leider zerfasert und zerfällt es nach und nach, ohne sein Inneres preiszugeben. So bleibt die Frage ›Was tun?‹ nicht nur unbeantwortet wie zuvor, sondern reichert sich fortwährend um Komponenten an, die gestern noch gar nicht in seinem Bewusstsein lagen.
Einmal erwähnt Hiero in etwas gedrückter Verfassung die angegriffene Gesundheit der Mutter, die er aus der Ferne leidenschaftlich umsorgt. Die einzige Reaktion, die er sich damit einfängt, ist ein diffuses Brummen. Offensichtlich hat er die Regel ›Niemals über private Dinge‹ verletzt. Beim Auseinandergehen jedoch – Hiero ist müde und seine Aufnahmefähigkeit getrübt, auch beschäftigen ihn andere Dinge – dreht sich Tronka noch einmal um:
- ―Ich zum Beispiel würde mir ja an Ihrer Stelle ein schnelles Auto kaufen und das Problem auf die Weise aus der Welt schaffen.
Das Problem? Ist das ein Problem? Hat er ein Problem? An dieser Stelle? Wenn ja, dann wusste er bis gerade nichts davon. Hätte er es wissen müssen? Was folgt daraus, dass er solche Dinge nicht weiß? Offensichtlich nichts Gutes.
Auch damals lief er stundenlang durch die Straßen, getrieben von einer Unruhe, die es ihm nicht erlaubte, seine Gedanken auf die Arbeit zu richten oder bloß zu sortieren. Darauf, sortiert zu sein, legte er Wert: gerade noch war er stolz auf den ausgeklügelten Zeitplan gewesen, nach dem er sich in seine klapprige Ente schwang, um die, zugegeben, lange Strecke abzuspulen und zu Hause ›nach dem Rechten zu sehen‹. Wenn sich an dieser Stelle ein Problem auftat, das er nicht sah, dann konnte sich überall eines auftun, ohne dass er sich dessen bewusst war und ohne dass er etwas dagegen zu tun vermochte. Es sei denn...
Es sei denn, er hielt sich sklavisch an Tronkas Ratschläge, die leider nur sporadisch kamen und viel zu vage ausfielen, als dass einen lebbaren Sinn ergaben.
Und er gibt zu: auch an das Thema der Dissertation ist er auf diese Weise geraten.
Es liegt ein großer Fortschritt darin, sich das einzugestehen.
Gerade dieses Wissen hatte er zuunterst vergraben.
Es durfte nicht sein, dass die Feder, die ihn in Gang hielt, durch ein System kleiner Nötigungen gespannt wurde.
Das durfte wirklich nicht sein. Der beste Beweis dafür, wie sehr es ihn so lange beherrschte, besteht darin, dass sie heute zerbrochen ist, wirklich zerbrochen. Er kann sich zurücklehnen, um das Trümmerfeld der vergangenen Jahre in Augenschein zu nehmen.

Miriam oder Von nichts kommt nichts
Das Trümmerfeld dieser Jahre, da macht er sich nichts vor, heißt Miriam. Er sieht den Platz am Tresen noch vor sich, wo es begann. Eine Phrase, er weiß, aber sie ›ergibt Sinn‹, einen guten sogar. Er sieht den Ort, er sieht die Stelle, wie er sie immer wieder gesehen hat, wenn er versucht war, das Netz der Abhängigkeiten zu ergründen, das sich im gleichen Augenblick über ihn warf, als er aufstand, um sein Schicksal oder das, was einer wie er dafür halten konnte, in die Hand zu nehmen.
Auch das ist Phrase. Es muss wohl ein ausgedehnter Augenblick gewesen sein, in dem es passierte. Und auch diese Phrase ergibt einen Sinn, der darauf wartet, in eingehender Analyse erschlossen zu werden. Fäden schießen zusammen, mit einem leisen Ruck schließt sich das letzte Glied und stellt etwas her, das in der Zeit und für die Zeit, sogar nur für eine bestimmte Zeit, sich als unzerreißbar erweist. Doch blind und taub gegen das, was da geschieht, trottet die Person, die es angeht, dahin. Gelegentlich reißt der Himmel auf und ein Brausen erfüllt die Luft, aber es bleibt dabei: Nur im Rückblick erscheint der Augenblick, in dem das Geschehen seinen Lauf beginnt. Kein kalendarischer Zeitpunkt bürgt für die Richtigkeit der Erinnerung, die diesen Punkt umkreist, ihn kreisend fixiert und als etwas imaginär Greifbares mit soviel seelischer Wirklichkeit ausstattet, dass der, den es angeht, sagen kann, er habe es vom ersten Moment an gewusst, aber nicht wahrhaben wollen.
Dieser erste Moment scheint wichtig zu sein, obwohl eine Vielzahl von Kandidaten dafür in Betracht kommt. Gern hätte Hiero, aus Gründen, die niemanden etwas angehen, eine Tochter gehabt, die auf den Namen Miriam hört. Vielleicht ist es der Name, eine weiche, wiederkehrende Bewegung, der in ihm andockt und über eine unauffällige Stelling den Austausch herstellt, dieweil er am Tresen sitzt und eine junge Frau Bier zapft, sich über die Kühlschranktür beugt, ein paar Flaschen heraufholt, Gläser spült und mit dem Lappen über die chromblitzende Ablage fährt. Es ist die Zeit, in der er über dem von Tag zu Tag rätselhafteren Verhalten Tronkas brütet und gern die Disposition seiner Arbeit ›auf die Reihe‹ brächte. Sie bereitet ihm Kopfzerbrechen, und nicht zu knapp. Der philosophische ›Brocken‹, an den ihn Tronka gehetzt hat, erweist sich langsam, aber sicher als Gestrüpp: praktisch undurchdringbar, durchzogen von kaum erkennbaren Kreuz- und Querschneisen, die eher am Ausgang zweifeln lassen, als dass sie Hilfe böten, überdies gesprenkelt mit Varianten, Formulierungen und ganzen Gedankenschüben, die bei jeder vom Verfasser veranlassten Auflage hinzukommen und die älteren Partien teils ergänzen, teils überlagern und das soeben noch mühsam Geklärte wieder in Frage stellen.
- ―Da ist ungeheuer viel herauszuholen. Das hat bisher noch kaum jemand versucht.
So hat Tronka, lockend wie selten, die Aufgabe begründet und Hiero hat sich, was denn sonst, hineingeworfen.
An Miriam, wie sie da mit den Gläsern klappert, hat sich – jedenfalls vermittelt sie diesen Eindruck – offenbar ebenfalls ›noch kaum jemand versucht‹, obwohl es kaum glaubhaft erscheint. So kommt es, dass er in einem der Momente, die rückblickend als erste in Betracht kommen, eine leise Lust in sich aufsteigen fühlt, zu Entlastungs- und anderen Zwecken auch diese Aufgabe anzugehen. Andererseits weiß er zu wenig über die junge Frau und ihre Verhältnisse, praktisch nichts, und sein Charme, das spürt er dumpf, ruht unter den sieben Siegeln der Verzweiflung. Dementsprechend faltet sich die Anmutung, wenigstens für dieses Mal, selbsttätig wieder zusammen und legt sich in den Schrank zurück.
So geht die Gelegenheit vorbei, ohne unmittelbare Folgen zu zeitigen, wie einige weitere in der Folge, wenn ein vager Ausdruck auf Miriams Gesicht ihn veranlasst, ein letztes Bier zu bestellen, von dem er eigentlich bereits innerlich Abstand genommen hat.
Nein, auf die Weise kommt er dem mythischen Moment nicht näher, an dem er ins düstere Tal geriet. Die Zeit könnte beliebig dahingehen, was sie ja auch tut. Er promoviert, es gibt Hochs und Tiefs, die Arbeit kommt voran, stockt, geht zurück, zerreißt und muss neu geflickt werden, das ergibt nichts Besonderes oder etwas, das sich erzählen lässt, und wenn er sich von Zeit zu Zeit gestehen muss, dass er im Grunde nicht begreift, was von ihm verlangt wird und was er sich selbst abverlangen sollte, so dichtet das Wort ›Anfangsphase‹ das, was eine Einsicht werden könnte, gegen Konsequenzen ab, die zu der Zeit noch zu ziehen gewesen wären.
Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll. Hiero greift zum Hahn, lässt warmes Wasser nachlaufen – eine Marotte seit seinen Kindertagen, in denen er nicht verstand, dass Mutter, befangen in älteren Routinen, es ihm vergeblich verwehrte.
- ―Warum?
Auch heute würde er gern noch so fragen. Manchmal, wenn Heide einen abschätzigen Blick durch die halbgeöffnete Badtür sendet, um nach ihm zu sehen, formt sich in seinem Mund die alte Frage und er verschluckt sie. Darin unterscheidet er sich nicht von Mutter, die bereits ihre Antwort verschluckte. Welche Gründe sie dazu bewogen, wenn sie denn welche besaß, hatten sich ihm nicht mitgeteilt, jetzt war es zu spät, sie danach zu fragen. Ihre Autorität kam in solchen Augenblicken nicht zum Tragen. Überhaupt wurde sie seltsam gedämpft durch die Atmosphäre des Hauses, in dem vieles, wenn nicht alles auf den Vater ausgerichtet war. Wie es sich lebt mit einer verschluckten Antwort, einem ganzen Nest verschluckter Antworten, welche Art von Magen man dazu benötigt und wie es sich anfühlt – das hat er damals nicht gewusst und hätte es auch nicht wissen wollen. Selbst heute will er es nicht wissen, obwohl er zugeben müsste, dass manches sich mittlerweile geklärt hat.
Die erste dieser von ihm nicht beantworteten, da erst gar nicht gestellten Fragen las er auf dem Gesicht der Mutter, als er mit Miriam bei ihr auftauchte.
Sie war schon nicht mehr die junge Frau vom Tresen, auch nicht die der ersten, tief erregten Wochen, an deren Ende er sie nicht nach Hause geschickt hatte, wie es sich gehört hätte. Das düstere Tal hatte ihn bereits aufgenommen. Gefunden hat er den Ausdruck in einem dieser merkwürdigen Romane, die von Zeit zu Zeit ein heftiges Lesefieber grassieren lassen. Sie scheinen weder für Erwachsene noch für Kinder geschrieben zu sein. Ihre Adressaten sind Halbkinder, Zwitterwesen, in die sie das Gros der Erwachsenen mühelos für kurze Zeit verwandeln. Zwar schielen auch die meisten Kinderbücher nach den Großen. Aber um ihre Stärken auszuspielen, bedürfen sie des Dreiecks. Erst wenn das Kind nach ihnen verlangt, kehrt das Begehren weiterzulesen auch im Erwachsenen wieder. Eine fromme Lektüre setzt, wie abgedunkelt auch immer, eine Kirche im Hintergrund voraus, eine kindliche Lektüre verlangt nach einem Kind. Da erscheint es logisch, wenn das Bedürfnis nach Lektüre stärker ist als das nach Kindern, Bücher zu schreiben, die sich am realen Bedarf orientieren.
Als Vater einer kleinen Miriam wäre Hiero ein exzessiver Vorleser. Er weiß es und hin und wieder üben sich seine Lippen lautlos an dieser Aufgabe. Er weiß es seit einem der Sommer, die dahingingen, ohne dass er sie im Rückblick recht zu sortieren vermag, weil sich alle irgendwie gleichen. Ein paar Kinder spielen mit Schaufel und Reuse am nur wenige Meter entfernten Strand. Sie kommen jeden Tag und er schaut ihnen vom Balkon der kleinen Pension aus zu. Es ist aber dieses nicht mehr in die Reihe zurückzuordnende Mal, dass sich eines aus der Gruppe löst, als wolle es auf das Haus zulaufen und werde schluchzend und mit verweinten Augen einen Moment später ins Zimmer platzen. Flöge die Tür jetzt wirklich auf, er wäre nicht verwundert. Etwas in ihm wartet darauf und nimmt das plötzlich laute Ticken der Stutzuhr auf der Kommode als Ankündigung des Unerhörten.
Doch als Miriam – die reale Miriam, das Wesen, das so unwirklich werden kann, dass er sich manchmal fragt, ob sie seinerzeit nicht doch den Flieger genommen hat und das alles nur in seiner Einbildung existiert –, das Zimmer betritt, da ist er es, der mit einer leichten Bewegung der Hand andeutet, dass er nicht gestört werden will. Diese Bewegung mit leicht abgewinkelter Armstellung, die Finger aneinandergelegt, um Distanz zu signalisieren, die umfassende Distanz, durch die das Denken ins Leben tritt und sich darin behauptet, ist irgendwann zwischen sie geraten, aus reiner Notwehr, wie er annimmt. Mehr als einmal konnte er ihr damit gerade noch rechtzeitig die Luft abschneiden und der pumpenden Bewegung Einhalt gebieten, auf deren Höhepunkt eine Abfolge schriller, stakkatoartiger und ziemlich ordinärer Vorhaltungen, Anklage und Aufforderung zugleich, aus diesem Wesen hervor- und auf ihn herabstößt, obwohl er anderthalb Köpfe größer ist als sie und sie auch in anderer Hinsicht überragt.
- ―Tu endlich was!
Offensichtlich gilt in diesem Gehirn, das, nicht ohne sein Zutun, inzwischen Examen besitzt und einen akademischen Beruf ausübt, das langsame Verfertigen der Gedanken, das immer erneute Abschreiten derselben Wege, die Sicherung des Gedachten, das Heranziehen der Texte, als sei es das erste Mal, während er sie doch schon hundertmal durchforstet hat, nicht als Tun. Aber es ist das Tun, das zählt: Sie beide sind, folgt er ihrer Rede, umgeben von Menschen, die etwas tun oder vorhaben, etwas zu tun, falls sie es schon nicht getan haben.
Dieses Meer von Tun, das in ihr flutet und in dem er unter matter werdenden Bewegungen langsam versinkt, entstammt keinem menschheitlichen Bewegtsein, wie er es aus den Tübinger Tagen kennt und noch immer in sich herumträgt, auch wenn sein Weg davon wenig erkennen lässt. Es ist egoman, auf Besitz und Freizeit erpicht und alles in allem eine Verschwendung von Lebens- und Geisteskraft an Belanglosigkeiten, die überall hinführt, nur nicht vor jene Tür mit dem im voraus entworfenen Schildchen, das ihn überall begleitet, darin fast dem Kantischen ›Ich denke‹ verwandt.
An diesem Ziel hält er unverrückbar fest, es ist sein Gradus ad Parnassum, die Komposition seines Lebens, er kennt die Mittel, er kennt die Wege, er hat sie durchgemustert und sich seinen, wie Tronka sagt, ›erkonstruiert‹. Er kann also nichts tun, das ist es, was er ihr entgegenhält, und da sie wohl begreift, was er da sagt und wie er es meint – sie ist ja nicht dumm –, versiegelt es ihr den Mund bis zum nächsten Ausbruch, der so sicher kommt wie... nun, wie... das Amen in der Kirche. Er weiß nicht, was die Kirche damit zu tun hat, er weiß nicht einmal, welche Kirche hier in Betracht käme. Aber dass Miriam heimlich den Finger ins Weihwasser taucht, ist evident.

Treffer
Eine krachend ins Schloss geworfene Tür – was ist das? Eine Drohung? Eine Verweiflungstat? Ein Pistolenschuss? Eine Evidenz? Wenn es nach Miriam ginge – und wann ginge es nicht nach ihr? – bestünde das Leben aus einer Serie solcher Pistolenschüsse mit sich aufgipfelnden Erregungen, Auseinandersetzungen und dramatischen Versöhnungen, im Bett besiegelt und durch anschließende kleine Fluchten – was? Mit Goldrand versehen? In einen banalen Abgrund gezogen, den er bis zum Schluss nicht ermessen kann?
Jedenfalls ist die Erregung verklungen und die Flucht, gleichgültig, ob es sich um einen verschwänzten Vormittag oder einen Tagesausflug nach Amsterdam oder um eine Kurzreise handelt, deren Ziel und Dauer bei Antritt nicht feststeht, zeitigt keinen der in Aussicht gestellten Genüsse, auch wenn Hiero immer wieder dem Sog der Verheißung erliegt.
Mit einem solchen Pistolenschuss ist sie in sein Leben getreten. Doch das wäre, falls es das gibt, eine nachgeschobene, von ihm damals nicht wahrgenommene Evidenz. Denn als sie ihn – unvermittelt, unvermutet – am Tresen ansprach und ihn fragte, ob er sie am nächsten Morgen zum Flughafen fahren könne, da fühlte er sich zunächst geschmeichelt und die Frage, warum sie gerade ihn zu dem Ritterdienst erkoren hatte, erübrigte sich, sie ging im erwachenden Affekt unter.
Dieser Affekt wiederum verlangte danach, das Gespräch, das sich so unvermutet auftat, nicht versiegen zu lassen. Aus einem Mund, der mehr lispelte als sprach, erfuhr er, dass die junge Frau, deren Lebenshintergrund er nicht kannte, ›dieses Leben hier‹ satt hatte und im Begriff stand, ihre Existenz nach Mailand zu verlegen.
- ―Warum Mailand? fragte er dreist. Es schien ihm aus studentischen und anderen Gründen erlaubt, so zu fragen. Er glaubte bereits, ein Recht auf eine Antwort zu haben. Die unter einem angedeuteten Leidensblick abgeschossene Antwort konnte ihn daher nicht befriedigen.
- ―Warum Mailand? Keine Ahnung. Vermutlich, weil es im Mai so schön ist!
Mit einer Leichtigkeit, die ihm später unverantwortlich vorkam, überhörte er das an sich unüberhörbare ›Was gehts dich an?‹, er überhörte es einfach, so wie er das Mechanische des Augenspiels übersah. Und doch nahm er beides in sich auf, so dass er sich später gut daran erinnerte, besser jedenfalls als an das in großen, leicht verwischten Lettern geschriebene Etikett ›fragile‹, das seinen Blick damals gefangennahm. Er hörte und sah, er überhörte und übersah wie einer, dem gerade Hören und Sehen verging. So musste es wohl sein.

Luxor lebt
Luxor ist nicht vorbei.
Weder damals noch jetzt.
In welcher Weise auch immer.
Wie er durch klug gewählte Abgänge sein Bild im Gedächtnis derer befestigt, die bleiben, die immer bleiben, vornehmlich deshalb, weil ihnen nichts Besseres einfällt, weil es ihre Art ist, da zu sein: da oder dort, wohin der Wind des Tages sie verschlagen hat oder die Absicht, ein Studium abzuschließen und ›sich etwas aufzubauen‹ –
Wie er muskellos bleibt zwischen den Trainierten, die danach verlangen, gebraucht zu werden, bepackt und vorwärts getrieben von dem Wunsch, einmal selbst zu den Treibern zu zählen oder, Inbegriff aller Wünsche, ein großer Treiber zu werden –
Wie er sich entzieht in seinen Reden, in dieser eigentümlichen Nacktheit zwischen Leuten, die angestrengt in die Luft starren, um sich nichts davon entgehen zulassen oder peinlich berührt den Blick senken –
Das Bild ist stumm. Zweifellos ergibt es Sinn, aber: es produziert keinen. Was soll das? Was ist das? Eine Figur der Sehnsucht, poloymorph, polymorph-pervers, ein bisschen schnoddrig muss man das Thema schon angehen, Balance halten, Zynismus ist anders. Luxor löscht dich aus, keine Frage, aber ihm nimmst du es nicht krumm, ihm nicht, höchstens dir, deinem Doppelwunsch, sein Bild auszulöschen und doch stehen zu lassen für alle Zeit, eine Statue, ägyptisch, griechisch, gleichviel, das ist nicht die Frage. Luxor ist ein Entwerter wie Pw und die anderen, aber er ist es nicht gezielt und trickreich, um sich an deine Stelle zu schieben, sondern vollständig und absichtslos. Seine Geschichtchen blasen die der anderen in die Luft, man sieht ihnen nach: erleichtert und beklommen. Was Pw, der Möchtegern-Patron, am liebsten wäre, anstrengungslos, Luxor bleibt es bei den diffizilsten Manövern, ein Athlet der Enthaltung. Natürlich starrst du auf ihn, noch heute, nicht die anderen, du –
- ―Aber da war nichts!
Weit gefehlt, junger Mann, selbst dein Badewasser verrät dich, schwer und träge, Zwangsjacke fast, hüllt es dich ein – Blödsinn, Blöd-sinn wie so vieles andere, das durch den Kopf zieht, als seien sämtliche Türen und Fenster geöffnet und die nächste Erkältung auf halbem Weg. Du hast dich an Luxor erkältet, das ist die Wahrheit, wenngleich kein Weg. Die Leidenschaft hat ein wenig gelitten seither. Das soll vorkommen, es trifft das Fortkommen, philosophical non-philosophical, die Frauen. Es trifft sie alle, mehr oder weniger, manche mehr, manche Frauen, einen Frauentyp vielleicht ganz besonders. Ihn ganz besonders. Cave! Leider stehst du auf ihn. Die anderen mögen sein, wie sie wollen, sie kommen ohnehin nicht an dich heran, nicht so wie Luxor an dich herankommt, jedenfalls in bestimmten Momenten. Die so bestimmt nicht sind. Eher unbestimmt, Zahnlücken der Zeit, Intervalle, in denen sie ihre Beute auslässt. Zeitausfall, sozusagen. Dass die Zeit Ausfälle zeitigt, ist seit dem Abflauen der Metaphysik nicht mehr richtig bedacht worden, es fehlt an griffigen Theorien, aber das Phänomen ist unbestreitbar. Man sieht durch die Lücken in eine andere Welt, nicht in andere Zeiten. Transversal durch die Zeiten, ein Rauschewort aus dem Rauschewald. Solche Wörter vertreten die tote Metaphysik, sie halten die aufgegebene Stellung, ihre Zahl wächst von Jahr zu Jahr, das ist unübersehbar. Ochs und Esel umstehen nicht länger die Krippe, sie sind unterwegs. Auf eigene Faust. Auf eigene Rechnung. Auf eigenes Risiko. Auf Rutsch-mir-den-Buckel-runter. Auf Reiß-aus-wenn-du-kannst. Irgendwo bist du ausgerissen, irgendwer hat dir ein Messer in den Hals gestoßen, irgendwer häutet dich gerade, gekonnt und ungekonnt, wer wäre hier Meister, irgendwer bietet dir eine Frucht, der du nicht widerstehst.
Als braver Sohn der Zeit, die du, bis tief in die Poren hinein, bist, kannst du mit dem Erinnerungsbild wenig anfangen. Praktisch nichts. Der Mann ist dir fremd. Wozu das Wortemachen? Er ist dir fremd in dem Maß, in dem er offen ist. Offen für Männer. Für was denn sonst? Woher sonst käme die Anmutung, der Hauch, der über alle hinweggeht und sie erschauern lässt, ausgenommen Portiönchen, die still auf ihren vier Stuhlbeinen sitzt und wartet, dass es vorbeigeht. Dieses Sich-Befremden, als müssten sie sich bekreuzigen. Das Christusförmige des Geschlechts, vor dem alle Reißaus nehmen. Am meisten Pw, der es auf sich zieht, warum auch immer, woher auch immer. Er kann sich schütteln, soviel er will, der Mann geht ihm lächelnd und willenlos nach. Grenzenlos zugetan: so lautet das Wort.
Eines ist sicher. Pws spielend behauptete Überlegenheit endet an der Schranke der Bewunderung, die ihm von Luxors Seite entgegenschlägt, einem Sich-Verwundern am andern, einem Übergang ohne Maß. Liegt hier das Gegenstück zu der Bewunderung, die du für Tronka empfindest und die dieser seit Jahr und Tag annimmt und zurückweist, als könne er sich beides zugleich leisten, ohne dafür bezahlen zu müssen? Stattdessen lässt Tronka dich bezahlen, soviel steht fest, nicht in Geld und guten Worten, sondern, wie es sich unter Aristokraten des Geistes gehört, mit deiner Person. Deren Verstümmelung nimmt er leicht, er übersieht sie geflissentlich und zwingt dich dadurch, sie ebenfalls nicht zur Kenntnis zu nehmen, sie innerlich wegzustecken, was ein Widerspruch ist, aber ein aushaltbarer.
Die Gesten, die schrecklichen Gesten, denen nichts folgt.
Nichts außer Tagen, Wochen und Jahren.
Und wiederum Gesten, leicht abgewandelt und leicht zu erkennen.
Hinhaltegesten. Am Ende, an irgendeinem von irgendetwas, nach dem es weitergeht, als sei nichts gewesen, die Empfindung des Lebensbogens, der sich zu neigen beginnt.
Kann man einen Menschen so dirigieren? Kann man ihn so zu Tode dirigieren? Der Argwohn, flüchtig und wiederkehrend, ein streunender Hund, du kennst ihn wohl, du scheuchst ihn weg, mit Steinwürfen, wenn es sein muss. Wäre er zuzulassen? Eine berechtigte Hypothese? Etwas, womit du dich ernsthaft beschäftigen solltest? Die Philosophie kennt das Ausgeschlossene, sie heftet todernste Magnetblicke darauf und kommt davon nicht los. Warum soll es dir anders gehen? Warum solltest du allein nicht zulassen, wo alle Welt im Bilde ist? Mach dir nichts vor.
Ja, man kann. Tronka kann, Miriam kann. Sie ist bei Tronka in eine gute Schule gegangen, sie ist Tronka noch einmal, von innen, mit fraulichen Mitteln. Woher sie weiß...? Aber du selbst hast ihr doch alles erzählt. Wann mag das gewesen sein? In den guten Stunden, die ihr zusammen hattet, die ihr immer wieder hattet, bis zum Schluss, erstaunlich genug. Diese Stunden waren dein Feind, sie legten dich bloß, ohne dass du den Prüfblick bemerktest, der über dich wegglitt.
Warum?
Weil du sie nötig hattest. Aus keinem anderen Grund. Sieh das ein.
Mach dir nichts vor.
Auch Miriam hat dich angenommen und zurückgewiesen in einem. Auch sie hat dich bezahlen lassen, weniger mit deiner Person als mit deinem Leben, eine gefräßige Liebhaberin der Zeit, die du nicht hattest.
Du bist zwischen die Backen einer Zange geraten. Druck und Gegendruck, Hiero. Den Druck einer Seite hättest du ertragen können, du hättest ihn spielend erwidert, wäre die andere Seite nicht unverzüglich ebenfalls tätig geworden.
›Unverzüglich‹ ist vielleicht nicht das richtige Wort. Was wie Osmose aussieht, ist es wohl auch. Manchmal schläft das System, das kommt vor, nur ein paar Tage, bevor auch sie die Hunde koshetzt. Gewöhnlich klappt das System ausgezeichnet.
Bist du wahnsinnig? Welches System? Die beiden haben doch nicht die Köpfe zusammengesteckt, um dich fertigzumachen. Nein, so geht das nicht. Wirklich nicht. Sie haben sich nichts zu sagen gehabt. Wohlgemerkt: auf deine Kosten. So sah das aus. Sie haben einander kühl taxiert, als sie zusammenkamen. Eine Spur zu kühl vielleicht. So etwas kann tausend Ursachen haben. Kein Mensch wittert da etwas. Wann war das? Wie oft? Miriam holt dich nach der Vorlesung ab. Das muss früh sein, sehr früh. Du redest mit Tronka, sie steht dabei, steht herum. Mehr gibt die Szene nicht her. Wechsel. Tronka in deiner Wohnung, in eurer Wohnung, Übergangsphase. Von wo nach wo? Diese Wohnung war nicht für solchen Besuch gedacht, das konnte nicht klappen. Es klappte auch nicht, mehr eine Arztvisite, die Gespräche ruhen, bis der Herr wieder geht. Er fühlt den Puls und macht Konversation. Miriam, wo steckt Miriam? Sie ist da, sie ist nicht da, sie sitzt in der Ecke, klappt ihre Augen auf und zu, steht auf, geht in die Küche, kehrt wieder, sagt etwas. Schleift einen Fremdkörper ins Gespräch und lässt ihn da liegen. Einen Fremdkörper... Ist das wichtig? Erinnere dich. Nein, es ist nicht wichtig. Warum das Gedächtnis strapazieren, wenn es nichts hergibt. Vergiss es. Miriam gibt nichts von sich her. Sieh das ein. Sie spielt Postamt und Briefträger, all in one. Natürlich stört es dich, hat es dich damals gestört, gefuchst hat es dich, das versteht sich. Miriam Poltergeist, so etwas gab es. Und nicht zu knapp.
Danach muss wieder Bier fließen.
Sie mögen sich nicht, das ist die nüchterne Wahrheit. Will der eine dich ganz, so will die andere dich nicht minder. Wollen sie dich? Wofür? Denk nach. Wenn du an Tronka hängst, wenn du dich an ihn gehängt hast, dann hast du ein Ziel. Dieses Ziel heißt: Ich will über ihn hinauskommen. Dein Ich beginnt, wo Tronka endet. Natürlich erhebt sich die Frage, wo Tronka endet, vorderhand denkt er nicht daran, während du an der Aufgabe, die er dir gestellt hat, verhungerst. Ngazzo.
Die Aufgabe ist das eine. Das andere: Du verhungerst auch ohne sie. Vielleicht sogar eher, auf direkterem Weg. Miriam hat es dir gezeigt. Nicht sie allein, es wäre ungerecht, es so zu sehen. Sie ist keine Teufelin. Ganz und gar nicht. Den Flieger jedenfalls hat sie damals nicht genommen. Die Geste hat sie bis ans Ende gepflegt, das musst du ihr lassen. Das war der Stoff, den sie dir zuführte. Du hast ihn gewollt und du hast dafür bezahlt. Basta.
Heide kennt solche Gesten nicht. Sie würde fliegen: heute, immer. Sie ist geflogen, damals, nachdem sie dich in Stellung gebracht hat, ein Murmeltier, Männchen machend, die Nase im Wind, schnuppernd, den Braten riechend und bereit, ihn zu vertilgen. Eigentlich bist du ihr deshalb ins Netz gegangen, weil sie mit jemand anderem geflogen ist, als du sie nötig zu haben glaubtest. Dieser Jemand, naja.
Du schläfst jetzt beinahe ein, Hiero, das sind so Krümel auf dem Grund des Bewusstseins, du solltest sie liegen lassen.

Aus der Traum
Er schläft. Auf dem Grunde der Wanne liegt er gekrümmt, nicht wie ein Wurm, sondern wie einer, der sich vergebens sich selbst anzuschmiegen versucht – ein zweckloser Versuch, aber wer will schon über ›vergebens‹ und ›nicht vergebens‹ rechten und wer wüsste nicht genau, dass ›unmöglich‹ nur der letzte Versuch heißt, etwas möglich zu machen, seine Möglichkeit zumindest zu denken?
Unmöglich ist es nicht, Möglichkeit und Unmöglichkeit so zusammen zu spannen, dass sie die Karre eine Strecke weit aus dem Dreck ziehen. Er hat es oft genug probiert. Selbst wie es jetzt in ihm weiterdenkt, obwohl der Außenkontakt unter die Fünf-Prozent-Grenze gefallen ist, stammt aus diesem Fundus. Er erkennt es wieder wie eine alte Bekanntschaft.
Grenzen werden gezogen, damit man sie überschreitet. Aber das bedeutet Krieg, jedenfalls wenn es nicht unbemerkt bleibt.
Wann, Hiero, hat dein Krieg begonnen?
In dieser Landschaft ist alles in Bewegung. Räume tun sich auf wie nichts und versinken ebenso angesichts einer einfachen Wendung. Gerade noch hielt ihn Heide umklammert, nun zieht sie sich aus ihm heraus, ein langer schmaler Strich, der abhebt. Diese Leere wird sich mit Blut füllen.
Woher der Satz? Ein Satz der Ebenen, die er durchzieht, eine lange, beklommene Pilgerschaft wird es sein, ein Bußgang für nichts, für fast nichts, ein Etwas, an das er sich nicht zu erinnern vermag, was mag es sein? Ah, da hoppelt es querfeldein, äugt und rennt weiter.
Für den Fall, dass man mich ans Kreuz schlägt, habe ich einen Wunsch: Ich möchte abseits begraben werden. Aber das hat keine Eile.
Wer, bitteschön, sollte mich denn ans Kreuz schlagen? Das wäre ja absurd. Wer sollte so etwas tun? Auf wessen Wunsch hin?
Willfährige gibt es genug, das ist wahr.

Schattenwiese
Er weiß es wirklich nicht. Mag sein, es ist über ihn verfügt, aber er weiß es nicht. Er könnte es wissen. Aber dafür müsste er aus dem Schatten heraustreten, Schatten, wo sein Herz im Kreis trabt, während er dahinzieht in mühsamer Pilgerschaft, Schritt für Schritt, einen Schritt vor den anderen. Einen Fuß vor den anderen. Bleibt der Schuh einmal stecken, muss man ihn wieder herausziehen. Das ist mühsam und es gelingt. Nicht immer sauber, aber es gelingt. Man könnte Regeln aufstellen. Viele Regeln, Regale voll Regeln. Nachregeln.
Das Buch, das er schreiben muss, es steckt doch in ihm, er könnte es Satz für Satz...
Ja was denn? Lesen? Aufschreiben? Heide erzählen? Vortragen?
Es steckt in ihm, aber es kommt nicht heraus.
Das ist schade. Was soll man machen.
Kaiserschnitt, hätte Vater geraten, der seit den Tagen der Gestapo ein Faible fürs Körperliche besaß.
Ein Buch ist kein Kind.
Ein Buch ist weniger als ein Kind, unendlich weniger, das muss doch einmal gesagt werden.
Ein Buch ist mehr als ein Kind, unfassbar mehr. Auch das muss einmal gesagt werden.
Die Qual, es auszutragen, ist unendlich, unaufhörlich, unbegreiflich.
An einem Kind ist alles begreiflich. Es hat zwei Augen, zwei Arme, zwei Beine und nach neun Monaten landet es, so oder so, auf dem Schoß der Mutter.
Die kleine Miriam zum Beispiel, die ihm entgangen ist: Er kann sie sehen, darin liegt keine Schwierigkeit. Obwohl es kaum mehr als eine Bewegung ist, was ihn da anblinzelt.
Das Buch hält sich derweil abseits, vielleicht schmollt es, vielleicht ist es ihm nicht recht, auf so einfache Weise ausgepunktet zu werden. Es bedient sich der Nachtzeiten. Tagsüber am Schreibtisch, wenn alles leicht wäre und an seinem Platz, entzieht es sich beharrlich und lässt ihn Scheinsätze aufs Papier werfen. Eigentlich hat es sich losgemacht. Ja sicher: Es hat sich losgemacht.
Nachdem es lange kein Gesicht finden konnte, ist es zum Schemen geworden.
Ein Buch will vor der Geburt gehätschelt werden und eine Nabelschnur besitzt es auch. Das lange Saugen hat ihn geschwächt, eigentlich erstaunlich.
Lange Zeit dachte er, er hätte Kräfte im Überschuss.
Damit war es wohl nichts. Er hat ein Buch schreiben wollen, er kann daran nichts Schlechtes erkennen. Er hätte es neben die anderen gelegt und gedacht: Das ist meins.
Damit sich der Fahrstuhl weiterbewegt. Dieser Fahrstuhl. Die Pyramide verfügt über zwei. Tronka benutzt nur den einen.
Das ist doch zwanghaft. Vieles an Tronka ist zwanghaft. Er hat es immer gesehen, er hat auch nicht weggesehen, als es unangenehm wurde. Tronka hat diese Seite, man sieht sie und zuckt mit den Achseln. Es macht keinen Unterschied. Das Genie wirft einen Schatten, na und? Wenn man es dafür zu sehen bekommt, geht der Preis in Ordnung. Hereinspaziert. Und wieder hinaus. Herein. Hinaus. Herein. Hinaus. Es macht keinen Unterschied.
Es macht einen Unterschied, zu wissen, ob so ein Buch kommt oder nicht. Aber auf den Alltag gerechnet bleibt er verblüffend gering.
Miriam hat den Glauben irgendwann aufgegeben. Heide steht dicht davor, vielleicht ist sie auch schon weiter. Mag sein, sie hat nie ans Buch geglaubt, das würde vieles erklären. Es hat keine Bedeutung für sie, so oder so.
Unnachsichtig ist sie nur Tronka gegenüber.
Sie hat ihn einmal gesehen. Nicht zwei, nicht zwanzigmal. Einmal.
Danach hat sie ihn einen gestörten Menschen genannt, nicht schrill, praktisch ohne Nachdruck, als sei das nun wirklich das erste, was einem ins Auge sticht.
Ein gewöhnlicher Mensch wie sie, wie konnte sie so etwas sagen?
Das macht doch keinen Sinn.
Er hat sich in Rage geredet, pro Tronka, der ihn in diesem Augenblick, vielleicht zum ersten Mal, völlig gleichgültig ließ. Gegen ihr Schweigen, ihre spiegelnden Augen, Hochmutsaugen. Hochmut gegen Hochmut.
Gleichviel.
Sie besitzt kein Recht auf diese Rede. Sie hat es sich genommen, folglich musste es irgendwo herumliegen.
›Vorsicht, gefährlich!‹ würde er gern ausrufen, es ihr wieder abnehmen und behutsam in die lederne Schatulle zurückbetten, aus der es stammt.
Aber daran ist nicht zu denken. Dieser Hochmut lässt sich nicht brechen. Heide ist viele. Heide ist verständigt, mit wem auch immer. Gestern mit ihm, heute mit irgendwem.
Eine wie die läuft sich nicht die Hacken ab. So eine streift an den Leuten vorbei, etwas fällt immer ab, das genügt ihr. Auch ihn hat sie gestreift: eine reife Frucht, die in ihrer Hand blieb.

Soldat des Führers
Zum dritten Mal sind die Lachsalven verraucht, zum dritten Mal mehren sich die fragenden Blicke in Richtung Pw: Schafft er es, dem Spuk ein Ende zu setzen, der da so unvermittelt über sie hereingebrochen ist? Solange Luxor am Tisch sitzt, kommt Tronka nicht in Gang. Das liegt auf der Hand. Solange Tronka in dieser unbedeutenden Halbstarre verharrt, die man sonst nur von ihm kennt, wenn er in Kärichs Bannkreis gerät, ist der Abend ein Flop. Auch sollte niemand die Gefahr unterschätzen, die davon für die Zukunft ausgeht. Jedes Sakrileg gefährdet die Institution, in der es sich ereignet. Es muss unterbunden werden, wenn die Institution unbeschädigt überleben soll. Es geht also ums Überleben, zwar nicht des Einzelnen, aber der Gruppe. So etwas ist immer eine ernste Sache. Und so kommt Pw, was er im häuslichen Gespräch oder in einer Klausur ohne weitere Überlegung als ›rettende Idee‹ bezeichnen würde.
Das Wort ›Idee‹ besitzt unter Philosophen einen besonderen Klang. In der Regel dient es als eine Art Prüfstein, mittels dessen sich entscheiden lässt, ob man einem harten Sensualisten oder einem wie auch immer verkappten Idealisten gegenübersitzt. Dialoge nach dem Muster ›Haben Sie eine Idee?‹ – ›Nicht im mindesten!‹ verbieten sich in einer so vielschichtig angereicherten Atmosphäre von selbst. Die ›Wiedergewinnung des ursprünglichen Sinns‹ der Platonischen Ideenlehre gehört zum Standardrepertoire, mit dem Leckebusch seine Vorlesungen bestreitet. Tronka hat sich lange bedeckt gehalten, seine Hegel-Kritik ist schließlich legendär. Aber alle an diesem Tisch wissen, dass er in seinem letzten Buch eine diskrete Begriffsrevision vorgenommen hat, die eher auf eine Neugewinnung denn auf eine Wiedergewinnung hinausläuft. Die Tronkasche Idee hat mit der Platonischen oder Hegelschen wenig mehr gemein als den Namen, es sei denn ein ganz vage umrissenes Aufgabenfeld: die Selbststeuerung der Erkenntnis in den gefährlichen Fahrwassern der Empirie, in denen man leicht auf Grund laufen kann, wenn die Navigationssysteme nicht intakt sind oder, leider, leider, unzureichend bedient werden.
Tronka ist weitergekommen. Anders als Hiero leidet er nicht an überlangen Bedenkzeiten. Sein Denken gleitet geschmeidig über die Schürf- und Schabekanten hinweg, an denen seine Kollegen sich bei dem Versuch, vorbei zu kommen, die Hände und manchmal auch die Klamotten aufreißen, so dass sie Einsichten bieten, an denen ihnen nichts gelegen ist, falls sie es überhaupt registrieren. Wie das Denken, so der Fluss seiner Worte, der sich von Zeile zu Zeile, von Seite zu Seite, von Kapitel zu Kapitel ergießt – eine grauschwarze, überaus rinnfähige, ein Gewimmel mikrologischer Strukturen ausfächernde Masse. Tronkas Bücher sind schwierig. Sie sind schwer zu lesen und noch schwerer zu verstehen. Vor allem aber sind sie dick, wenn man von der vorgeschriebenen Seitenzahl der Dissertation einmal absieht. So nimmt es nicht wunder, dass sich aus der Runde bisher keiner dazu entschließen konnte, das neue Opus zu lesen, obwohl es in ihren Regalen auf dem Ehrenplatz steht, als Number One, sozusagen. Ausgenommen natürlich Hiero, aber das macht keinen Eindruck mehr, nachdem er zum Adlatus aufgerückt ist und sein Tätigkeitsfeld ihn dazu verpflichtet. Seit er an der Seite des Herrn schreitet, haben sich die Fronten verschoben. Man könnte meinen, durch den Seitenwechsel habe Hiero jeden Anspruch auf Loyalität verwirkt. Auf seine breite Brust zielen die Nadelstiche, die man sich dem Professor gegenüber aus naheliegenden Gründen versagt, und es kommen Fälle, da kommt er aus dem Zweifel nicht heraus, ob er sich als Adressat oder als Mittler begreifen soll.
- ―Wie meinst du das? geht er Pw des öfteren an, der nur vielsagend mit den Schultern zuckt. Statt den Quader zu lesen – auch Ausdrücke wie ›Ziegelstein‹ oder ›Brikett‹ sind zu hören –, erfinden sie Argumente um die Wette, die darauf zielen, das Schreiben als solches zu diskreditieren, zumindest das Abfassen systematischer Wälzer, das alles in allem doch von gestern sei.
- ―Sag mal, wer soll das eigentlich lesen? Pw ruckt mit der Schulter – eine Bewegung, die ebenso Verlegenheit andeutet wie Ungeduld.
- ―Tu’s doch, sagt Hiero, er lässt die Stimme trocken klingen, wie eins dieser Plopps, mit denen Pw bei jeder Gelegenheit aufwartet.
Ob das auch so ankommt? Es lässt ihn inzwischen kalt, genauso wie der Umstand, dass keiner von ihnen bis heute die Pyramide betreten hat, die sich ihrer Neugier in gläserner Offenheit präsentiert.
Heute aus Eikes oder Pws Mund zu hören, alles in allem sei die Philosophie doch nur abseitiges Gelände, ist läppisch. Jahrelang haben sie anhand solcher Bemerkungen aussortiert, wer nicht in Betracht kam. Das Wort Neid, hübsch groß geschrieben, erklärt manches, aber es rechtfertigt nichts. In dem Brodeln und Knistern sortiert sich etwas. Hiero weiß nicht was, er kann es sich denken, er hütet sich, darüber zu reden. In diesen unerwartet über dem philosophischen Nachthimmel aufflammenden Fragezeichen bereiten sich Lebensentscheidungen vor.
They never come back. Der Satz macht das Zögern transparent. Kärich hat ihn eines Abends in die Runde geworfen: Es ist nun einmal so, dass die Stellenfrage allen anderen vorgeht. Das Plätzchen, das Hiero ergattert hat, ist nicht attraktiv, es bedeutet nichts, aber es wahrt die Option. Wer leer ausging, weiß bereits, dass er nicht in Betracht kommt. Der Kelch schwankt noch im Raum, die Austeilung ist nicht beendet, am Ende der Schlange gibt es Gedrängel. Manche, die vorn leer ausgingen, haben sich wieder angestellt. Aber er schwebte vorbei. Damit müssen sie nun ›zurechtkommen‹. Gleich Witwe Boltes Federvieh zerren sie den Befund, an dem sie sich alle verschluckt haben, in die Kreuz und in die Quer, so lange, bis... Nein, so weit will Hiero definitiv nicht denken. Dafür denken andere. Es rattert geradezu hinter ihren Stirnen, weiß Gott, welches Gerät da zum Einsatz kommt.
Da ist sie, die rettende Idee.
Ein Wort, das bislang in ihrer Runde nicht vorkam, ungeachtet des Umstands, dass sie alle Geschichte studiert haben, zur Linken, wie es die ungebremste Stoffhuberei verdient, Pw schüttelt den Becher und da rollt es hervor, ein Geschöpf des Zufalls:
Stalingrad.
Er hat den Plivier gelesen, selbst Hiero kann da nicht mithalten.
Mit wachsender Verstimmung hat Tronka auf das Stichwort des Abends gewartet. Nun, da es gefallen ist, nimmt er die Herausforderung nur zögernd an. Schließlich handelt es sich hier um kein philosophisches Thema, nichts, über das sich ex officio sprechen ließe. Dazu neigt er neuerdings, auch wenn die alte Offenheit vorgeht.
- ―Tja, Herr Wichterich, lässt sich seine Stimme vernehmen, harte Sache das. Da draußen wären Sie mit Ihrem verzärtelten Gemüt nicht durchgedrungen.
Ironie ist nicht gerade das Feld, auf dem er brilliert. Aber er liebt ihre Posen.
Pw übergeht den Einstieg glatt. Der Fisch hängt an der Angel, er lüpft den Köder, leicht, ohne Nachdruck.
- ―Jetzt mal den ästhetischen Quatsch beiseitegelassen: wen das nicht berührt, der ist in meinen Augen ein Krüppel. Was ich allerdings nicht verstehe: Worum geht es diesem P-P-Paulus eigentlich wirklich? Das Gequäke aus der Leitung von wegen Führerbefehl kann ihn doch kalt lassen. Der Führer ist weit weg, eine Stimme aus dem Jenseits, ein Phantom. Hier stirbt die Armee und er muss etwas tun. Aber er tut nichts, bis zum Schluss, jedenfalls ist das der Eindruck, den der Plivier vermittelt, ich weiß nicht, ob das historisch standhält.
- ―Das dürfte es wohl.
Tronka spricht jetzt doch ex officio, wenngleich nur ein bisschen.
- ―Aber denken Sie doch einmal nach. Denken Sie, wer dieser Paulus ist. Der Renegat kann nichts tun. Das ist die Crux. Er kann nichts tun, obwohl die Lage es zwingend verlangt.
- ―Das verstehe ich nicht. Er kann doch aufgeben. Die militärische Lage ist entschieden. Die Leute krepieren wie die Fliegen. Er muss aufgeben, was denn sonst?
Pw macht das gut. Er sitzt sehr aufrecht, die Hände gerade vor sich auf dem Tisch, das Bierglas dazwischen, aber ein wenig weggeschoben, nicht griffbereit, dem ethischen Ernst der Fragestellung angemessen.
- ―Das sagen Sie. Für einen Soldaten des Führers sieht das ein wenig anders aus. Die eigenen Leute hätten ihn umstandslos gekocht und entsorgt, wenn er sich anders verhalten hätte. Aber darum geht es gar nicht. Das geschieht alles hier drin. Saulus zu Paulus. Die Armee ist schließlich das Instrument des Führers. Denken Sie einmal nach: Was haben diese Buben aus dem Sauerland oder aus Güstrow vor Moskau, vor Stalingrad, vor Leningrad überhaupt zu suchen? Nehmen Sie den Narren im Führerhauptquartier heraus und das fällt alles in sich zusammen. In den russischen Dreck. Aus, fertig.
Pw zieht den Haken an.
- ―Wie hätten Sie eigentlich entschieden? Ich meine, als Befehlshaber einer geschlagenen Armee... Hätten Sie sich auf dem Sofa ausgestreckt und den Tod Bulemann spielen lassen?
- ―Als Soldat des Führers? Ich? Ihre Phantasie spielt Ihnen da aber einen Streich. Alles, was recht ist. Ja, ich hätte genauso gehandelt. An Paulus’ Stelle hätte ich genauso gehandelt. Ja.
Pw, etwas verblüfft, blickt streng.
- ―Das ist doch nicht Ihr Ernst.
- ―Doch. Das ist mein voller Ernst.
Luxor, durch den kleinen chirurgischen Eingriff aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit herausoperiert, sprachlos vor Entsetzen oder nur verdutzt, ein ziviles Kriegsopfer, zahlt seine Zeche und geht. Er jedenfalls hätte nicht so gehandelt, aber danach fragt keiner. Das Vergessenwerden hat viele Facetten.

Denn wovon lebt der Mensch?
Hiero kann es nicht fassen.
Nein, Herr Tronka, das können Sie nicht meinen. Wir beide haben ein Abkommen, da können Sie sich nicht einfach davonmachen. Was unser Abkommen vorsieht, das steht auf einem anderen Blatt, das gehört gar nicht hierher, aber was zu weit geht, das geht zu weit. Das hier geht zu weit. Sie gehen zu weit, Herr Tronka.
Ganz ernst, ganz gesammelt, heuchlerisch gesammelt, es fehlt nur, dass er die Hände zusammenlegt, treibt Pw den Haken fester.
Leicht nur, wir wollen uns den Spaß nicht durch Entschiedenheit zur falschen Zeit verderben.
- ―Ich hätte mir fast gedacht, dass Sie so argumentieren würden. Ich wollt’s nur hören. Aber erklären Sie mir mal, wie Sie den Bogen von dieser Haltung zu Ihrer Mitgliedschaft in der SPD schlagen. Ich finde es fatal, um da keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Mitgefangen, mitgehangen? Dann hätten Sie auch mit dem einfachen Soldaten in Stalingrad krepieren müssen. Aber nein, der frisch gebackene Reichsfeldmarschall zieht in die Luxusgefangenschaft um. Mit Fahrer.
Beim ›einfachen Soldaten‹ geht eine Verwandlung mit ihm vor. Die Lippe vibriert leicht, die Mundwinkel verengen sich, der Blick geht geradeaus in die Ferne. Kein Zweifel, uraltes Landserleid kriecht durch seine kalten Adern.
Aber so leicht ist Tronka nicht auszuhebeln.
- ―Das Regime hat natürlich einen gewissen Menschenverbrauch. Das sollten Sie als Dezisionist doch wissen. Damit kann man sich natürlich ethisch herumschlagen. Auch im Führerbunker nimmt man diese Dinge ganz ganz ernst. Das gebietet schon das soldatische Kasperlespiel. Sie glauben doch nicht, dass sich an den Entscheidungen dadurch ein Jota ändert? Also jetzt sind Sie aber naiv. Und was die Mitgliedschaft in der SPD angeht, das steht auf einem anderen Blatt. Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
- ―Wieso? mischt sich Eike ein – ungefragt, fast schon ungebeten.
- Das, mein Lieber, steht jetzt wirklich auf einem anderen Blatt. Schauen Sie mich nicht so ungläubig an, man bekommt ja das Frieselfieber davon. Kann ich was dafür, wenn Ihre katholische Seele bei dem Gedanken ans Auswandern denkt? Hier geht es um Politik für die Leute.
- ―Die Leute sind doch dieselben.
- ―Sie mögen dieselben sein, ja manchmal, eigentlich immer, da haben Sie sogar recht. Aber das bedeutet gar nichts.
- ―Gar nichts –?
- ―Überhaupt nichts. Schlagen Sie die Metaphysik der Sitten auf und Sie werden finden: Die Gesetze eines Landes müssen so beschaffen sein – das schreibt Kant! –, dass sich mit ihnen auch ein Volk von Teufeln regieren lässt.
- ―Ja gut, die Gesetze...
- ... muss schließlich jemand machen. Dazu brauchen Sie Mehrheiten, mein Guter. Aber um auf Paulus zurückzukommen: Ich finde, Herr Wichterich, Sie machen sich die Dinge etwas zu einfach.
- ―Komisch, derselbe Gedanke kam mir gerade bei Ihnen.
Das ist frech, sehr frech. Hiero, der gerade dasselbe dachte, zuckt zusammen. Er beschließt, die Dinge zurechtzurücken.
- ―Ja, aber wenn Sie ein Volk von Teufeln regieren wollen, um diesen etwas merkwürdigen Ausdruck zu gebrauchen – der Kant hat das natürlich anders gemeint, das will ich gar nicht thematisieren, darum geht es jetzt nicht –, wenn Sie ein Volk von Teufeln regieren wollen, dann brauchen Sie einen weisen Gesetzgeber, den weisesten vermutlich, nicht einen mordsüchtigen Derwisch an der Spitze.
- ―Gut gebrüllt, Löwe! Wo soll der denn herkommen, wenn das Volk aus Teufeln besteht?
Es wurmt Hiero, dass Pw sich so dranhängt, und er legt nach.
- ―Ich finde ja...
Er macht eine Pause, sein Kopf, gesenkt, hebt sich, der Blick fixiert den Versagenspunkt mitten im Raum, alle sehen es.
- ―Ich finde das mit den Teufeln nicht korrekt. Ich meine, das ist schon richtig, dass es da steht, aber Kant denkt natürlich nicht im Traum daran, sich so etwas realiter vorzustellen. Wie soll das denn überhaupt gehen? So etwas kann sich nur ein Schwätzer ausdenken, ein Germanist vielleicht, Anwesende ausgenommen. Staat ist Staat, da beißt die Maus kein’ Faden ab. Warum? Weil die Menschen so sind, wie sie sind. Gäbe es nur die Guten, dann gäbe es keinen Staat, weil ihn niemand bräuchte. Es gibt ihn aber. Sorry, Charlie – offenbar redet er jetzt auf das große Marx-Plakat ein, das immer noch Tag für Tag über dem Bücherbasar vor der Mensa entrollt wird –, aber so ist das nun mal. Und deswegen – wahrhaftig, er droht Pw mit dem Finger – braucht der Staat eine republikanische Verfassung. Sonst gäbe es nämlich bald keine Menschen mehr, sondern nur noch Monster... Was weiß ich.
Eine Öffnung, groß wie ein Scheunentor, und Pw drängt nach.
- ―Homo homini homo. Gut, dass du das sagst. Eins muss dir klar sein: das ist die Schmitt-Position. Nein, du brauchst nicht abwinken. Du weißt, was daraus folgt?
Hiero, einen Moment in Verwirrung, weiß es nicht. Eike springt ihm zur Seite.
- ―Er meint, dafür brauchst du keine Republikaner.
- ―Moment mal! Habe ich gesagt, dass ich Republikaner brauche? Ich brauche keine Republikaner. Das ist ja das Kantische Argument. Wer Republikaner braucht, der kann sich doch gleich einpökeln lassen. Es braucht eine Republik, das ist etwas anderes.
Pw, unnachsichtig:
- ―Bist du da so sicher? Und Weimar? Die Republik ohne Republikaner?
Hiero ist wieder im Fahrwasser.
- ―Ich habe doch nichts gegen Republikaner. Das wäre ja absurd. Natürlich muss es Republikaner geben, sonst gibt es eben keine Republik. Ich sage nur: ohne Republik degenerieren die Menschen zu Monstern. Das meint doch nicht, dass alle Menschen zu Monstern degenerieren.
- ―Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Menschen und Teufeln? Jetzt mal ganz im Ernst: Wie stellst du dir das vor?
- ―Naja, wenn ich dich so betrachte...
Ungehörig ist das alles, zutiefst ungehörig. Hiero denkt in Wahrheit nicht so. Aber Pw, der die Situation überblickt, genießt sie. Tronka, erneut an den Rand des Gesprächs gedrängt, muss langsam kommen, und er kommt mit Verve.
- ―Was Sie da eben zu Carl Schmitt sagten, Herr Wichterich...
- ―Sorry, wenn ich einen Kollegen von Ihnen...
Das kam schnell, praktisch unerwartet. Auch Tronka wandelt jetzt im Fieber.
- ―Darum gehts nicht. Kollege, sagten Sie? Habe ich richtig gehört? Sagten Sie wirklich Kollege? Das ist nicht Ihr Ernst, sagen Sie, dass das nicht Ihr Ernst ist. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Strengen Sie sich nicht an. Das ist ungeheuer. Das ist Ihrer nicht würdig. Ich würde mir das vor jedem Forum verbitten. Ich sage nur: Berufsverbot! Der Mann hatte Berufsverbot. Nein, nicht fälschlich oder so, neein, zu Recht! Völlig zu Recht! Wenn man aus dem Sauerland kommt, entbindet das einen nicht davon, die Regeln der Gesittung zu studieren. Und beherzigen! Wir reden hier nicht über Kavaliersdelikte, wir reden hier über Mord, über kaltblütig geplanten und durchgeführten Massenmord...
- ―CS hat niemanden umgebracht!
Eikes Stimme, erregt, atmet Empörung. Auch er ist geprägt wie alle – durch Elternhaus und Lektüre. Gäbe es einen ehrenwerten Konservativismus im Lande, Eike wüsste, wohin es ihn zöge. So wie die Dinge im Augenblick liegen, zieht es ihn sachte ins Ressentiment.
In Momenten wie diesem erweist sich Tronka als Geschäftsträger seiner Generation. Das ist sehenswert, weil er sie sonst verhöhnt. Die Kinder von Teddy und Max finden vor ihm keine Gnade. Aber das hier ist etwas anderes. Et in Arcadia ego. Auch ich bin unter den Wasserwerfern der Polizei zum Manne gereift, sogar mehrfach. Wir sind viele. Wir wissen, wofür wir stehen. Gegen die Vergangenheit. Für die Zukunft. Alles andere wäre ungut.

Ungute Gefühle
Ungut.
Das ist eins dieser Worte, mit denen sich Dinge ohne viel Federlesens ordnen lassen. Tronka und Hiero ziehen da an einem Strang. Beide wissen, was ›ungut‹ ist: ein sonores Gefühl, das in der Bauchgegend beginnt, man merkt, wie die individuellen Grenzen verschwimmen. Doch es gibt Konkurrenz.
Pw setzt das Wort gezielt, aber anders, er punktet damit privat, weil er weiß, dass die anderen Lähmungserscheinungen zeigen, sobald man es in den Mund nimmt. Wenn Pw ›ungut‹ sagt, beschleicht die anderen ein ungutes Gefühl. Aber sie kommen dagegen nicht an. Einmal der Fehllockung gefolgt, es ist niemals gutzumachen.
Oder doch? Eike, der Katholik, ist nicht geneigt, die gebrechliche Menschennatur an Landes- und Geschichtsgrenzen enden zu lassen. Er empfindet, warum auch immer, eine Menschen-Loyalität gegenüber denen, die untergegangen sind in der Flut, auch moralisch. Die Unterscheidung zwischen lässlichen Sünden und Todsünden lässt ihn nicht los, Stunden kann er darüber vergrübeln, das Ergebnis bleibt mager, umso intensiver fallen die Empfindungen aus.
Tronkas Aufgeräumtheit ist ihm im Herzen zuwider. Etwas an ihr ist teuflisch. Man verhöhnt nicht, woher man kommt, selbst dann nicht, wenn sich gute Gründe dafür auffahren lassen. Diese entsetzliche Munterkeit ist eine der sieben Plagen, seinetwegen die achte, wahrscheinlich die schlimmste von allen.
Aber eher würde er sich die Zunge abbeißen, als solche Hintergedanken laut werden zu lassen.
Eike weiß viel. Unter denen, die hier herumsitzen, ist er die Leseratte. Die Bücher wandern durch ihn hindurch, vieles Angelesene sammelt sich in abgedunkelten Ecken, anderes verschwindet unbemerkt von der Lagerverwaltung durch den Hinterausgang des Gedächtnisses. Gelegentlich wundert er sich, dass ein Tronka so wenig weiß. Natürlich weiß er viel, selbstverständlich, verglichen mit den Studenten, alles, was er weiß, ist gleichsam scharfgestellt, vor allem, sofern es in sein philosophisches Spektrum fällt, scharfkantig könnte man es nennen. Das ist es. Wo bei Eike das scharf Umrissene in die sanfte Hügellandschaft des Man-müsste-das-nochmal-Nachlesens übergeht, reißt es bei Tronka einfach ab. An den Rändern beginnt die Show, so wie jetzt, wo das erhitzte Gemüt über die Grenze wabert:
- ―Ah, sie kennen sich in diesem Dreck aus – Gratuliere!
Dagegen lässt sich nichts vorbringen, es sei denn, man will den Stotterer geben und sich vorführen lassen. Seit Jahren wartet Eike auf den Moment, in dem sein verschwiegenes Wissen mit dem subtilen Urteil des Lehrers verschmilzt. Er hat keine Ahnung, dass Tronka ebenso lange Dritten gegenüber seine kostbare Belesenheit rühmt, als habe er ihm diese verantwortungsvolle Aufgabe übertragen und verfüge über einen direkten Zugriff auf die Resultate.
Auch Tronka ist ein Kollektivwesen, zu dem ein handverlesenes Zufallsteam sein Scherflein beisteuert, ohne sich dessen bewusst zu sein. Was Hiero daran fuchst, ist weniger die Sache selbst als Tronkas heuchlerisches Gebaren, das Eikes unstrukturiertes, überdies durch eine zweifelhafte Vorliebe für reaktionäre Autoren besudeltes Bücherwissen wie manches andere zu goutieren vorgibt – mit einem penetrant gütigen Lächeln, das berührt, ohne zu berühren.
Ja, das ist die Formel. In der Sprache des Idealismus könnte man, was sich in Tronkas Wort und Gebaren spiegelt, ein Geschmacksurteil ohne Geschmack nennen. Dumme Phrase. Der Idealismus ist tot, es lebe der Idealismus. Der Ausdruck, wie so viele, gehört ins Repertoire der Selbstdurchstreichungen, aus denen der ewige Volksgenosse hervorblickt – zumindest der ewiggestrige, da wollen wir nicht zimperlich sein. Eine Sprache ist nicht zu haben ohne die Sache. Wenn die Sache nicht mehr zu haben ist, macht die Sprache Bocksprünge. ›Ewiggestrig‹, was ist das? Instinktiv scheut man vor dem Etikett zurück. Es ist der Nazi-Stempel, in welchem Gestern sollten diese Alten schon leben? Gestern ist schlecht, Heute ist gut. Andererseits klebt etwas Seltsames daran, so als würden Nazis, die mit der Zeit gegangen sind, andere bezichtigen, weil sie zurückblieben.
Ein Dialog unter Leuten, die einmal die neue Zeit wollten. Die in der vergangensten aller Welten, als sie so alt waren wie er heute, marschierten, wie es in ihrem Liede hieß, bis alles in Scherben fiel.
Wer zum Teufel mögen damals die Ewiggestrigen gewesen sein? Leute, die sich nicht von ihren zivilen Gedanken verabschieden konnten, denen es den Magen umdrehte, wenn rüde Mitmenschen weniger rüde Mitmenschen fertigmachten? Menschen, aus deren Köpfen die Verschwundenen nicht auf Knopfdruck verschwanden, nachdem man sie aus ihrem Blickfeld entfernt hatte? Die den Exodus der Literaten, der Philosophen, der Gelehrten von Rang nicht verkrafteten? Die es innerlich ablehnten, mobilisiert zu werden?
Vermutlich.
Das also waren sie, die Ewiggestrigen im ewigen Gestern.
Unwahrscheinlich der Gedanke, Emigranten hätten sich damals gegenseitig als ewiggestrig bezeichnet. Ganz schön unbekümmert, die Sprache, gerade an dieser Stelle. Die Sprache allein? Sie ganz allein? So nicht, meine Herrschaften.
Das macht Tronka so beneidenswert: er sagt alles direkt, gleichgültig, ob er sich gerade mit Hegel oder mit Husserl befasst. Leider endet seine Direktheit an den Grenzen des philosophischen Argumentierens. Oder... sagen wir: an den Grenzen der davon nicht ablösbaren Lebensläufe. Aber es gibt andere, über die zu reden hin und wieder gut täte.
Die Davongekommenen. Der Drang, weiter zu leben, muss ungeheuer gewesen sein in diesen Menschen. Ohne ein starkes Motiv hat keiner das Morden überlebt. Etwas war ihnen versprochen worden, von welcher Seite auch immer. Von welcher Seite auch immer. Da war sie: die zweite Chance. Was wussten die Besatzer davon? Das schiere Leben und das gerettete, das versprochene, das verratene und ›noch immer‹ versprochene – damals glitten sie ineinander.
Sie sind noch einmal aufgebrochen. Leben um Leben. Verschwunden: die Diktatur, eine zumindest, und die Lust am Untergang. Geblieben: das Diktat des Neuen. Das Unauslöschliche heißt Stalingrad. Auschwitz, das waren die anderen Toten, die, an denen gesündigt wurde. Stalingrad, das waren sie selbst, als Davongekommene, mit dem eingeritzten Versprechen.
Hiero, uneingedenk der Gegenwart, ächzt. Mechtels Blick stiehlt sich zu ihm hin.
Nicht davongekommen: die Überheblichkeit, der Größenwahn, das Verbrechen. Von ihnen hat man sich leichten Herzens befreien lassen. Nicht davongekommen: die allzu vielen Toten, die auf seltsamen schwimmenden Inseln im Meer der Erwartungen parken, weil die Psyche nicht weiß, wohin damit, abhanden Gekommene, die vielleicht noch immer dort dämmern. Die Toten dämmern, Hiero, hast du das nicht gewusst? Woher solltest du? Das alles liegt vor deiner Zeit. Nur: deine Zeit war auch ihre.
Was blieb? Ein Zucken um Mundwinkel, wenn zu Hause die Rede auf die Toten der anderen kam, der Dagebliebenen und der Verjagten, wilde Szenen im Dschungel der Gesichter, die undurchdringlich wurden und Gefahr spuckten. Zweierlei Zucken. Zwieklang im Einklang. Die Ewiggestrigen sind vielleicht ... Tote auf Urlaub, aber anders, als der anno 1919 exekutierte Leviné das noch meinte. Das Hinrichtungskommando steckt in ihnen. Es kommt nicht heraus, aber bemerkbar macht es sich schon.
Was heißt das überhaupt, in der Gegenwart leben? Zusehen, wie andere mit der Beute davonziehen? Zusehen –

Ein Nichts und ein Übergang
Das tut weh: ausgerechnet Hans-Hajo, der unbegreiflich Abwesende, hat die Lage ›gepeilt‹ und stubst ihn an. Ein Zuseher, kein Durchblicker. Jetzt lacht er ihm fragend-aufmunternd ins Gesicht. Er weiß noch nicht, dass in ihm ein Globetrotter steckt, kurz vor dem Austritt ins Freie. Sie wissen es beide nicht. ›Was ich Sie schon immer fragen wollte...: Wer sind Sie, mein Herr?‹ Aber schließlich sind sie per Du, da erübrigt sich eine solche Frage. Der einzige, dem sie gilt, ist Tronka, aller Augen ruhen auf ihm, dem Genie, dem die Verwandlung zum Professor gelang, auch wenn seine Stelle schlecht dotiert ist, ausreichend jedenfalls, um die Frage nach der Identität
- ―I-den-ti-tät, das sind doch schon drei, hat er Pw geantwortet, als der ihn kürzlich danach frug.
- ―Vier, kam es prompt aus Pws Mund, zu Recht, obwohl er, Hiero, darauf bestand, nicht die Zahl der Silben gemeint zu haben.
- ―Ja was denn dann?
- ―Das mit sich Identische.
- ―Aha. Und was soll das sein?
- ―Sage ich doch. Das mit-sich-Identische. Ich kann es auch dreimal sagen, dann hast du es: die volle Relation.
- ―Das verstehe ich nicht.
- ―Hab ich auch nicht erwartet. Wer versteht das schon. Das ist es doch. Du brauchst das Nichtidentische, um etwas zu verstehen.
- ―Rutsch mir doch den Buckel runter.
Dasselbe könnte Hiero augenblicklich zu Tronka sagen, der ihn flüchtig an den zu anderen Zeiten hier ebenfalls Hof haltenden Steinschwafel erinnert. Etwas Unerträgliches nistet sich ein.
›Schwafel‹, woher kommt so ein Wort? Ein Lautmaler muss es erfunden haben, in einer ruhigen Minute, bei schon trockenem Pinsel.
Schwafelt Tronka?
Was für ein Gedanke. Unsäglich, ein Sakrileg. Die Anwesenheit Luxors hat es möglich gemacht.
Andererseits lässt es sich nicht von der Hand weisen – Pw hat Tronka einen Nasenring verpasst hat und führt ihn vor, so wie jetzt, fast nach Belieben. Aber eben nur fast. Wer ist schon Pw? Eine Null, eine Niete, zu keinem theoretischen Gedanken fähig, jedenfalls, wenn man es recht bedenkt. Natürlich sieht Tronka das. Er lässt ihn gewähren. Das ist bitter genug. Nicht leicht zu verstehen. Er macht sich zum Narren. Ist er deshalb ein Narr? Cave, Hieronyme. Wer wäre wohl der Narr, angenommen, es platzte jetzt aus dir heraus?
Er hat sich vorhin nicht eingeschaltet, auch jetzt wird er es bleiben lassen. Schön bleiben lassen. Dabei wäre so vieles zu sagen. Über Mörder und ihre Handlanger. Er hat ihre Methoden studiert. Hundertmal ist er vor den Gewehren der Sonderkommandos gestanden, hundertmal zusammengebrochen und den Abhang hinuntergerollt, hundertmal hat er sich, Blutgeschmack im Mund, tot gestellt unter Toten. Auch er: ein Ewiggestriger. Gewiss. Aber halt, er hat es aus dem begleitenden Heute, es hat ihn, so wie es die anderen hat, zum Teufel mit der Kapitalakkumulation und den Faktoren, die sie begleiten. Schöne Begleiter sind das. Man möchte sie gern einmal unter die Lupe nehmen, aber da brechen sie weg.
Man sieht nicht genauer, wenn man die Lupe nimmt. Man sieht anderes ungenau. Neben ihm, ein paar Wände weiter, stieren Aktivisten aus dem neueren Gestern ins Leere, basteln aus historischen Dynamiken Papierschiffchen und werfen sie in die Bäche. Einfälle aus dem Drehbuch der Midlife-crisis, hanebüchen. Sie werden in Marx die Gründe nicht finden. Sie werden sie auch in Freud nicht finden. Und Nietzsche, ogottogott. Da sind wir uns doch einig, meine Herren, worauf warten wir noch. Ein Tronka-Satz. Ja, worauf warten wir noch? Du hast dich doch nicht an Tronka gehängt, um jetzt ab... Ja was denn? Spuck’s aus, bevor du daran erstickst.
In gewisser Weise hast du, als du dich mit Kärich prügeltest, Tronkas Urszene nachgespielt. Was war da? Hin und wieder hast du schon im Gedächtnis gestochert, auch gemeinsam mit Pw, der die Geschichte ebenfalls kennt, aber ihr bekommt sie nicht mehr zusammen. Aus den uns dürftig bekannten Zweigen der Kultur blickt überall der ›Kulturlose‹ und ›Primitive‹ durch. Auch Tronkas Anfänge liegen in primitivem Dunkel. Schafft zwei, drei, viele Tronkas... Einer wie Tronka kann die Bühne nicht anders betreten als mit einem Knall. Kein Duell, Herr Nietzsche, nur ein Knall. Wir duellieren uns nicht, Herr Nietzsche. Duell wäre privat.
Wie Tronka jetzt wuselt, erklärt, die Hände anhebt und ineinander schiebt, die Stimme seriös, das heißt ein wenig nach Reibeisen klingen lässt, gelingt es ihm mühelos, in jedem von ihnen wieder das vertraute Katakomben-Bewusstsein hochzukitzeln. Pws Auge glitzert, zwei Finger der rechten Hand umgreifen spielerisch den Filz, auf dem das Bierglas steht, sein Oberkörper ist leicht gedreht, Tronka zugewandt, den Kopf hält er leicht gesenkt. Mechtel spielt stilles Wasser, teilnahmsvoll nichtteilnehmend, Hans-Hajo wirkt, als habe er einen wurzellangen Gedanken gefasst und ziehe daran, bis er umfällt. Eike sieht alles, hört alles, hält sich bedeckt. Nur Antons Anblick verrät die Sehnsucht nach Weite, vielleicht schwingt er sich gerade auf eine Kawasaki und steuert vorsichtig, voll vibrierender Unruhe, in Richtung Autobahn. Ahnen sie, dass Tronka sich neuerdings langweilt? Dass ihn eine Ahnung durchschweift, er könne hier fehl am Platz sein? Es ist nicht seine neue Existenz in der Pyramide, die ihm diese Empfindung eingibt. Im Inneren der Pyramide tritt sie sogar verstärkt auf. Wenn er mit dem Ruf auf die Professur die vielfältigen Facetten seiner Person zu einer zusammenführen wollte, so ist ihm das gründlich misslungen. Sie treten nur stärker auseinander und fangen an, sich gegenseitig zu verdächtigen.

Golgatha
Ein Schatten davon fiel mir aufs Gemüt, als ich das Spiel seiner Hände betrachtete, während das Gespräch – was jetzt häufiger vorkam – an ihm vorbeilief. Was immer man sich unter Denkerhänden vorstellen mag, diese hier waren breit und fleischig, von einer hektischen Farbigkeit, als probten sie, ganz für sich, schon einmal künftige Schlaganfälle. Er hatte sie nicht versteckt, sie lagen auf dem Tisch wie zwei durch eine unsanfte Bewegung ans Tageslicht beförderte Maulwürfe: Sie sehen nichts, sie hören nichts und sie wissen doch, dass es da ist und dass es sie sieht.
Tronka, das wusste ich längst, neigte dazu, sich unwohl zu fühlen. Nicht bloß unter Menschen, aber dort verstärkt. Lange Zeit hatte der Pfau ihn, wenigstens auf eine Stunde oder zwei, von diesem Fluch befreit. Das scheint passé zu sein. So wie er der Runde vorsitzt, weiß er bereits, dass die Erlösung im Fleische, an der ihm so viel liegt, unwiderruflich an ihm vorbeigehen wird oder schon vorbeigegangen ist, gleichgültig, welche ›Kernbereiche‹ sein Denken noch auszuweisen gedenkt. Es ist das Los dessen, dem Wissenschaft zum Beruf geworden ist. Die Philosophie wissenschaftsförmig zu machen, sie wissenschaftsförmiger zu machen, als er sie vorgefunden hat, betrachtet er als sein eigenstes Aufgabenfeld.
Nicht ohne persönliche Neigung, das ist wahr. In ihr zeigt das Talent, das seit den Anfängen in ihm geschlummert hat, sein freundliches Gesicht. Das Arbeiten an den Sachfragen liegt ihm, es geht ihm leicht von der Hand. Jedenfalls sagt das seine Erfahrung, soweit er zurückdenken kann. Das Buch, an dem er arbeitet – es ist jetzt nicht mehr das zweite nach der Dissertation, es ist das dritte Buch, aber ebenso sehr das eine, das sich fortschreibt, seit er am Schreibtisch sitzt –, führt ein Eigenleben, an dem er nur indirekt beteiligt ist, als ausführendes Organ.
Darin steckt ein Widerspruch, den er sich nur manchmal vergegenwärtigt. Dieses Buch, zweifellos ein Embryo, dem das eigentliche Leben erst bevorsteht, lebt in ihm, genauer, in seinem Bewusstsein, das sich für diese Aufgabe hergibt, Brocken für Brocken, sich dafür auch aufgibt, denn ohne partielle Bewusstlosigkeit ist diese Art von Konzentration nicht zu erreichen. Andererseits ist jedem Bewusstsein Bewusstlosigkeit inhärent. Bewusstsein tendiert zur Bewusstlosigkeit, nicht, weil es auf etwas gerichtet ist, sondern...
Aber vielleicht ist ›gerichtet‹ gar kein so schlechter Ausdruck. Schreibend befindet es sich jenseits des Weltgerichts, was immer dieser unvollkommene Ausdruck bedeuten mag. Er ›würde das nie so ausdrücken‹: ein seltsames Geständnis gegen sich selbst, da er es im gleichen Moment ja so ausdrückt. Aber was wiegt schon der Ausdruck angesichts eines Gedankens, der unnachdrücklich bleibt, der sich im Entstehen bereits auflöst, vom Ende her wie vom Beginn. Ein Gedanke, der nirgendwo aufbricht, um nirgendwo anzukommen. Allein die begleitende Vorstellung, schreibend die Schwelle zu überschreiten, sie überschritten zu haben und damit gerade jetzt, im Moment der Niederschrift, zu den Entronnenen zu gehören, ist leise, aber konstant.
Wo steckt dann der Widerspruch? Er betreibt ja nicht gerade seine Aufnahme in die Gemeinschaft der Heiligen. Diese Interpretation würde er immer bestreiten, er würde ihr auch den Status einer Interpretation bestreiten, mit allen Mitteln, erlaubt und unerlaubt, in diesem Fall ist der Weg das Ziel. Das Leben soll keine Macht über das Denken haben, zumindest nicht das eigene. Diese Verpflichtung auf die Kontingenz des je eigenen Seins ist schwer zu begreifen und noch schwerer zu praktizieren. Andererseits ist sie das Gegebene und versteht sich ohnehin, sie wirft sich gewissermaßen in Posen, sobald man sich ihr in Gedanken nähert, die einfach unwiderstehlich sind. Dieser stets leicht geöffnete, gleichsam atmende Spalt, durch den die Wissenschaft den Einzelnen aufnimmt, fordert radikale Immanenz und er erhält sie, spielerisch, mit den Mitteln der Negation.
Wissenschaftler sind Diener der Negation und sie wissen es. Ihr Leben vollzieht sich im Akt des Differenzierens, einer rasch durchlaufenen Folge von Abweisungen, durch die das Denken ins Offene vorstößt. Die Summe der Vorstöße ergibt kein Kontinuum, weder die einfache Reihe noch eine komplexer gedachte Ganzheit. Sie formen kein Einzelleben. Im Gegenteil, sie sprengen es jedesmal aufs Neue in die Luft.
Ein Normalwissenschaftler kommt damit bestens zurecht. Es ist sein Beruf, dem zuliebe er jeden Morgen die Tasche packt und von dem er sich abends wieder nach Hause verzieht. Mag sein, dass er das Leben im Kreise der Seinen beschließt und die Wissenschaft einfach vergisst, so wie sich ein Arbeiter sein eigentliches Leben mühelos anhand von Urlaubsfotos vergegenwärtigt und die tausendundeinen Handgriffe am Fließband bereits vergessen hat, während er sie noch ausführt.
Ein Tronka kann nicht vergessen, er lebt durch Diskontinuierung, er lebt diese Akte, der Rest ist Tingeltangel, freie Zeit, ein Tribut an die Maschine, die geölt, gewartet, wieder hergestellt werden muss. Gerade darin ist er er selbst. Ein Widerspruch? Wenn ja, muss er damit leben. Aber was heißt das? Ist das eigene Leben doch das Umgreifende? In einem gewissen Sinn: ja. Das je eigene Leben ist das Banale. Dasein ist banal, ganz offensichtlich, es versteht sich von selbst, man hat wenig verstanden, wenn man es versteht.
Ein seltsamer Unheiliger präsidiert da, ein Heiliger der Immanenz, der radikalen Vereinzelung, die ›nichts zur Sache tut‹, einer, der von sich abzusehen gelernt hat und sich seit einiger Zeit von der Würde eines Amtes durchströmt oder vielleicht nur angeweht fühlt, das er immer, in besinnungsloser Direktheit, angestrebt hat, ohne es zu wollen. Zum Teufel, er hat es nun einmal und die jungen Leute säßen nicht da, ruhte das Amt nicht im Hintergrund wie der geschlossene Umriss einer Pyramide.
Sie sitzen aber auch da, weil sie ihm zutrauen, dass er das Amt negiert, wie er es in seinen Anfängen immer negiert hat. Es reicht nicht, dass er lächelnd die Würde beiseitezusetzen weiß. Von ihm verlangen sie Hohn, offenen, ehrlichen, vollständigen Hohn, der zwischen Geltung und Amtsbonus bedingungslos unterscheidet. Auf diesem Nadelkissen wollen sie ihn sehen. Sie wissen recht gut, dass er sich mit jeder Andeutung einer Bewegung einen neuen Stich einfängt. Gerade das wollen sie sehen. Ein Schauspiel, aber, ach, ein Schauspiel nur. Nun, er ist keine Theaternatur, und wenn er ein Schauspiel bietet, dann ist auch das kontingent oder sagen wir besser: nicht der Rede wert.
Dasein heißt sich entziehen. Vielleicht ist das die einzige nicht triviale Lösung des Daseinsproblems, jedenfalls für einen wie ihn. Der Gedanke geistert in ihm, seit Pw mit dieser leisen Emphase, deren Geheimnis er ihm gern abkaufen würde, den etwas abgegriffenen Satz ›Frei sein heißt sich entziehen können‹ in den gemeinsamen Zitatenschatz gelegt und er nach einem kurzen Zögern zugestimmt hatte. Der Satz könnte auch auf ihr Stalingrad-Gespräch gemünzt sein, doch offenbar findet es niemand lustig, ihn jetzt herauszuholen.
Für die Jungen da hieße Dasein also, sich entziehen zu können. Er selbst wäre so etwas wie ein Garant dieses Könnens, ein Fels in der Brandung, einer, der ihnen Woche für Woche vorführt, wie so etwas geht. Aber vielleicht wollen sie sich selbst gar nicht entziehen. Vielleicht brennen sie insgeheim darauf, eine Aufgabe zu übernehmen und wollen sehen, wie einer wie er scheitert. Dieser leise gefühlte Dissens mit Hiero – den er längst in Gedanken so nennt, auch wenn er ihn immer mit seinem bürgerlichen Namen ansprechen würde – hat schließlich hier seine Ursache, jedenfalls dann, wenn man den verschiedenen Stimmen, die sich in diesem Fall mischen, lang genug zuhört.
Als einziger aus der Runde besteht Hiero darauf, dass er, Tronka, sich nicht entzieht. Dafür gibts einen guten Grund. Zu Recht betrachtet er sich als seinen Schüler. Er ist der einzige, der seinen theoretischen Ehrgeiz begriffen hat, etwas, das er ihm einfach nicht absprechen kann, auch nicht absprechen will, erstens, weil es wohl stimmt, und zweitens, weil es so unendlich wohltut. Warum sollte er die Wahrheit bestreiten? Er muss sie ja nicht einmal zugeben.
Die Überführung des von ihm Erdachten in ein von anderer Seite Begriffenes ist notwendig und sie muss vollzogen werden. Das ist für seine Theorie – oder, wie soll er sich da ausdrücken, in ihrem Rahmen – sogar wesentlich: die instabile Stabilität der Begriffe, ihr lebendiges Übergehen in immer neue und jeweils andere Verbindungen und Ausarbeitungen, in denen andererseits ein Kern erhalten und sogar gesichert werden kann und wirklich gesichert wird, der aus der toten Wiederholung immer derselben Formeln einfach verschwindet, verdampft, entweicht, verlangt nach dem Wechsel der Darstellung, der perspektivischen Neuerschließung und sogar dem Wechsel in der Darstellung. Gerade darin ›kommt‹ das schöpferische Geheimnis der Fortentwicklung ›zum Tragen‹. In diesem Punkt allerdings bleibt er skeptisch. Ist Hiero der Mann, seine Gedanken fortzuentwickeln? Traut er ihm das zu?
Die Frage, offen gestellt, müsste Hiero unendlich kränken. Gerade das bestimmt sie zum Schlüssel. Hiero, ahnungslos, verdeckt sie sich durch die freundlichen Züge des Meisters, hinter denen sie brodelt. Für ihn ist die Entscheidung, die er getroffen hat, frei von Willkür. Diese Theorie enthält seine persönliche Freiheitsgeschichte, sie wiegt die Enttäuschung durch die dogmatischen Fassungen des Freiheitsbegriffs auf, denen er bei Bartosz und anderen begegnet ist und von denen ihn keine festhalten konnte. Diese hier hält ihn fest, weil sie ihn nicht festhält, weil sie das ›eigene Denken‹ nicht in eisernen Formeln beschwört und mit dem Elan einer Betreuerin einfordert, sondern in seiner vollen Unumgänglichkeit zeigt. Nicht die Forderung, den eigenen Denkapparat zum Zweck des Mitmachens einzuschalten, diese geradezu physisch widerwärtige Aufforderung ungeduldiger Gymnasiallehrer, die insgeheim an ihrem Beruf verzweifeln, sondern die Formel vom Denken selbst als lebendiger Gedankentätigkeit hat ihn erreicht und umgemodelt – Saulus zu Paulus, den bereits im Umriss geahnten sozialistischen Kämpfer zum künftigen bürgerlichen Philosophen und Denker.
Einer wie Tronka werden heißt also wesentlich über ihn hinausgehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. In dem Punkt ist Hiero ganz unbefangen. Nirgends weiß er sich mit seinem Vordenker so einig. Es kann gar nicht anders sein. Dass die Anton, Eike, Pw just an dieser Stelle nicht in Betracht kommen, kratzt ihn nicht weiter, es ›ist keine Frage‹. Schließlich kennt er seine Pappenheimer.
- ―Schönschön. Sollen sie doch sehen, wie weit sie kommen.
Doch allein der Argwohn, mit ihnen in der Sache konkurrieren müssen, würde ihn bitter kränken.
Blind gegen das Innenleben der anderen, das, seit ihre Chancen schwinden, die rettende Stufe noch zu erreichen, nur höher schlägt und einen Zug ins Boshafte annimmt, mag Hiero sich einfach nicht vorstellen, dass Tronka mit seiner Haltung, die sich in vielen Kleinigkeiten verrät, seine Schwierigkeiten haben könnte. Er kann sich keinen Reim darauf machen, warum Tronka ihn auf leise demütigende Weise zu niederen Arbeiten heranzieht, die natürlich erledigt werden müssen, warum er ihn im Gespräch geflissentlich übergeht oder willkürlich mit nichtssagenden Bemerkungen abspeist, warum er sich gegenüber seinen Plänen ausgesprochen wortkarg gibt und ihn mit seinem Thema auf eine atemberaubende Weise allein lässt. Umso stärker empfindet er den lebhaften Kontrast zu der Umgänglichkeit, die Tronka gegenüber den anderen an den Tag legt und die sich allmählich doch sehr unterscheidet von den schroffen Inszenierungen vergangener Tage.
Gerade jetzt – Hiero mag gar nicht hinsehen, so sehr wurmt es ihn – hat Pw ihn vor versammelter Runde in ein Privatgespräch gezogen, sie unterhalten sich, unter reichlicher Verwendung jener kehligen Männerlaute, auf die sie sich irgendwann verständigt haben, halblaut über die Berufungspolitik einer entfernten Fakultät, an der Pw zufällig jemanden kennt.
- ―Es wird schon nicht der Hausmeister sein.
Hiero wundert sich über die eigene Bissigkeit. Der unverwandt lauschende Eike hat die Bemerkung gehört, er hebt den Kopf und zwinkert ihm zu.
Nein, Hiero kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, warum Tronka plötzlich gegen ihn voreingenommen sein sollte, während er selbst bereits von Voreingenommenheit strotzt. Wie die Dinge stehen, ist der Vordenker Tronka ohne den Menschen Tronka nicht zu haben und dieser Mensch ist ihm Stück für Stück abhanden gekommen, seit er ›sein Mann‹ ist. Das ist ein Faktum. Als solches entzieht es sich aber, wird zur Schimäre und muss, wie die Theorie es befiehlt, deutend erschlossen werden.
Gerade das lehnt Hiero entschieden ab. Tronka mag so schwierig sein, wie er will – was sie verbindet, ist die Sache und nichts als die Sache. Wollte er hier Kompromisse schließen, so befände er sich bald auf einem Kurs mit Pw, der sich offen, sobald die Situation es hergibt, in Mutmaßungen über Tronkas Lebenslügen ergeht und schon einmal den Satz aufgestellt hat, der einerseits alle frappiert, andererseits offenbar einmal ausgesprochen werden musste: Er könne nicht glauben, dass gerade er während seines Studiums einem Genie über den Weg gelaufen sei.
Man will, wenn man ihn sieht, es wirklich kaum glauben. Und gerade er ist es, der Woche für Woche Tronka am Nasenring nimmt und ebenso ungerührt wie selbstverständlich zum Tanzen bringt.
Warum ich?
Wer immer sich diese Frage heimlich stellt, Hiero gehört nicht dazu. Die anderen, Tronka eingeschlossen, wissen es wohl, aber sie sehen darin kein Anzeichen von Erwählung, sondern einen Makel. Die Gleichaltrigen haben sich nach und nach an sein Selbstwertgefühl gewöhnt und sind, wenngleich mit Abstrichen, bereit, es zuzulassen – hier liegt auch der Grund, warum sie Tronkas Wahl, allem Gift zum Trotz, das sie in die Beziehungen bringt, im Grunde ihrer Seele billigen. Tronka hingegen, allmählich aus der verjährten Überraschung, einen Schüler zu besitzen, erwachend, konstruiert es immer entschiedener als Ärgernis. Dass er sich damit selber zum Ärgernis macht, dieser doch recht einfache Gedanke findet in ihm keinen Raum. Auch das ist verständlich, denn damit müsste er sich in Frage stellen – eine wohlfeile Formel dieser Jahre, in der die ein paar Kilometer östlich geübte Praxis der Selbstanprangerung irrlichtert, ohne jemals beim Namen genannt zu werden. Tronka, der vorgibt, von den Ideen der Studentenrevolte nie anders als negativ berührt worden zu sein, und es im gleichen Zug selten versäumt, die eine oder andere ultralinke Position zu beziehen, um zu zeigen, dass er an dieser Stelle gut durchgelüftet sei, besitzt ein ausgeprägtes Gefühl dafür, was es heißt, in seiner ›bürgerlichen Existenz‹ in Frage gestellt zu sein. Wie jeder Amtsinhaber verdankt er seine Posittion einer Kette von haarsträubenden Zufällen, zu deren auffälligsten Gliedern die erlittenen Demütigungen zählen. Über ersteres kann er sich lachend verbreiten, das zweite verschweigt er.
Gerade hier scheint eine neue Demütigung heranzuwachsen. Wollte er sich Pws bestechend einfacher Formel bedienen, die er zu seinem Glück nicht kennt, so müsste er den statistisch weit unwahrscheinlicheren Fall gelten lassen, sich im Kreuzungspunkt zweier Genies zu bewegen. Damit nicht genug, müsste er obendrein annehmen, seine eigene Bahn sei dazu auserkoren, die des zweiten ›maßgeblich‹ zu beeinflussen. Soviel Zufall macht schwindlig, der statistisch geschulte Blick sagt laut und vernehmlich nein.
Sonderbarerweise redet Tronka nicht ungern über solche Konstellationen, wenn es die Ausübung seines Amtes nahelegt. Sie tragen viel zur Emphase bei, die das Fach zu seinem Überleben benötigt wie die katholische Kirche das Weihwasser. Und nicht nur das. Im hochstufigen Betrieb, an den patentierten Originalorten der Geistesgeschichte, zwischen Mauern, die einen Fichte oder Hegel oder Cassirer oder Dewey beherbergten, bereitet es den Akteuren keinerlei Schwierigkeit, sich gegenseitig Bedeutung in jeder beliebigen Dosierung zu attestieren. Es gibt sie also, die Konstellationen, und das Fachgespräch lebt davon, sie anzusprechen und unter theoretischen Vorwänden aller Art auszubeuten.
Was allerdings Tronkas Selbstbeschreibung angeht, so entzieht sie sich jener leicht zu durchschauenden Mechanik bereits seit Jahren. Er hat den Sumpf in sich trockengelegt, weil er ihn an der eigenen freien Bewegung hinderte. Selbstsein heißt, die Täuschungen des Betriebs zu durchschauen und das System der wechselseitigen Kreditierungen außer Kraft zu setzen. Das hat er früh verstanden und es gibt für ihn kein Zurück. Dass er den Kreis gelten lässt, der sich locker um ihn geformt hat, wundert ihn selbst und vermittelt eben deshalb ein warmes Gefühl.
In diesem Mikroversum besetzt Hiero die Rolle des braven Soldaten, dem man Aufträge erteilen kann, teils, weil man sicher sein kann, dass er sie ausführt, teils, weil er, anders als die anderen, offenkundig nach einem Auftrag lechzt. Nun, da er den einen Auftrag übernommen hat, zu dem alle anderen nur den Vorlauf bildeten, stellt sich heraus, dass er ihn nicht ausführen kann, ohne ihn, Tronka, praktisch täglich in die Pflicht zu nehmen. Nein er belästigt ihn nicht mit Anrufen, das wäre ja lächerlich und ließe sich leicht abstellen, er blockiert ihn auch nicht mit Anfragen, die, wenn sie doch kommen, von Tronka gern beantwortet werden, da er den feedback schätzt und als notwendigen Teil seines Berufes begreift. Eher verhält es sich umgekehrt: gerade die alles in allem wortkarge Koexistenz mit einem Noch-nicht-Genie, das seine Existenz an der eigenen nährt, um sie im entscheidenden Moment der Selbstformierung von sich zu stoßen, erweist sich mehr und mehr als unerträglich.
Mehr und mehr? Was will das heißen? Will es überhaupt etwas heißen? Man muss solche Ausdrücke auf die Folterbank legen, bevor sie ihre Bedeutung preisgeben, auch dann nur mit zusammengebissenen Zähnen, fast unhörbar und immer auf dem Sprung, sie zurückzunehmen, sobald Druck und Zug nachlassen. Also gut: es heißt ›immer wieder‹, jedenfalls dann, wenn letzteres bedeutet, den Zyklus ein ums andere Mal zu durchlaufen, der sich zwischen dem angenehmen Kitzel, alles möge so sein, wie die anhängige Existenz des anderen es glauben machen will, und der verdrießlichen Empfindung spannt, in Räume und Rollen hineingenötigt zu werden, die man bisher geflissentlich gemieden hat.
Denn so steht es: Tronka, der Illusionen verabscheut, ist nicht bereit, der phantastischen Selbstsicht des anderen ein Jota zu opfern. Er blockiert ihn, aber nicht so sehr, weil er ihm hinterrücks jeden Kredit verweigerte. Er blockiert ihn aus dem einfachen Grund, weil er sich selbst bereits als den unwahrscheinlichen Fall konstruiert hat, neben dem das Universum der Geläufigkeiten seinen ehernen Gang geht. Kein Tronka, kein Hiero. Wird Hiero gestrichen, strebt die Waage mit Tronka steil in die Höhe. Beleg: Hiero. Schon wächst Hieros Gewicht. Etcetera etcetera. Und da niemand ein zweites Mal in denselben Fluss steigt, treibt dieses Immer wieder ein Rad der Verwandlungen, in dem die andere Seite ihm langsam, aber sicher unerträglich wird. Das Unerträgliche ist der pur zu gewinnende Stoff, der im Zielpunkt ihrer beider Anstrengungen liegt. Durch die Gewöhnung leicht gemacht, weiß die Empfindung, dass sie vergehen will, dass hinter ihr andere warten, die gelebt werden wollen, und fordert, wedelnd wie ein Hund, der in den Augen seines Herrchens die Mordabsicht blitzen sieht, die Treue der Person.
Hiero weiß. Er weiß und weiß nicht, seine Augen sind weit offen und fest geschlossen, dazwischen gibt es nichts. Er kann nicht durch die Finger sehen, nicht in einer Frage, in der es um Sein oder Nichtsein geht, er kann nicht lavieren, während er doch Tag für Tag nichts anderes macht. Er könnte zum Beispiel aufstehen, Müdigkeit vorschützen und nach Hause gehen. So etwas kommt vor, aber spärlich. Anton nimmt sich die Freiheit gelegentlich, Eike sehr selten, immerhin, der Effekt prägt sich ein. Aber er bleibt die Ausnahme.
Ein Bann liegt auf allen, die dazugehören, das wöchentlich zwischen einer rundlichen Heilandsfigur, einem an den Schwerenötern der Leinwand geschulten Versucher, einem allmählich ausfransenden Lieblingsjünger und etlichen wackeren Getreuen ablaufende Mysterienspiel nicht zu verpassen. Hier zählt jedes Wort und jedes Wort zerfällt zu Staub, wenn nur ein einziges fehlt, und sei es das letzte, ein ironischer Nachsatz, eine flapsige Bemerkung oder das sauber artikulierte, mit leicht gehobener Braue gesprochene ›Das wars‹, in dem das ihnen von Kindesbeinen an geläufige ›Gehet hin...‹ anwest, um es in der Sprache des Philosophen zu sagen, denen ihr ritueller Lieblingshohn gilt.

Die Grenze
Das Badewasser, niedriger als alle Realität, steigt rauschend ins Gehör, seine lethargisierende Wirkung flaut rapide ab. Langsam, mit sanfter Energie, in der einige Hohnpartikel schwimmen, spült es ihn an die Wahrnehmungsoberfläche zurück. Wieso Oberfläche? Welche Fläche ist da gemeint? Man blickt nach außen, man blickt nach innen, soviel ist durch das Bild festgelegt. Doch festgelegt erscheint auch diese Oberfläche, auf die man nur von außen blicken kann, wenn die Rede irgendeinen Sinn haben soll.
Die Oberfläche des Bewusstseins... So sagt man, kein Zweifel, man blickt auf die Oberfläche des Bewusstseins und findet sie bewegt und spannungsreich oder glatt und schläfrig oder innerlich gespannt. Hiero kann sich nicht erinnern, jemals auf die Oberfläche seines Bewusstseins geblickt zu haben. Es wäre schön, einen solchen Blick frei zu haben, natürlich, andere scheinen überhaupt öfter frei zu haben, aber in diesem Fall dürfte einiger Zweifel angebracht sein.
Auf der Oberfläche des Bewusstseins, so sagt man, spiegeln sich die Dinge, sie spiegeln sich nicht hart und eindeutig, sondern gewinnen eine Tiefendimension, die ihnen selbst nicht eignet – so sagt man und versteht, ohne ein Wort darüber zu verlieren, das Innen als Tiefe, außer man ist Nietzscheaner und versichert, sich treuherzig selbst widersprechend, da drinnen sei gar nichts außer dem berüchtigten Willen zur Macht, eine öde Maschinerie, deren eine Interpretation vielleicht ›Stalingrad‹ heißt, deren andere möglicherweise Miriam oder Tronka oder Heide oder Hiero – sicher auch er, wenn er gewissen Andeutungen aus seiner Umgebung glauben darf. Ganz sicher Pw, der zugleich ein gutes Beispiel bietet, wie wenig zielführend ein solcher Wille sich gelegentlich darstellt, wenn das Ziel denn existiert, woran Zweifel erlaubt sind.
Ein Gedanke, der die Massen ergreift, ist Macht, das, immerhin, steht außer Frage. Aber er ist auch und vor allem Gedanke und kein Tropfen einer unbekannten, von Chemikern zu isolierenden Substanz, die sich in den Organen des Bewusstseins befindet und dort ihr Unwesen treibt, ein gewaltiges Unwesen, das die Menschen zusammentreibt wie Vieh und dafür sorgt, dass sie nicht leben wie das Vieh, sondern wie... Menschen eben, was soll man dazu schon sagen. Abwegig diese Idee, alles hinter dem Bewusstsein zu suchen, was man dann im Bewusstsein zu finden hofft, zweifellos zeugt sie von einer gewissen Überforderung, genauso wie die Floskel von der Oberfläche des Bewusstseins, die keiner aufzulösen, die keiner zu denken imstande ist, obwohl sie nicht aufhören, sie zu wiederholen.
Hiero betrachtet seine zittrige Hand. Er zieht sie eigens unter dem Schaum hervor und mit einem Mal gliedert sich ihm das Motiv. Das Zittern, diese unentwegt lebensbegleitende Wiederholung ein und desselben Ausschlags, zeigt die einzige Art Zukunft an, die er als Mensch mit sich trägt, etwas, was über das Dasein des Organismus und seine unausweichlichen Konsequenzen hinausgeht. Ein Geselle, der ihn nicht verlässt. Ein Geselle... Warum sind Wörter wie dieses, die aus einer langen Vergangenheit stammen, binnen weniger Jahre veraltet? Sie nennen den Vorgang, dessen Zeugen sie sind, Bewusstseinswandel, aber welches Bewusstsein ist hier gefragt und welcher Wandel? Das Kollektive dieses Bewusstseins, die gemeinsame Ausrichtung nach der Nadel, bereitet ihm Unbehagen. Es ist was dran, zweifellos ist was dran, man gewahrt es allenthalben, aber nur Leute, die dem Verhängnis, das darin liegt, um jeden Preis entfliehen wollen, können die Idee bei sich hegen, Bewusstsein sei etwas Kollektives, eine Art Kuchen, von dem jeder seinen Teil abbekommt, ob er ihm schmeckt oder nicht.
Eine pervertierte Idee, zweifelsohne, eine pervertierte Idee für eine perverse Praxis. An dieser Praxis der Bewusstseinserweiterer und Bewusstseinsveränderer, in die er früh hineingeglitten ist, willenlos und lange Zeit bereit, sie als die seine zu betrachten, hat er viel gelitten. Wenn sein Bekenntnis zur Philosophie eine Art Engagement ist, dann aus einem einzigen Grund: er will, wie andere vor ihm, zeigen – und beweisen –, dass die unendliche Manipulierbarkeit im Bewusstsein selbst eine Grenze findet. Im Bewusstsein selbst, also nicht im Beitritt zu einer Partei oder einer Bewegung, die die sich fein heraus glaubt, weil sie das Ende der Manipulationen auf ihre Fahnen geschrieben hat. Ein solches Ende gibt es nicht, kann es nicht geben. Wer es ausruft oder ›anmahnt‹, ist bereits unter die Manipulateure gegangen. Zweifellos weiß so einer, wovon er redet, er weiß es aber nicht wirklich, er ist nicht über Modebegriffe hinausgekommen und glaubt an einen Schalter im Kopf, mit dessen Hilfe sich die vielen Einzelnen in Gang bringen ließen, so wie man ein Fahrzeug durch das Umdrehen eines Schlüssels in Gang setzt.
Aufklärung ... ein großes Wort. Nein, er will die Menschen nicht aufklären. Aufgeklärtheit ist der Zustand, in dem man sie großenteils bereits vorfindet, und selbst ein Teil des Problems, vielleicht das Problem an sich. Denn diese Aufgeklärtheit ist wie eine Schicht, die sich über die feine Öffnung legt, die von den Gedanken frei passiert werden muss, wenn von Denken überhaupt die Rede sein soll, und nur im Denken wird jene Grenze ... nein, nicht sichtbar, das wäre ein zu starkes Wort, dem keine Wirklichkeit entspricht, auch nicht ›fühlbar‹ – eine Metapher, mit der man dem herrschenden Sensualismus zu Willen ist, um sich dafür einen Haufen alberner Belehrungen einzufangen –, sie wird auch nicht ›denkend erfahren‹, wie die Floskel der Berufsdenker lautet. Aber sie wird passiert, hin und wieder, immer dann, wenn es gelingt, dem bereits Vorgedachten ein Schnippchen zu schlagen. Man muss wissen, dass es sie gibt und dass sie sich passieren lässt. Mehr daran ist nicht erfahrbar, Denken ist doch keine Befindlichkeit, so zu denken wäre eine entsetzliche Dummheit, deren Folgen auf das ganze Leben ausstrahlen.
Miriam zum Beispiel lebt in Befindlichkeiten. Was sie nicht fühlt, das hat für sie keine Wirklichkeit. Sie hat nichts davon, wie sie sagt.
- ―Und was hab’ ich davon?
- ―Nichts. Alles. Was hast du vom Leben? Was hast du vom Universum? Was hast du von der Blume dort auf der Fensterbank?
- ―O, die Blumen, ich muss sie unbedingt gießen.
Es ist dieses ›unbedingt‹, mit dem sie seine Existenz annulliert hat, übrigens ohne wirkliche Feindseligkeit, zu der sie ohnehin nicht sehr neigt, es sei denn, etwas stellt sich zwischen sie und den Gegenstand eines Wunsches, der von einem Moment auf den anderen in ihr aufkeimt. In solchen Augenblicken kann sie sehr sehr böse werden, eine Raubkatze, wie Hiero sie im Stillen nannte. Die studentische Bewegtheit steht ihr gut, die frenetische Stimmlage, mit der sie das ›Schweinesystem‹ in die Schranken fordert, erinnert ihn an seine erst kürzlich vergangenen Anfänge, die bereits unendlich weit zurückliegen, und wenn sie die ›Revolution jetzt‹ fordert, dann denkt er mit Schaudern daran, wie teuer sie beide eine mit ähnlicher Verve geforderte Garderobe käme.

Pass auf!
Sie forderte nicht unbedingt lautstark, gelegentlich sogar eher beiläufig, als sei da noch ein Haushaltsposten zu erledigen, über den sie sich jetzt aber nicht weiter verbreiten wolle, nachdem er Gegenstand so vieler nächtlicher Diskussionen gewesen war. Solche Diskussionen gab es, es waren die, in denen ihr Hiero Paroli geboten hatte.
Dieser Hiero war kein Revolutionär mehr, falls er es denn jemals gewesen war. Auch das bezweifelte er inzwischen, wenngleich er sich gelegentlich schmunzelnd an diese ›Phase‹ erinnern ließ. Was war er dann? Ein Angepasster, den der Marsch durch die Institutionen stärker anzog als das etwaige Resultat? Oder einer, der nur am Resultat interessiert war?
Aber angepasst waren schließlich die anderen, damit zufrieden, Träger eines Kollektivbewusstseins zu sein und es wie einen Baldachin, der gelegentlich an der einen oder anderen Seite einknickt, weil der Weg steinig ist und die Aufmerksamkeit niemals ungeteilt, schwankend über Felder und Wiesen tragen. Eindruck macht eine solche Prozession schon, sie verwandelt das Innere in ein Äußeres oder ›etwas in der Art eines Äußeren‹, um es im wundervollen Idiom der sprachanalytischen Philosophie zu sagen, von dem man sich gern die Sprache demolieren lässt, solange es nur ein geselliges Lächeln ins Gesicht zaubert. Eine solche Katholikin der ausgebliebenen und in die Langzeiterwartung entrückten Revolution war Miriam. Nicht, weil sie für ein besseres Leben glühte, sondern weil sie den Hebel darin nicht übersah, den kleinen, überaus wirkungsvoll zu gebrauchenden Hebel, der seinesgleichen automatengleich in Bewegung setzte. Jedenfalls macht er sich heute darüber keinerlei Illusionen mehr. Ein verrücktes Huhn wollte sie sein, wenn sie ›alles jetzt‹ forderte, eine großartige Regisseurin ihres Lebens. Wirkungsvoller als jede Schauspielerin konnte sie so auf das Leben der anderen zugreifen, darunter auf seines. Immerhin scheint sie im Rückblick darin besser gewesen zu sein als Tronka, den offenkundig ähnliche Neigungen bewegen, angefangen von jener Urszene, die sich nur in Andeutungen erhalten hat und, zerstückelt und abgeblasst wie sie ist, kaum wiederzugeben ist.
Dass die ernst zu nehmende Philosophie ’33 geschlossen ins Exil ging, verjagt, zerstückelt und ausgeteilt an die des transzendentalen Gedankens bedürftigen Völkerschaften der westlichen Hemisphäre, nicht zu vergessen Australiens, Neuseelands und Papua-Neuguineas – ein solcher Satz, vom Podium einer Tagung mit dem Stakkato der aufgebrachten Jugend heruntergeschmettert, dürfte Steinschwafel seinerzeit kaum geschmeckt haben, angesichts seines eigenen Lebenslaufs nicht und überhaupt. Sicher hatte er ihn mit der ganzen Autorität des Älteren pariert. Lag hier die Herausforderung an das System? Allerdings hatte er dem Jüngeren vorsichtshalber auch das Mikrophon abstellen lassen, aber das war vielleicht bereits ein Tronkasches Märchen.
Gut möglich, das Ganze war nur ein Märchen, ein eingebildeter Peitschenknall, mit dem ein einsam vor sich hinphantasierender Jungdenker die Bühne abräumt, weil jetzt sein Stück an der Zeit ist, weil er jetzt dran ist, um es mit der nötigen Brutalität zu sagen.
Doch auch das, wenn es denn so gewesen sein sollte, ist bereits wieder eine Weile her und er, Hiero, der jetzt dran wäre, quält sich mit dieser beschissenen Dissertation ins wievielte Jahr?
Da muss er doch erst einmal nachrechnen.
Nein, er rechnet nicht nach. Etwas in ihm verweigert die Rechnung, wie es immer die Rechnung verweigert hat, die er von Anfang an hätte aufmachen müssen, in der Pyramide wie in der billigen Wohnung, die er mit Miriam zusammen bewohnte, so wie er sie Heide gegenüber verweigert, die durch ihre Rechenhaftigkeit so ungeniert dazu herausfordert. Nein, es ist kein Honigschlecken mit ihr, der schützende Mantel des Badewassers lässt diese dunkle Empfindung sich vom Boden seiner Seele lösen.
Aber: er kann nicht rechnen.
Hier liegt das Geheimnis seiner Existenz: er kann nicht rechnen.
In seinem Kopf macht eins und eins immer noch drei und so wird es bleiben, solange er sagen kann, er habe nur einen Kopf, aber wenigstens auf den könne er sich leidlich verlassen. Was, alles in allem, stimmt.
Dieser Kopf, dessen Haut er langsam, vorsichtig beginnend, dann in wilder Lust massiert, sagt jetzt unvermittelt: Er ist Miriam davongelaufen, weil er Tronka nicht Paroli bieten kann.

Eikes Trumpf
Stalingrad ist im Grunde kein Thema, nicht für Tronka und seine Getreuen, es klebt zuviel menschliches Elend daran, in Wahrheit durch ein simples ›Tja‹ zu erledigen. Der Abend, der Abend, mit dieser leichten Betonung, die es erlaubt, das einmal Gesagte aus dem Irgendwann des Erinnerns heraufzuheben und zu einem Muster zu verknüpfen, das eine Zeitlang Zusammenhänge stiftet, die ihrerseits wieder verdämmern oder verwehen, sobald man nicht weiter auf sie achtet: auch dieser Abend vergeht, wie er kam. Wie auch sonst? Geblieben zum Beispiel ist die Empfindung, dass der quicklebendige, durch Alkohol gesteigerte Pw, der das Gespräch fast nach Belieben lenkt, ihn, Hiero, in seiner eigenen Existenz Satz für Satz widerlegt. Das erscheint widersinnig, denn Pw reicht an keiner Stelle an ihn heran und dies ist sein Terrain. Wenn er hier weicht, gerät er in den Morast, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Was macht Pw überlegen? Eigentlich lässt Hiero ihn laufen, so wie man ein Hündchen laufen lässt und sich daran erfreut, wenn es apportiert: Brav, liebes Hündchen, vertreib uns ein wenig die Zeit! Er weiß, dass auch Tronka so denkt, jedenfalls hat er es Jahr für Jahr unterstellt: Pw, vertreib uns die Zeit!
Aber die Zeit blieb und lastete, auch diese, wie andere, ausgegrenzte, parallel laufende, sie lastet und verletzt, ein dunkler Block, der sich zwischen die Anfänge und die Zukunft schiebt. Eine zurückweichende Gegenwart müsste man sie nennen, wobei zu entscheiden bliebe, ob sie mehr in die Zukunft ausweicht oder in die Vergangenheit. Auch Pw blieb und was man einmal Apportieren nennen konnte, ist keine Spielerei mit Hölzchen oder Gummiente mehr, es wurde Kampf, verdeckt, zäh, mit Haken und Ösen, da gibts kein Entrinnen.
Kein Zweifel, das liegt an Tronka, der ebenfalls blieb, nicht was, sondern wie er schon lange war, auch wenn die Bereitschaft fehlt, es zu erkennen, ein langsam sich aus aller Gegenwart zurückhangelndes Versprechen, dort, wo es mit dem Leben und Denken ernst wird, sich als ein anderer zu erweisen und die Kathederprätention seiner Kollegen, ›bei den Sachen‹ zu sein, in Leben, Selbstbewegung und Kraft zu verwandeln.
Die Kraft ist ausgeblieben. Doch das hat nicht gereicht, ihn werden zu lassen wie alle anderen auch. Das Ausbleiben hat sich gegen ihn gewandt, so wie es sich gegen Hiero gewandt hat, der seinen Groll als eine Reflexion der eigenen Lage im anderen empfindet, jedenfalls in Momenten, in denen es ihm gut genug geht, um den Kopf so weit zu heben, dass er nicht bloß reiner Groll ist, blinde, dumpfe Erwartung von etwas, das er nur noch negativ, wenn überhaupt, benennen kann.
Die Kraft ist ausgeblieben, auf beiden Seiten. Wie konnte das geschehen? Eike zum Beispiel dort drüben, der jetzt einen Satz sagt, seinen Satz, den er bis dahin aufgespart hat, den Satz, mit dem er die Zinsen eines langen Dabeiseins einfährt, Eike würde kein Wort verstehen, käme er auf die putzige Idee, ihm sein Herz auszuschütten.
Eike ist kein Mann des Entwurfs, sondern der Gelegenheit, auf die er im langen und zähen Tropfen der Zeit lauert. Ein Reptil. Hiero tastet besorgt im Badewasser, das überall Anliegende und durchsichtig Undurchsichtige des Elements ist ihm einen Moment lang zuwider. Es finden sich Spuren der Bedrohung darin, Abdrücke von Wesen, die in ihm aufgehen, denen es alles bietet, was es einem Menschen versagt: die schöne Selbstverständlichkeit der Bewegung und der Sinne zum Beispiel, aber auch den angemessenen Bewegungsraum, gleichgültig, wie eng es darin zugehen mag.
Wesen wie Eike lassen sich nicht in Käfige wegsperren. Der Käfig hat keinen Realität, er löst sich auf in dieser dichteren Wirklichkeit, die um alles herumführt, was sie berührt. Die Freiheit, in der Eike lebt, hat Hiero selten empfunden, er achtet sie gering und verachtet sie sogar. Warum soll er es leugnen? Dennoch empfindet er aufs Neue den Stich. Es ist nicht der Gedanke an einen vergangenen Schmerz, der sich da meldet, sondern der Schmerz selbst. Seltsamerweise hat er die Stimme nicht mehr im Ohr, nur der Satz hat überlebt, das Recht, seinetwegen, ihn zu sprechen.
Eike sagt:
- ―Ich bin Assistent.
Es ist wie immer, wenn alle bereits gehört haben, aber noch weiter reden, weil sie sich verhört haben könnten oder weil die Information so wenig zu den übrigen Daten passt, dass man sie erst einmal liegen lässt, um sich später unauffällig zu erkundigen, wie das vorhin gemeint war. Auch Tronka, ein wenig verdutzt, lässt seinen Blick über ihn hinwegwandern, um nicht fixiert zu werden und vielleicht etwas Missverständliches über die Lippen schlüpfen zu lassen, das nicht mehr zurückgeholt werden könnte. Pw ist der erste, der, scheinbar selbstverständlich, ein paar Gesprächszüge weiter auf die Bemerkung zurückkommt:
- ―Welcher Verein?
- ―Das ist eine gute Frage.
- ―Denk ich doch. Wann gibt es Karten?
- ―Geduld, Geduld. Wenns an den Aufstieg geht, werde ich euch bedenken.
- ―Also Kreisliga.
- ―Kann man so nicht sagen.
Hiero schaltet sich ein.
- ―Was kann man so nicht sagen? Spielt ihr jetzt in der Kreisliga oder nicht?
Peinlich im Nachhinein, diese Frage, aber peinlicher noch die keineswegs praktisch gemeinte, die er nachschiebt, weil er die Vorstellung, Eike mit Ball und Trillerpfeife aufs Fußballfeld traben zu sehen, erst verdauen muss:
- ―Hast du überhaupt einen Trainingsanzug?
- ―Also hör mal –

Das Ticken des Entwerters
Diesmal bewegt sich nichts. Ist das noch ein Schuh? Ein Holzschuh vielleicht, klobig genug wäre er. Es könnte auch ein Stück eines Dachgiebels sein, einer Gaube vielleicht. Passt so etwas an einen Fuß? Es gibt Fragen, mit denen muss man sich nicht beschäftigen, nicht wirklich, was immer das heißen mag, denn die Wirklichkeit steckt in solchen Fragen und lugt aus ihnen heraus, jedenfalls könnte man das blinkende Tröpfchen, das in ihnen aufscheint, als Auge interpretieren. Dass die Wirklichkeit einäugig ist, hat noch keiner wirklich behauptet. Es ist eine abstruse Bemerkung, mit der sich kein Blumentopf gewinnen lässt. Gerade deshalb scheint sie hier am Platz. Mechtel jedenfalls, diese prachtvolle Person, erweist sich als wundersam berührt durch den Geist der Situation, der vielleicht ein Ungeist ist, ein verdrehter Geist gewissermaßen, angetreten, um Unheil zu säen zwischen den Vertrauten.
- ―Ich verstehe nichts von Fußball, schwebt ihre sanfteste Mädchenstimme, die noch immer metallisch klingt, als surre auf ihrem Grunde ein kleiner Elektromotor, – vielleicht kannst du mir einfach erklären, von welchem Verein hier die Rede ist und welche Aufgabe du darin übernommen hast. Ich meine, es geht mich sicher nichts an, aber die Herren scheinen ja augenblicklich nicht weiter zu kommen. Ich kann das verstehen, obwohl ich der Meinung bin, dass da nichts zu verstehen wäre, würde man sich ein bisschen der freien Rede befleißigen, aber das ist in diesem Kreis ja allmählich aus der Mode gekommen, wie ich mit ein wenig Bedauern feststelle. Hans-Hajo zum Beispiel, der... – ihr Blick gleitet zu dem Platz, an dem er eben noch gesessen hat, aber der Platz ist leer –, Hans-Hajo, der jetzt gerade nicht da ist, hat mir noch gestern gesagt, dass er nicht versteht, warum hier seit einiger Zeit alle so verkniffen herumsitzen, er sagt, er kennt das gar nicht von dieser Runde und eigentlich wundere es ihn, nein, eigentlich wundere es ihn nicht, denn, recht bedacht, habe das Ganze auf eine solche Situation hinauslaufen müssen. Ich meine ja, dass er damit nicht recht hat, ich finde es schade, dass er gerade jetzt nicht da ist, sonst könnte er erläutern, wie er das meint. Eigentlich fände ich es schön, wenn Eike eine Stelle gefunden haben sollte. Das wäre doch einmal was und ich würde gern mehr von ihm darüber erfahren. Aber es scheint ja nicht mehr möglich zu sein, sich über so etwas...
Wie es so geht, schwingt in diesem Moment die Tür auf und herein schlendert Hans-Hajo, der kurzfristig Entschwundene. Sein Haar buscht sich über der glatten Stirn, als sei ein Windstoß hineingefahren, es ist wie Osterglockenpflücken im Mai. Lässig hält er einer Person die Tür, die man noch nicht sieht und deren Eintritt sich aus unsichtbarem Grunde verzögert. Er spricht über die Schulter zurück und scheint etwas entrückt zu sein. Jedenfalls glaubt Hiero an Mechtel eine Bewegung wahrzunehmen, die so nicht aus dem Duktus ihrer kleinen Ansprache hervorging. Doch wie immer fängt sie sich rasch. Eher äußert sich eine leise Besorgnis in der Art, wie sie die Augen hebt und flüchtig seinen Blick streift, der, durch diese Aberration gebändigt, wieder zur Tür eilt und dort – das darf doch nicht wahr sein! – auf Miriam trifft, die, seit sie zusammen sind, nicht mehr im Pfau gesehen wurde, da sie sich, seinem Vorbild folgend, wie sie sagt, stärker auf ihr Studium konzentriert und in ihrer freien Zeit andere Orte bevorzugt, solche, die sie gemeinsam aufsuchen oder Lokalitäten, an denen sie sich mit ihren Freundinnen verabredet und zu denen es ihn nicht zieht. So ist es ganz natürlich, dass sie erst mit dem Wirt ein paar Worte wechselt, bevor sie an den Tisch tritt, wo neben Anton der Platz noch frei ist, an dem bis vor kurzem Luxor saß.
Hiero sieht sie näher kommen und wie in dem LSD-Streifen, den er vor kurzem gesehen hat, blitzt schmerzhaft einen Moment lang aus ihrem vertrauten Gang die nackte Miriam hervor, die hier, worum er innerlich bittet, keiner kennt und keiner zu kennen braucht. Ist es wahr, dass er ihrem Erscheinen gerade jetzt eine völlig überproportionale Bedeutung beimisst? Musste es nicht einmal geschehen und wäre es nicht besser, sich ins Unvermeidliche zu schicken und diesen so vielfältig geliebten Zügen mit einer Spur von Einverständnis zu begegnen? Aber er schickt sich doch, was denn sonst, auch wenn er so dabei zittert, dass ihn Mechtel verstohlen unter dem Tisch – nein, nicht tritt, wie es sich gebührte, sondern leise berührt, so leise, dass nun die große Glocke, die lange schweigend und unbeteiligt dem Gebimmel der kleinen Erregungen beiwohnte, in ihm anschlägt und zu dröhnen beginnt, so dass er binnen kurzem nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht. Und Hiero, in sein erneut erkaltendes Badewasser wie in eine Decke gehüllt, deren zweifelhafter Schutz mit einem Mal seine Hinfälligkeit offenbart, explodiert erneut, so wie er jedesmal explodiert, wenn er sich diesem Erinnerungspunkt nähert.
- ―Erzählen Sie, sagt Tronka mit seiner ruhigsten Stimme.
Hiero versteht nicht. Was gibt es da zu erzählen? Doch die Rede des Meisters geht an ihm vorbei, so wie sein Blick, kalt und ein wenig bittend, an Miriam vorbeigeht, die sich vermutlich einfach in ihm auflösen würde, wenn er auf Grund eines unfassbaren Versehens plötzlich durch sie hindurchginge. Und Eike erzählt, die Wörter treiben aus seinem Mund heraus, sie schwingen sich paarweise, in Dreier- und Vierergruppen, in die umgebende Luft und wirklich, ihre Darbietung kann sich sehen lassen, auch wenn einzelne unter ihnen einen eher unansehnlichen Eindruck hinterlassen könnten. Gerade sie scheinen die Tüchtigsten von allen zu sein, die unerlässlichen Bindeglieder von Figuren, die sie schwebend, schwimmend und rollend zur Darstellung bringen. Ein Zeichentrickfilm, begleitet vom ziehenden Ton eines Akkordeons, einer Quetschkommode, denn anders kann man Eikes Stimme wirklich nicht nennen, einem nüchtern triumphierenden Gesumse und Gewese, das sich umsonst zu verstecken versucht. Doch das Spiel der Wörter ist schön, sie wissen auf eine traumhafte Weise zu wachsen und zu vergehen, ineinander überzugehen und zu verschmelzen und, einzeln, in plötzliche Einsamkeit zu verfallen, die vom Einsatz des nächsten weggewischt wie eine Träne, die folgenlos bleibt, aber selbst bereits Folge war. In Folge von... Jetzt versteht Hiero den Sinn der gravitätischen Formel, versteht ihn aus dem Grund, versteht sich nicht mehr, aber die Welt oder was sie dafür halten, was immer sie dafür halten, was immer...
In Hieros Universum sind der Punkte zuviel. Plötzlich, aus Ursachen, die ihm verschleiert bleiben, beginnen sie zu strömen, von irgendeinem Sog erfasst, einem Sog aus dem Jenseits, wenn man darunter keine zweite Welt, sondern die erste noch einmal versteht, wie immer sich diese Formel auflösen lassen mag. Tronkas Revier ist das nicht. Er liebt den Schlusspunkt, das Punktum zu sehr, als dass er hier Fuß fassen könnte. Das ist auch nicht nötig.
Es wäre nicht nötig, Eike gewähren zu lassen, mit einem Wort, einem Wink könnte Tronka Abhilfe schaffen. Das ist doch peinlich, diese Schaustellung banaler Emsigkeit in einem Fach, über das sie sich hier ansonsten lustig machen, einem Fach, das ausschließlich der Doxa gewidmet ist, diese Kette absurder Zufälle, an deren Ende die Stelle steht, um die sich, zugegeben, hier alles dreht. Das Peinlichste dabei: dass sich dieser ungute Aufstieg in völliger Lautlosigkeit, unbemerkt von den Augen und Ohren der Freunde vollzogen hat. Im Grunde, so müsste man sagen, hat Eike sie hintergangen – Grund genug, ihm jetzt das Wort abzuschneiden und zu den Sachen zurückzukehren, jetzt, ohne weitere Umstände, umstandslos wie das Denken selbst, wenn es in Betracht kommen will. Dafür sitzen sie schließlich beieinander, dazu haben sie sich erzogen. Jedenfalls gilt das für ihn, bei den anderen ist er sich nicht mehr so sicher.
Aber da sitzt Miriam, ganz Gehör, artig, nur ihre Hand scheint abwesend zu sein, geistesabwesend, wenn es das gibt. Es ist ihm neu, wie sie sie hält, die Finger abwärts weisend, eng beieinander, als berührten sie einen unsichtbaren Gegenstand. Hiero spürt, wie ihm die Röte ins Gesicht steigt, Zorn, blinder Zorn, untermischt mit Scham. Er muss sehr vorsichtig sein. Es könnte sein, dass er, hier und jetzt, ausrutscht und etwas passiert, mit dem niemand rechnen konnte. Nur: was könnte das sein?
Was könnte das sein? Tronka ahnt nichts. Seine zarte Konstitution erlaubt es ihm nicht einmal, die weibliche Störung zu bemerken, die sich an seinem Tisch niedergelassen hat. Dennoch leidet er, man sieht es seiner starren Kopfhaltung an. Er wahrt die Würde des Ortes und plötzlich drängt es Hiero, in einem Anfall blinder Gefolgschaft, das lange verhüllte Wort ›Sakrileg‹ in den Mund zu nehmen, gerade so, es schießt ein und seine Stimmbänder knirschen es hervor, so dass ihn nur die Nächstsitzenden verstehen. Alle aber haben etwas gehört und sind verständigt. Etwas geschieht, endlich, nach langer, vielleicht allzu langer Zeit. Gerade hat Eike das Signal gegeben, sich zu zerstreuen, weil draußen die besseren Chancen herumliegen, nach einer Zeit der Routine und der ärgerlichen Versprecher, von denen man auch Tronka nicht freisprechen kann, der seiner Rolle, alles in allem, nur unter Mühen nachkommt. Was wäre denn seine Rolle? Soll er künftig vor ihnen den Professor geben, der er angeblich niemals sein wollte? Soll er weiterhin den Typ mimen, der er offensichtlich nicht mehr ist, obwohl sie alle auf ihn geeicht sind? Das eine Wort, das Knirschwort, offenbart das Absurde der Situation und obwohl es die wenigsten richtig gehört haben, wurden sie von ihm berührt.
Nein, es ist nicht das künftige Türschild, das Hiero in diesen Momenten bewegt. Ohnehin hat es in der Pyramide an innerer Lebendigkeit eingebüßt, an Präsenz, wie der exakte Begriff lautet. Noch immer spendet es Lebenssinn, aber mehr aus dem Hintergrund, mittels verwickelter Operationen, die er im Einzelnen nicht durchschaut und auch, wenn er ehrlich ist, nicht durchschauen will. Vielleicht kann er es nicht, das mag gut sein, weil es seiner doch eher direkten Art widerstrebt, die nur in der Theorie Umwege zu gehen bereit ist und auch dort nur in Maßen.
Wenn ihn die Leidenszeit etwas gelehrt hat, dann dies: wer sich im Labyrinth der Begehrlichkeiten verirrt, der ist verloren, gleichgültig, was der Gang der Dinge für ihn noch bereithält. Direkt ist nur der gewonnene Gedanke, das Klondike-Gold des systematischen Denkens, das sich bequem in alle Subregionen des Geistes transportieren lässt und an jedem Schalter bereitwillig angenommen wird, der seinerseits an die Systeme angeschlossen ist und nicht nur eine Potemkinsche Fassade darstellt, hinter der sich der private Unrat stapelt und es von zweifelhaften Triebtätern wimmelt.
Was bedeutet es da, wenn einer nebenan im Cabrio vorfährt und nicht müde wird, den Nachbarn den Klappmechanismus zu erklären, der das Verdeck aus unsichtbaren Tiefen heraufbefördert und in Windeseile vor den Augen der Gespannten ausfährt?
Nichts, es bedeutet nichts. Wenn jedoch diese Nachbarn von der Darbietung nicht genug bekommen, wenn sie alles haarklein erklärt haben wollen, damit das Staunen nicht so schnell verebbt, wenn unter ihnen, neben der Frau, mit der man noch immer das Leben teilt und die in diesem Kreis, strikt gesprochen, nichts verloren hat, der Meister selbst ganz Ohr geworden ist und keine Möglichkeit besteht, sich herauszuwinden, dann ist es Zeit zu begreifen, dass die Veranstaltung aus dem Ruder läuft, und zwar unwiderruflich. Ja, man muss sich fragen, wer hier der Veranstalter ist und was hier veranstaltet wird.
Es ist ein müdes Spektakel, gegen das gewaltige Eintrittsgeld gehalten, das einem abverlangt wurde. Aber vielleicht sind die anderen umsonst herein gekommen, gerade so will es ihm im Augenblick scheinen, er hat darüber nie nachgedacht. Miriam jedenfalls, deren Anwesenheit niemanden zu stören scheint außer Tronka, der ihm den Buckel runterrutschen kann, und ihn selbst, der sich gegen sie aufbäumt, wüsste gar nicht, wovon die Rede wäre, würde er ihr deshalb Vorhaltungen machen. Sie würde ihn rundheraus für gestört erklären und hätte, wer weiß, vielleicht nicht einmal Unrecht damit. Aufgestört, das ist er. Er könnte um sich schlagen, er könnte kratzen und beißen, er weiß keine Stelle, an der er sich ruhig niederlassen könnte.
Die Luft schwirrt von Geschossen, er ist verwundet und merkt es nicht, das Blut läuft ihm in hellen Strömen davon. Wohin? Er könnte aufstehen und durch die Tür hinausgehen, die Hans-Hajo vorhin so chevaleresk aufgehalten hat, es wäre ein Abgang für immer. Er könnte es, aber er rührt keinen Muskel. Der Aufruhr ist innen und dort soll er auch bleiben. Kein Mucks soll nach außen dringen, sie sollen ihre Lästerzungen nicht an ihm wetzen, er will es nicht. Was also will er? Das ist schwer zu sagen.
Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll. Mechtel aber, die Gute, versteht sich zu einer Geste: sie presst ihr Bein so stark gegen das seine, dass es kein Zufall mehr sein kann, und kritzelt etwas auf einen Fetzen Papier – eine Figur, die ihm nichts sagt, weil er viel zu angespannt ist, als dass er mehr als einen flüchtigen Blick darauf werfen könnte, eine Art Totempfahl, er wusste gar nicht, dass sie eine so geschickte Zeichnerin ist.

Epilog
Das ist lange her.
- ―Nun, meine Liebe, du glaubst doch nicht im Ernst...
- ―Wärst du wirklich imstande...?
- ―Das hättest du dir früher überlegen müssen, das ist jetzt alles ein wenig...
- ―Vergiss nicht, dass ich die ganzen Jahre über...
- ―Du bildest dir doch nicht ein, dass ich das alles aufgebe, nur...
- ―Du hättest längst deinen Abschluss finden müssen, ich kann dir da wirklich nicht...
- ―Hast du gedacht, das ginge jetzt ewig so...
- ―Ich bin doch nicht verrückt, jedenfalls nicht so...
- ―Ein bisschen Verantwortung übernehmen kann doch nicht so schwer...
- ―Dein Vater lebt aber nicht mehr, du kannst nicht so tun...
- ―Wenn du nur einen Kopf hast, warum gebrauchst du ihn nicht?
Das sitzt. Auch hier ist Leben, und falls Hiero geglaubt hat, er könne dem entgehen, so hat er sich, nun, ›getäuscht‹ ist nicht der richtige Ausdruck, nicht ganz der richtige Ausdruck.
Um aus einem Leben herauszutreten, das ihm unwillkürlich ist, hätte er das Badewasser nicht erst verlassen brauchen. Es hätte genügt, sich still und leise die Pulsadern aufzuschneiden, richtig aufzuschneiden, nicht nach Dilettantenart. Dass er es nicht gemacht hat, zeigt, er ist durchaus Herr im eigenen Haus, er kann es sein, wenn ihm danach ist.
Ihm ist nur nicht immer danach. Er wird jetzt an Heide vorbeigehen, einen Schritt vor den anderen, Schritt um Schritt, wie es sich gehört. Das Raum-Zeit-Kontinuum erlaubt solche Späße ohne weiteres, es wird ein großer Spaß sein, das verspricht er sich ohne Bedenken. Wenn der eine oder andere Versprecher dabei ist, so nimmt er ihn, der Sache wegen, in Kauf. Nein, er lallt nicht, er hat auch nicht getrunken, das wird im Lauf des Abends passieren, er weiß noch nicht, wie er zurückkommen wird, ob... Aber jetzt, nüchtern, gehen ihm schon einmal die Worte ab, er muss sich danach bücken, das sieht nicht gut aus, sieht wirklich nicht gut aus, er sollte es lassen. Sollen sie doch rollen, wohin sie wollen. Ein Mann braucht nicht immer Worte für das, was er tut, vor allem, wenn er gewohnt ist, sie am Schreibtisch zu verbrauchen, das gelingt nicht jedem im Leben, nicht jedem. Im Grunde kann er stolz sein, nicht auf das Erreichte, das steht ein wenig kümmerlich da, aber vielleicht auf das, was er noch erreichen will. Das jedenfalls wäre ein Vorschlag.
Ein Vorschlag im Guten. Er könnte ihn aufschreiben wie so manches andere, aber es ist zu spät. Es ist auch niemand da, der ihn lesen wollte. Einer wie er kann sich winden, um der Tortur zu entgehen, was sonst? Sie aber steht am Ende des Tunnels und weicht nicht... Trägt sie Reitpeitsche heut’ oder nur Brygidas schicke Uniform? Das ist im Grunde egal.
Sohn sein, wohin die Füße auch tragen. Hierhin, dahin, kreuz und quer, eine Kulturlandschaft tut sich auf, die Welt will ergangen werden. Ergangen, hörst du, Hiero? Schrei doch nicht so, die Nachbarin wird schon ganz blass. Das wird sie immer, du kannst ihr dabei nicht helfen. Sie ist eine Hübsche, das darf wohl noch gesagt werden. Oder gedacht. Vielleicht kennt auch sie einen Ver-, Ver-, Vorschlag, auf den man eingehen könnte, wenn einem der Griffel entgleitet, verschlagen sind sie doch alle. Diese etwas beklommene Pilgerschaft wird es am Ende nicht bringen. Doch, du weiß das, auch dieser Gedanke ist Klondike-Gold, ein bisschen kontaminiert vielleicht, das liegt sicher am Drang, der einen in diesen Dingen beseelt, wie überhaupt, du hast nicht umsonst den alten Bartosz...
Was? Ja Was? ›In die Pfanne gehauen‹ wolltest du sagen. Aber das ist doch Unsinn, ersichtlich Unsinn, will sagen: eine erbärmliche Vorstellung, so ein Wort kommt dir nicht über die Lippen.
